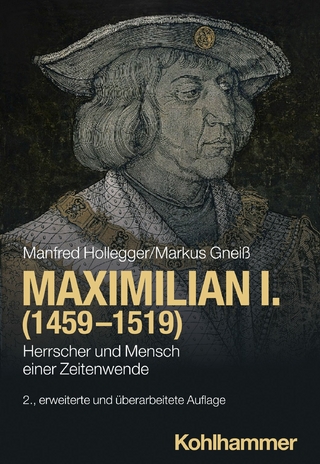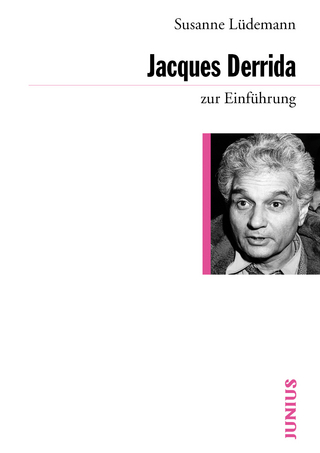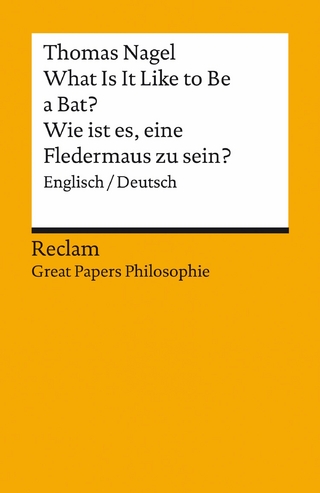Das Ich im Wir (eBook)
308 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-73238-0 (ISBN)
Axel Honneth, geboren 1949, ist Jack C. Weinstein Professor of the Humanities an der Columbia University in New York. 2015 wurde er mit dem Ernst-Bloch-Preis, 2016 für <em>Die Idee des Sozialismus</em> mit dem Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch ausgezeichnet. 2021 hielt er in Berlin seine vielbeachteten Benjamin-Lectures zum Thema des Buches <em>Der arbeitende Souverän</em>.
Cover 1
Informationen zum Buch / Autor 2
Impressum 4
Inhalt 5
Vorbemerkung 7
I. Hegelsche Wurzeln 13
Von der Begierde zur Anerkennung Hegels Begründung von Selbstbewußtsein 15
Das Reich der verwirklichten Freiheit Hegels Idee einer »Rechtsphilosophie« 33
II. Systematische Konsequenzen 49
Das Gewebe der Gerechtigkeit Über die Grenzen des zeitgenössischen Prozeduralismus 51
Arbeit und Anerkennung Versuch einer theoretischen Neubestimmung 78
Anerkennung als Ideologie Zum Zusammenhang von Moral und Macht 103
Verflüssigungen des Sozialen Zur Gesellschaftstheorie von Luc Boltanski und Laurent Thévenot 131
Philosophie als Sozialforschung Zur Gerechtigkeitstheorie von David Miller 158
III. Sozialtheoretische Anwendungen 179
Anerkennung zwischen Staaten Zum moralischen Untergrund zwischenstaatlicher Beziehungen 181
Organisierte Selbstverwirklichung Paradoxien der Individualisierung 202
Paradoxien der kapitalistischen Modernisierung Ein Untersuchungsprogramm (gemeinsam mit Martin Hartmann) 222
IV. Psychoanalytische Weiterungen 249
Das Werk der Negativität Eine anerkennungstheoretische Revision der Psychoanalyse 251
Das Ich im Wir Anerkennung als Triebkraft von Gruppen 261
Facetten des vorsozialen Selbst Eine Erwiderung auf Joel Whitebook 280
Entmächtigungen der Realität Säkulare Formen des Trostes 298
Textnachweise 307
7Vorbemerkung
Der vorliegende Band vereinigt Aufsätze und Diskussionsbeiträge, die in den letzten Jahren mit dem Ziel entstanden sind, die Grundannahmen einer an Hegel anknüpfenden Anerkennungstheorie weiter auszubuchstabieren. Nachdem ich im Kampf um Anerkennung zum ersten Mal meine eigene Deutung des Hegelschen Ansatzes umrissen hatte, war ich zwar nach meinem subjektiven Eindruck schon genügend damit beschäftigt, die dort entwickelte Position auf Einwände hin entweder zu korrigieren oder zu präzisieren; vor allem die Auseinandersetzung mit Nancy Fraser und die Tanner-Lectures an der Universität Berkeley gaben mir willkommene Gelegenheiten, meinen zunächst noch vagen Überlegungen eine genauere Fassung zu geben.[1] Aber auf dem damit beschrittenen Weg, der auch Versuche einschloß, die Anregungen alternativer Intersubjektivitätstheorien zu verarbeiten,[2] blieben noch viele Fragen ungelöst; immerhin hatte ich ja den Versuch unternehmen wollen, die Hegelsche Anerkennungslehre so zu rekonstruieren, daß daraus Einsichten nicht nur für eine Neufassung des Gerechtigkeitsbegriffs, sondern auch für eine verbesserte Bestimmung des Verhältnisses von Vergesellschaftung und Individuierung, von sozialer Reproduktion und individueller Identitätsbildung folgen sollten. Die vielfältigen Klärungsbemühungen, zu denen mich diese weitgespannten Zielsetzungen in den letzten Jahren genötigt haben, finden sich in dem vorliegenden Band versammelt; mit wenigen Ausnahmen bewegen sie sich an jenen Rändern der Sozialphilosophie, an denen sich normative Fragen nur unter Einbeziehung der empirischen Anstrengungen anderer, benachbarter Disziplinen sinnvoll beantworten lassen.
Den Auftakt macht allerdings ein Teil, in dem zwei Beiträge enthalten sind, in denen ich mich noch einmal auf wesentliche Elemente der praktischen Philosophie Hegels zurückwende. Während 8ich im Kampf um Anerkennung noch von der Prämisse ausgegangen war, daß nur die Jenaer Systementwürfe tragfähige Elemente einer Anerkennungstheorie enthalten, habe ich mich später infolge einer vertieften Beschäftigung mit den reiferen Schriften eines Besseren belehren lassen; inzwischen glaube ich nicht mehr, daß Hegel seinen anfänglichen Intersubjektivismus im Zuge seiner Entwicklung einem monologischen Konzept des Geistes geopfert hat, sondern ich gehe davon aus, daß er zeit seines Lebens den objektiven Geist, also die soziale Realität, als ein Verhältnis aus geschichteten Anerkennungsverhältnissen begreifen wollte. Von dieser Neueinschätzung aus hatte ich mich schon vor einigen Jahren an den Versuch gemacht, nun auch die Hegelsche Rechtsphilosophie für die Ausarbeitung einer Anerkennungstheorie fruchtbar zu machen; viel stärker als in den Frühschriften war hier ja bereits der bahnbrechende Gedanke anzutreffen, daß wir die soziale Gerechtigkeit mit Blick auf die Erfordernisse wechselseitiger Anerkennung bestimmen und dabei von den historisch jeweils gewachsenen, bereits institutionalisierten Anerkennungsverhältnissen ausgehen müssen.[3] In dem Aufsatz zu Hegels Begriff des Selbstbewußtseins, der sich mit einem Schlüsselkapitel der Phänomenologie des Geistes beschäftigt, versuche ich nun zu klären, was wir in diesem Kontext systematisch unter Anerkennung verstehen können; darunter läßt sich beim reifen Hegel, so will ich zeigen, die Art von moralischer Selbstbeschränkung begreifen, die wir angesichts anderer Personen vollziehen können müssen, um überhaupt zu einem Bewußtsein von uns selbst zu gelangen. Der Aufsatz zur Hegelschen Rechtsphilosophie versucht demgegenüber die schwierige Frage zu beantworten, wie wir uns den internen Zusammenhang zwischen einer solchen Form von Anerkennung und der menschlichen Freiheit vorstellen sollen; diese Verknüpfung wird nach meiner Auffassung von Hegel hergestellt, indem er gegenüber dem Liberalismus seiner Zeit vorzuführen versucht, daß wir nur durch Teilnahme an institutionalisierten Praktiken der individuellen Selbstbeschränkung unseren Willen tatsächlich als unbeschränkt frei erfahren können.
Der zweite Teil enthält Aufsätze, in denen ich die soeben skizzierten Ideen Hegels selbständig weiterzuentwickeln versuche, um mit ihrer Hilfe einige zentrale Probleme einer zeitgenössischen Gerech9tigkeitstheorie zu klären. Dabei kann als systematische Rahmung all dieser Vorstöße durchaus der erste hier abgedruckte Beitrag verstanden werden, der die uns heute geläufige Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit dadurch korrigieren soll, daß er sie von der Fixierung auf Prinzipien der Güterverteilung auf Maßnahmen der Schaffung von symmetrischen Anerkennungsverhältnissen umleitet. Eine solche theoretische Umpolung darf freilich, wie ich in den beiden nächsten Aufsätzen zeigen möchte, weder vor der Problematisierung der gegebenen Organisation von Arbeit noch vor der schwierigen Frage haltmachen, welche Formen von sozialer Anerkennung heute indirekt zur Festigung sozialer Herrschaft beitragen; weder die Sphäre der gesellschaftlichen Arbeit noch die Wirkung von machtstabilisierenden Ideologien lassen sich aus dem Korpus einer Gerechtigkeitstheorie durch begriffliche Vorentscheidungen einfach herausdefinieren. In der Auseinandersetzung mit der höchst instruktiven Studie Über die Rechtfertigung von Luc Boltanski und Laurent Thévenot führe ich einige der zuvor entwickelten Überlegungen noch einmal zusammen, indem ich gegen deren Tendenz zur Entstrukturierung der gesellschaftlichen Moral das normative Gewicht von bereits institutionalisierten Sphären der Anerkennung herausarbeite. Ähnliches unternehme ich in einem Beitrag zur Gerechtigkeitstheorie von David Miller, der ursprünglich als Vorwort zu dessen inzwischen klassischer Monographie über die Grundsätze sozialer Gerechtigkeit erschienen ist; auch hier versuche ich darzulegen, daß eine im Hegelschen Geist vorgenommene »Rekonstruktion« der historisch bereits etablierten Anerkennungsprinzipien unerläßlich ist, wenn sich die ins Auge gefaßte Gerechtigkeitskonzeption stärker an der sozialen Wirklichkeit orientieren soll.
Im dritten Teil, dem ich mit einem relativ vagen Begriff die Aufgabe der sozialtheoretischen Anwendung zugewiesen habe, geht es mir darum, die zuvor entwickelten Ideen für explanatorische Zwecke nutzbar zu machen; nicht mehr normative Fragen, sondern Probleme der soziologischen Erklärung stehen daher im Mittelpunkt der hier versammelten Aufsätze. Allerdings läßt sich bei derartigen »Anwendungen«, wie sich schnell zeigen wird, keine saubere Abtrennung der sozialen Fakten von normativen Geltungsansprüchen vornehmen; sobald wir mit Hegel Anerkennungsbeziehungen als konstitutiv für alle gesellschaftliche Wirklichkeit begreifen, müssen wir vielmehr feststellen, daß wir bei jeder Erklärung sozialer Prozesse 10auf geltende Normen und Prinzipien Bezug nehmen müssen – diese gehören als Ansprüche oder Forderungen, als Verbindlichkeiten oder Überzeugungsgehalte ebenso zu der zu erklärenden Wirklichkeit wie die angeblich rein »objektiven« Sachverhalte. Der erste der hier abgedruckten Beiträge stellt eine noch sehr tentative Reaktion auf neuere Versuche innerhalb der Politikwissenschaften dar, die Spannungen und Dynamiken innerhalb der internationalen Beziehungen mit Hilfe der Anerkennungsbegrifflichkeit zu erklären; mir geht es dabei um nichts anderes als um eine Klärung des Umfangs, in dem es explanatorisch sinnvoll sein kann, sich die Beziehungen zwischen Staaten als durch Erwartungen der Anerkennung reguliert zu denken. Die beiden anderen Aufsätze dieses Teils verdanken sich Prozessen der theoretischen Selbstverständigung am Institut für Sozialforschung; ich versuche hier, im zweiten Fall gemeinsam mit Martin Hartmann, die von uns dort interdisziplinär untersuchten »Paradoxien« in der Entwicklung des gegenwärtigen Kapitalismus dadurch genauer zu erläutern, daß empirisch veranschaulicht wird, inwiefern historisch gewachsene Anerkennungserwartungen heute durch ökonomische Strukturwandlungen in disziplinierende Zumutungen an die Subjekte verkehrt werden. Im Zusammenhang des vorliegenden Buches können diese beiden, im engeren Sinn soziologischen Aufsätze freilich nur erste Hinweise darauf geben, wie eine anerkennungstheoretisch angelegte Gegenwartsdiagnose verfaßt sein müßte.
Der vierte Teil nimmt schließlich einen theoretischen Faden wieder auf, den ich seit meinem Buch über den »Kampf um Anerkennung« beinahe vollständig liegengelassen habe.[4] Von Anfang an war ich davon überzeugt, daß sich soziale Anerkennungsbeziehungen nur unter der Voraussetzung von entsprechenden Strukturbildungen innerhalb der menschlichen Psyche entfalten können, wie sie vorbildhaft von der psychoanalytischen Schule der Objektbeziehungstheorie untersucht werden. Auch wenn mir diese Rückbindung an die Psychoanalyse gelegentlich den Vorwurf eingebracht hat, die Annerkennungstheorie insgesamt zu »psycholo11gisch« anzulegen, sehe ich bis heute keinen Grund dafür, von dem Vorhaben einer Verschränkung von äußerer sozialer Anerkennung und psychischer Strukturbildung abzulassen; natürlich darf man nicht den genetischen Fehlschluß begehen, Anerkennungsforderungen mit Verweis auf die Gefahr psychischer Beeinträchtigungen zu rechtfertigen, aber ansonsten scheinen mir in einer Verzahnung von Anerkennungstheorie und Psychoanalyse nur Vorteile zu liegen. Einige dieser Erkenntnisgewinne habe ich in den beiden hier abgedruckten Aufsätzen zur Bedeutung sozialer Gruppen und zum Stellenwert psychischer Entgrenzungen herausarbeiten wollen; die beiden anderen Beiträge, vor allem die Auseinandersetzung mit meinem Freund Joel Whitebook, stellen Versuche...
| Erscheint lt. Verlag | 18.2.2013 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Philosophie der Neuzeit |
| Schlagworte | Anerkennung • Aufsatzsammlung • Bruno-Kreisky-Preis 2015 • Ernst-Bloch-Preis 2015 • Georg Wilhelm Friedrich • Hegel • Hegel Georg Wilhelm Friedrich • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich • Philosophie • Sozialphilosophie • STW 1959 • STW1959 • suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1959 |
| ISBN-10 | 3-518-73238-2 / 3518732382 |
| ISBN-13 | 978-3-518-73238-0 / 9783518732380 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich