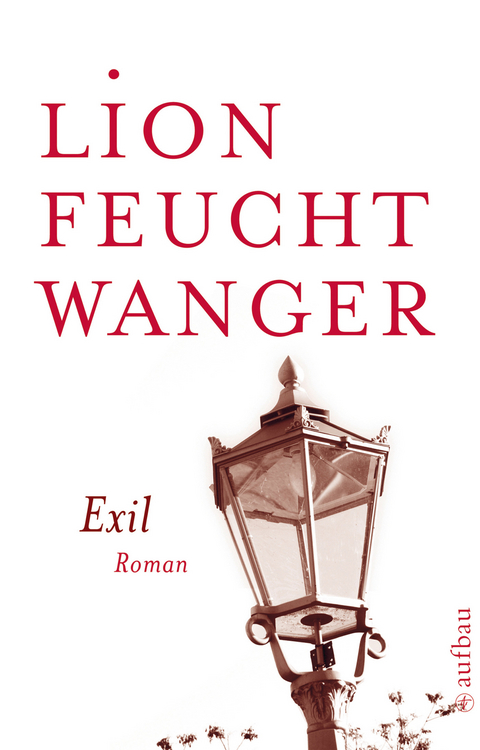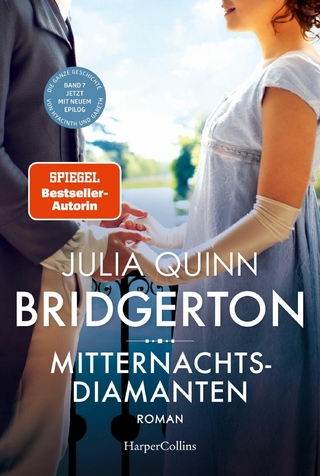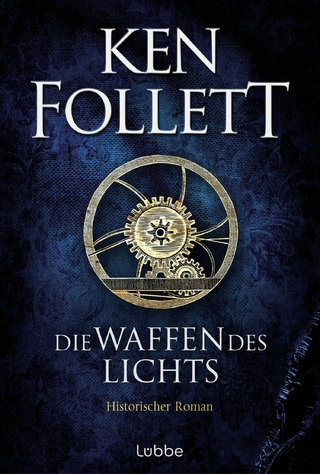Exil (eBook)
862 Seiten
Aufbau digital (Verlag)
978-3-8412-0618-3 (ISBN)
Der Schlüsselroman über das Leben deutscher Emigranten. Schauplatz dieses Romans ist Paris, die Stadt, die für Tausende deutscher Flüchtlinge zum Exilort wurde. Im Frühjahr 1935 wird Friedrich Benjamin, ein bekannter Publizist und Redakteur einer deutschen Emigrantenzeitung, von den Nazis verschleppt. Sepp Trautwein, der von seinem Münchner Lehrstuhr vertriebene Musikprofessor und Komponist, gibt die Musik auf, um Benjamins Sache zu seiner eigenen zu machen. Er kämpft einen fast hoffnungslosen Kampf, der sich schließlich als Ansporn und Bestätigung in seiner Kunst niederschlägt. Er komponiert die Sinfonie 'Der Wartesaal', eine Metapher für die Zeit des Exils. Feuchtwanger wählte einen authentischen Fall als Ausgangspunkt für eine differenzierte Darstellung der Situation deutscher Exilanten, ihrer Existenznöte, ihrer politischen Zerrissenheit und ihres 'ohnmächtigen und ein bißchen lächerlichen' Kampfes gegen einen riesigen Staat und seinen übermächtigen Apparat.
Lion Feuchtwanger, 1884-1958, war Romancier und Weltbürger. Seine Romane erreichten Millionenauflagen und sind in über 20 Sprachen erschienen. Als Lion Feuchtwanger mit 74 Jahren starb, galt er als einer der bedeutendsten Schriftsteller deutscher Sprache. Die Lebensstationen von München über Berlin, seine ausgedehnten Reisen bis nach Afrika, das Exil im französischen Sanary-sur-Mer und im kalifornischen Pacific Palisades haben den Schriftsteller, dessen unermüdliche Schaffenskraft selbst von seinem Nachbarn in Kalifornien, Thomas Mann, bestaunt wurde, zu einem ungewöhnlich breiten Wissen und kulturhistorischen Verständnis geführt. 15 Romane sowie Theaterstücke, Kurzgeschichten, Berichte, Skizzen, Kritiken und Rezensionen hatten den Freund und Mitarbeiter Bertold Brechts zum 'Meister des historischen und des Zeitromans' (Wilhelm von Sternburg) reifen lassen. Mit seiner 'Wartesaal-Trilogie' erwies sich der aufklärerische Humanist als hellsichtiger Chronist Nazi-Deutschlands.
1
Chez nous
»Ich sag es Ihnen, wie es ist, Kollege«, ereiferte sich, krähend, Sepp Trautwein, er tappte, die Füße nach innen gestellt, heftig, unmanierlich durch Heilbruns kahles und prunkvolles Büro. »Mir gefällt Ihr Artikel gegen Wiesener gar nicht. Er mißfällt mir. Wir sollten Methoden, wie Sie sie da anwenden, nicht brauchen. Solche Methoden sollten wir den Scheißkerlen von drüben überlassen.«
Heilbrun lag auf der Couch in seiner Lieblingshaltung, die Arme hinterm Kopf verschränkt, er war unausgeschlafen, doch merkte man ihm das weniger an als sonst. Der Angriff Trautweins traf ihn. Vorläufig aber beschränkte er sich darauf, mit milder Ironie zu erwidern: »Ja, weil wir mit der Vornehmheit so gute Erfahrungen gemacht haben. Weil die Herrschaften drüben auf Vornehmheit so vornehm reagieren.« Er richtete sich hoch, setzte Trautwein seine Gründe auseinander. »Wiesener«, sagte er, »ist der Schlimmste von allen. Die andern sind Dummköpfe und brüllen einfach nach, was ihnen das Reklameministerium vorbrüllt. Aber Wiesener weiß genau, was er tut. Ein Feind von seiner Intelligenz ist gefährlicher als hundert dumme Schimpfer. Ihn anzugreifen, seine Stellung ins Wanken zu bringen, ist notwendig, ist ein Verdienst.«
Heilbruns Logik bewirkte, daß Trautwein in seinem aufgeregten Gang durch das Zimmer innehielt. Heilbruns Argumente stimmten natürlich. Allein der Eifer für die gute Sache war sicherlich nicht der einzige Grund der wilden Attacke auf Wiesener, sondern es bestand zwischen den beiden schon von Berlin her scharfe Rivalität. Diese Rivalität, nahm Trautwein an, hatte Heilbruns Angriff so bösartig und persönlich gefärbt, und das war es, was den ebenso anständigen wie heftigen Mann bewog, dem andern derart zuzusetzen. »Wir können doch nicht«, erregte er sich, »Wiesener angreifen, weil er sich nicht an Prinzipien hält, die wir selber bekämpfen und verhöhnen. Lassen Sie ihn doch Rassenschande treiben, soviel er will. Nicht daß er das tut, macht ihn zu einem Schuft, sondern die bewußte Verlogenheit seiner politischen Haltung und Methode. Werfen Sie ihm vor, was ihm vorzuwerfen ist, sagen Sie es ihm, so derb Sie wollen: aber Alkovenschnüffelei, das haben wir nicht nötig.«
Jetzt ärgerte sich Heilbrun ernstlich. Er richtete sich vollends hoch, leise ächzend. Stand auf. Groß, gut angezogen, doch in der Haltung etwas verlottert, stand er vor Trautwein, schaute ihn aus den braunen, immer blutunterlaufenen Augen böse an. »Die ›P. N.‹ sind nicht da«, sagte er, »um akademische Untersuchungen anzustellen, was im politischen Kampf erlaubt ist und was nicht. Meine Artikel sollen praktische Folgen haben, sie wollen wirken, zu diesem Zweck hab ich sie geschrieben. Gewiß, es bedeutet nicht viel, wenn Herrn Wieseners Stellung erschüttert wird, aber etwas bedeutet es doch. Ich verstehe nicht, warum wir gerade diesem Wiesener gegenüber so delikat sein sollen. Soll ich mich an vornehme Regeln halten, wenn der andere dauernd unter den Gürtel schlägt? Es ist Ihnen vielleicht nicht unbekannt, lieber Trautwein, daß wir und die Nazi in einem Kampf auf Leben und Tod stehen. Da kann man nicht immer Handschuhe anziehen.«
Er redete sich in immer größere Erbitterung hinein, wurde seinesteils tückisch, ging zum Angriff über. »›Sei nicht allzu weise und nicht allzu gerecht‹«, zitierte er, »›auf daß du nicht verderbest.‹ Es wäre nützlich, lieber Trautwein, wenn Sie diesen guten Spruch besser beherzigen wollten. Auch unterm Strich. Unser entscheidendes Kriterium bei der Prüfung einer Arbeit muß sein: nützt sie unserer Sache oder nicht?«
»Ja, und?« fragte verwundert Trautwein, er wußte durchaus nicht, wo der andere hinauswollte. »Ich spreche natürlich«, erklärte Heilbrun, »von der Emigrantennovelle dieses Harry Meisel, die Sie über den Kopf Ihrer Kollegen hinweg ins Blatt gesetzt haben. Solche Scherze können wir uns nicht leisten.« Er stieß den viereckigen Kopf mit dem eisengrauen Stichelhaar kräftig gegen Trautwein vor, seine Schultern hingen nicht mehr, sie waren gestrafft. »Ich bin gewiß der letzte«, erklärte er, noch großartiger als sonst, »der sich einem jungen Talent entgegenstellte. Ich habe Sie vor Gingold gedeckt, als Sie die Gedichte Ihres Tschernigg brachten. Aber so wie Sie das jetzt machen, geht es nicht weiter. Wenn es sich um eine Sache handelt, die dafür steht, dann nehme ich die Empörung der Leser auf mich. Aber diese Empörung für die short story Ihres Harry Meisel herauszufordern, nein, mein Lieber, da mache ich nicht mit. Dazu ist unsere Situation zu ernst. Die Leser wüten. Wir haben einen Niagara von empörten Zuschriften gekriegt. Und das schlimme ist: die Leute haben recht. Wir können keine Geschichten bringen, in denen Emigranten eine so zweifelhafte Rolle spielen wie in dem Elaborat Ihres Schützlings. Ist es nicht genug, daß die Emigranten von allen Seiten schlechtgemacht werden? Sollen wir noch selber das eigene Nest bekacken? Was Sie da getan haben, geschätzter Herr Trautwein, verstößt gegen die Interessen des Blattes. Ich begreife die Leser. Ich bin auf seiten Gingolds. Ich bin gegen Sie.«
»Das tut mir leid«, krähte streitbar Trautwein, »aber Sie haben mich nicht überzeugt. Wozu haben wir das Blatt, wenn wir nicht die Wahrheit sagen dürfen? Und wenn wir die Wahrheit über uns selber nicht sagen dürfen, wo sollen wir dann den Mut hernehmen, sie über die andern zu sagen, über unsere Gegner? Gerade das, und nur das, gibt uns das Recht, die andern anzugreifen, daß wir die Wahrheit sagen und die andern lügen. Die Leser wüten«, höhnte er, »solche Hornochsen, solche blöden Lackel. Schämen sollten wir uns, für solche Leser zu schreiben. Glauben die Esel vielleicht, daß die Emigration aus lauter Helden und Engeln besteht? Froh sollten sie sein, daß sie einen Dichter unter sich haben wie Harry Meisel.«
»Sie sind es aber nicht«, belehrte Heilbrun seinen Redakteur und war schon wieder mild und sachlich. Er konnte sich nicht helfen, der Mann, wie er so daraufloswetterte, gefiel ihm. Er zog sich also wieder ins Väterliche, Weltweise zurück. »Da wir nun einmal für solche Leser schreiben«, setzte er seinem Mitarbeiter auseinander, »und da wir leider von ihnen abhängig sind, ist es nicht opportun, eine Novelle zu bringen wie die Ihres Meisel. Wahrscheinlich ist sie sogar gut, ich habe sie mir im Ärger nicht genau auf ihre Qualität angeschaut. Aber mit so gefährlichen Sachen sollten Sie in Zukunft vorsichtig sein, auch wenn sie gut sind.« – »Ich hab ja die Geschichte nicht für gefährlich gehalten«, erklärte naiv und fast schon entschuldigend Trautwein. »Man gewöhnt sich furchtbar schwer an den Gedanken, daß es auch auf unserer Seite so viele Dummköpfe gibt.« – »Man muß sich aber daran gewöhnen«, zuckte Heilbrun die Achseln. »Drüben mögen sie neunundneunzig Prozent Dummköpfe haben, wir fünfundneunzig.« Er sank in sich zusammen, wurde wieder der ewig müde Heilbrun. »Die Dinge gehen nicht so, wie sie sollen«, erzählte er Trautwein trüb, vertraulich. »Unser Gingold ist ein etwas rechenhafter Herr, das wissen Sie ja selber. Vielleicht hätte ich mir doch, als ich die ›P. N.‹ machte, einen andern Finanzmann aussuchen sollen. Aber für alles kriegen Sie aus den Menschen leichter Geld heraus als für die Literatur der Besiegten. Herr Gingold hat das Geld für die ›P. N.‹ nicht wegen meiner schönen Augen gegeben und nicht wegen der Wahrheit, sondern wegen der Verzinsung. Er ist ein vorsichtiger Mann, und sowie ein paar Leser rebellieren, kriegt er Eisgang in den Hosen.«
Heilbrun ging mit etwas steifen, schweren Schritten zu seiner Couch und setzte sich umständlich, man sah, daß er sechzig war. »Ich habe es nicht leicht, lieber Trautwein«, sagte er. »Wenn ich könnte, wie ich wollte, ich wäre gern ein bißchen large. Von mir aus könnten Sie für Ihre Tschernigg und Meisel Raum haben, soviel Sie wollen, und Geld, soviel Sie wollen. Aber es geht eben nicht nach mir allein. Wir müssen rechnen. Wenn einmal zwanzig Abonnenten abspringen, dann fängt unser Gingold an mit Heulen und Zähneklappern, und sowie ein bißchen Fett da ist, das man verwerten müßte, um das Blatt besser zu machen, schöpft er es weg. Wir sind verdammt arm, wir müssen sparen. Für jede überflüssige Zeile, und wenn sie noch so gut ist, müssen wir eine notwendige weglassen. Ich möchte Ihren Schützlingen gerne helfen, aber ich kann leider die ›P. N.‹ nicht als eine humanitäre Anstalt führen.« Er legte sich zurück, schloß die Augen, seufzte. »Man wirft mir vor«, sagte er, »ich sei leichtsinnig. Man begeifert mich, weil ich mir ab und zu in einem eleganten Klub eine Nacht um die Ohren schlage. Ich habe verdammt viel zu arbeiten. Darf ich mir niemals Abwechslung gönnen, Aufpulverung? Vielleicht ist das, was wir hier machen, nicht sehr nützlich, aber sicher ist es das Nützlichste, was Emigranten heute machen können. Soll unsereiner, damit er ab und zu einem Schnorrer hundert Franken mehr spendieren kann, puritanisch leben und seine Arbeitskraft schmälern?«
Trautwein sah, wie müde und gereizt Heilbrun war. Er bedauerte ihn, sein Groll war vorbei. Was Heilbrun vor ihm ausgepackt hatte, war, das wußte er, nur ein Teil seiner Sorgen; es gab in seinem Leben noch mehr Trübes. Seine Familienangelegenheiten waren verwickelt. Er lebte die meiste Zeit getrennt von seiner Frau; seine Tochter war in München verheiratet gewesen, mit Doktor Kleinpeter, dem bekannten Internisten, auch da schien es nicht mehr zu klappen, die Tochter konnte nicht mehr in Deutschland bleiben, die Ehe des »arischen« Arztes mit der Jüdin schien in die Brüche zu gehen. Mit Heilbruns Finanzen stand es...
| Erscheint lt. Verlag | 11.1.2013 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Feuchtwanger GW in Einzelbänden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Historische Romane |
| Literatur ► Klassiker / Moderne Klassiker | |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | Deutschland • Emigranten • Emigration • Entführung • Exil • Exilant • Feuchtwanger • Flucht • Flüchtling • Journalismus • Lion Feuchtwanger • Nationalsozialismus • Nazis • Paris • Politik • Presse • Roman • Schlüsselroman • Zeitung |
| ISBN-10 | 3-8412-0618-2 / 3841206182 |
| ISBN-13 | 978-3-8412-0618-3 / 9783841206183 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,1 MB
Digital Rights Management: ohne DRM
Dieses eBook enthält kein DRM oder Kopierschutz. Eine Weitergabe an Dritte ist jedoch rechtlich nicht zulässig, weil Sie beim Kauf nur die Rechte an der persönlichen Nutzung erwerben.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich