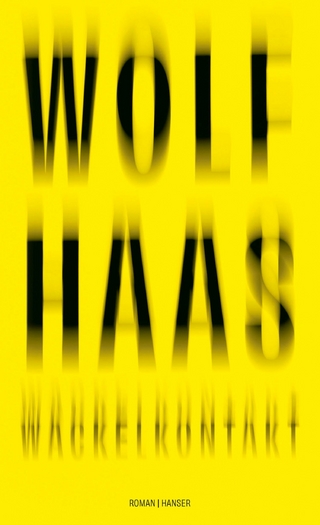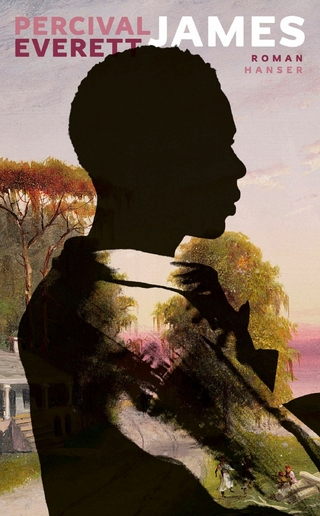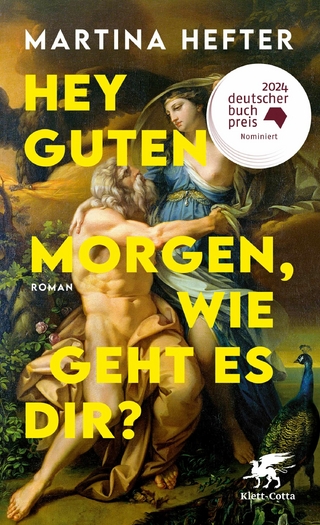Land der Väter und Verräter (eBook)
384 Seiten
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH
978-3-462-30597-5 (ISBN)
Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, lebt seit 1970 in Deutschland. Von ihm sind bisher u.a. erschienen: der Roman »Die Tochter«, die Erzählbände »Sieben Versuche zu lieben«, »Land der Väter und Verräter« und »Bernsteintage«. Seinen Liebesroman »Esra« lobte die FAS als »kompromisslos modernes, in der Zeitgenossenschaft seiner Sprache radikales Buch«. Billers Bücher wurden in neunzehn Sprachen übersetzt. Bereits nach seinem Erstling »Wenn ich einmal reich und tot bin« (1990) wurde er von der Kritik mit Heinrich Böll, Wolfgang Koeppen und Philip Roth verglichen. Zuletzt erschienen sein Memoir »Der gebrauchte Jude« (2009), die Novelle »Im Kopf von Bruno Schulz« (2013) sowie der Roman »Biografie« (2016), den die SZ sein »Opus Magnum« nannte. Sein Bestseller »Sechs Koffer« stand auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2018. Über den Roman »Der falsche Gruß« (2021) schrieb die NZZ: »Das ist große Kunst.«
Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, lebt seit 1970 in Deutschland. Von ihm sind bisher u.a. erschienen: der Roman »Die Tochter«, die Erzählbände »Sieben Versuche zu lieben«, »Land der Väter und Verräter« und »Bernsteintage«. Seinen Liebesroman »Esra« lobte die FAS als »kompromisslos modernes, in der Zeitgenossenschaft seiner Sprache radikales Buch«. Billers Bücher wurden in neunzehn Sprachen übersetzt. Bereits nach seinem Erstling »Wenn ich einmal reich und tot bin« (1990) wurde er von der Kritik mit Heinrich Böll, Wolfgang Koeppen und Philip Roth verglichen. Zuletzt erschienen sein Memoir »Der gebrauchte Jude« (2009), die Novelle »Im Kopf von Bruno Schulz« (2013) sowie der Roman »Biografie« (2016), den die SZ sein »Opus Magnum« nannte. Sein Bestseller »Sechs Koffer« stand auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2018. Über den Roman »Der falsche Gruß« (2021) schrieb die NZZ: »Das ist große Kunst.«
Ein trauriger Sohn für Pollok
1.
Milan Holub hatte das Leben meines Vaters zerstört, und als mir eines Tages ein Verlag sein neues Buch zur Beurteilung schickte, beschloß ich, Rache zu nehmen. Seit ich denken konnte, war ich mit Holubs Namen vertraut, zu Hause wurde über ihn so oft wie über einen Verwandten und so wütend wie über Hitler gesprochen. Darum verband ich von früh an mit ihm, den ich nie getroffen hatte, nur Abscheu und Haß. Er war mein ganz persönlicher Haman und Titus, eine Figur, so groß und allgegenwärtig wie aus einem Geschichtsbuch, und hätte mich je einer gefragt, warum Vater und Mutter und auch ich niemals miteinander glücklich wurden, hätte ich mit meiner Antwort keine Sekunde gezögert. Milan Holub, hätte ich gesagt, Milan Holub, der Philosoph und Schriftsteller, war es, an dem Vater als junger Mann zerbrach. Alles andere, was danach in seinem Leben geschah, war nur noch der dunkle, langanhaltende Epilog zu jener Szene, die sich damals, 1949, in der tschechoslowakischen Botschaft in Moskau abgespielt hatte, als Holub – so wurde es bei uns erzählt – seinen besten Freund, meinen Vater, mit ein paar schnellen, beiläufigen Sätzen um die Zukunft brachte.
Die Szene in der Botschaft habe ich mir von klein auf ganz genau vorgestellt, immer und immer wieder: Ich sah Holub an einem übergroßen, schwarzen Schreibtisch, auf dem kein Blatt Papier, kein Schreibzeug, keine einzige Akte lag. Ich sah einen langen Schatten, der ihn und den Tisch von hinten überzog, so daß einzig die Gestalt meines Vaters von einem schwachen, gräulichen Tageslicht bedeckt war. Ich sah Holub auf einem hohen schwarzen Stuhl, dessen Rückenlehne fast bis zur Decke reichte, ich sah einen Hocker, auf dem mein Vater seine Zeit absaß, und dann sah ich auch, wie Holub plötzlich mit dem Handrücken eine Staubspur von der Tischplatte wischte und das vernichtende Verdikt über seinen Freund sprach. Doch obwohl ich Holubs Foto von ungezählten Buchumschlägen und Zeitungsseiten kannte, obwohl ich mit seinem festen, selbstbewußten mährischen Bauerngesicht genau vertraut war, dachte ich es mir in all den Jahren ganz anders, als eine wabernde, fast durchsichtige Maske, deren Züge ständig wechselten, und so erschien mir der Schriftsteller mal als Feliks Dserschinskij, mal als Reinhard Heydrich, und ab und zu einfach nur als ein wuchtiger, braungefleckter Rottweilerhund.
Holub war, wie Vater auch, Aktivist der ersten Stunde gewesen. Er zog mit der aufgewühlten Menge durch die Straßen Prags, im Putschfebruar 1948, er feierte bei den Maiumzügen tanzend und klatschend den neuen sozialistischen Menschen, er besang in seinen Teplitzer Elegien Stalin und Gottwald, er war Dichter und Volkserzieher und Politkommissar – und tauchte dann, kein halbes Menschenleben später, in zweiter Reihe hinter Forman, Mňačko und Kohout, als einer der Kulturhelden des Prager Frühlings wieder auf, kein Kommunist mehr, aber noch immer von den Freiheitsideen der Linken beseelt. Und nun erst, so schilderte er es selbst in Ich, Böhmen und die Welt, in seiner Autobiographie, deren tschechisches Manuskript ausgerechnet ich zur Begutachtung bekommen hatte – nun erst kamen die besten Jahre seines Lebens, »diese drei, vier herrlichen und befreienden Jahre«, in denen einer wie er erleben durfte, daß das, was ein Intellektueller sich ausdenkt und erträumt, manchmal eben doch bei den einfachen Menschen Sehnsüchte zu wecken vermag. Als dann die Russen einmarschierten, konnte und wollte er deshalb nicht wieder kehrt machen, und so wurde die Charta 77 zu seiner neuen Partei. Er unterschrieb Petitionen, er verfaßte Briefe an Gustav Husák, er schlug sich mit den Männern vom Innenministerium herum und mit den Fragen unwissender westlicher Journalisten, die ihn zu dieser Zeit regelmäßig in seiner Wohnung am Moldauufer, vor diesem schmalen Panoramafenster mit Hradschinblick filmten und fotografierten. Doch schließlich wurde der Druck zu groß, die Geheimpolizisten drehten ihm den Strom ab, das Wasser, sie lasen seine Post und kappten seine Telefonleitungen. Sie saßen Tag und Nacht in ihren kleinen Autos vor seinem Haus, und als eines Abends Holubs Dackel Pepa mit durchgeschnittenem Hals im Türrahmen hing, beschloß der Schriftsteller, das Land zu verlassen.
Es war ein sehr stiller, ergreifender Ton, den Holub in Ich, Böhmen und die Welt wählte, um zu schildern, wie er den toten Dackel entdeckte, »an die Tür genagelt und blutüberströmt wie Jesus«, und wie er ausgerechnet in diesem Moment plötzlich begriff, daß alles umsonst war und daß die Tränen, die er um seinen Dackel vergoß, zugleich die Tränen des Abschieds von der Heimat und somit von seiner ganzen Geschichte waren. »Das Leben, glaube ich, ist eine große Sau«, lautete der letzte Satz des Pepa-Kapitels, ein Satz, den ich nicht mehr vergessen konnte. Aber ich vergaß ebensowenig, daß einer wie Holub immer schon viel zu gewandt und klug gewesen war, um länger als nötig sentimental zu sein, zu egoistisch, um sich vom eigenen Leid ergreifen und zerbrechen zu lassen, so wie Vater es getan hatte.
Im Westen, in seinem dritten Leben, kam Holub schnell wieder auf die Beine, schon bald bezog er am Münchener Prinzregentenplatz eine prachtvolle Wohnung, noch geräumiger und aufwendiger eingerichtet als die in Prag, und so sah man ihn von nun an auf Fotos nicht mehr vor dem düsteren, dunklen Hradschin stehen, er hatte jetzt den Silberturm der Hypo-Bank im Rücken. Er stand da, die Arme über der Brust gekreuzt, den Blick herausfordernd in die Kamera gerichtet, und alles war so, als sei er immer schon auf dieser Terrasse, in dieser Stadt, in diesem Land gewesen, als sei er genau hier, über den Dächern Münchens, auf dem richtigen Fleck.
Ja, es lief wirklich gut für den Philosophen und Schriftsteller Milan Holub, es lief für ihn, um genau zu sein, tausendmal besser als für meine Familie, denn das Exil schien ihn, im Gegensatz zu uns, nur zu befeuern. Seine Bücher kamen in schneller Folge neu heraus, man sah ihn im Fernsehen, seine Essays wurden ins Deutsche übersetzt und erschienen in kleinen, aber angesehenen Literaturzeitschriften, und der Ruf, der seiner angekündigten und immer wieder verschobenen autobiographischen Abrechnung mit dem kommunistischen Jahrhundert voranging, war zwar alles andere als weltumspannend, hallte aber dennoch durch manch eine Rezension eines anderen posthistorischen Buchs. Es schien auf eine beinah unverdächtige Weise nichts dabei zu sein, wie schnell sich Milan Holub in der Fremde zurechtfand, Aufträge, Ehrungen und Freunde flossen ihm ganz automatisch zu, und der Respekt, der ihm entgegengebracht wurde, hatte nicht einmal etwas Verlogenes. Er war »der glücklichste Emigrant aller Zeiten, Thomas Mann und Imelda Marcos vielleicht ausgenommen« – so hatte es Holub selbst in Ich, Böhmen und die Welt formuliert, in seiner autobiographischen Abrechnung mit dem kommunistischen Jahrhundert, die eines Tages dann doch noch fertig geworden war und die ich nun also, als einer der ersten, in meinen Händen hielt.
Das Buch war mir natürlich egal gewesen, es ging mir um etwas ganz anderes, doch die scheinbar aufrichtige, selbstironische Haltung, mit der Holub sein Leben erzählte, zog sogar mich anfangs in ihren Bann. Erst beim zweiten Lesen bemerkte ich erleichtert, daß an dieser Attitüde nichts stimmte, daß Holubs Ehrlichkeit bloß Täuschung war, eine rhetorische Waffe, mit der er jeder möglichen Kritik die Spitze nahm. Einwänden, die gegen ihn, gegen sein früheres Denken und Wirken hätten aufkommen können, begegnete er von vornherein, indem er sie selbst einfach aussprach, und das wurde immer wieder besonders da deutlich, wo er laut, demonstrativ, fast selbstzerstörerisch zugab, einst ein verbrecherischer, pubertärer Dummkopf gewesen zu sein, in jener dunklen Zeit, als er seine »Poeme für Stalin, Gottwald und all die andern Massenmörder« verfaßte. Nein, die Teplitzer Elegien verschwieg Milan Holub nicht, und auch sonst berichtete er von all seinen Vergehen und Irrtümern, die bekannt waren. Was aber 1949 in Moskau, in der dunkelroten Botschaftsvilla an der Malaja Nikitzkaja, zwischen ihm und Vater vorgefallen war, das erwähnte er nicht.
Damals studierten die beiden gemeinsam an der Historischen Fakultät der Lomonossow-Universität. Sie schliefen im Studentenwohnheim in einem Zimmer, sie spielten im Sommer zusammen Fußball und im Winter Eishockey, sie machten denselben Mädchen den Hof, sie lasen dieselben Bücher – manchmal sogar gleichzeitig, indem sie sich kapitelweise abwechselten –, sie belegten dieselben Kurse und verehrten dieselben Professoren, und die kameradschaftliche Konkurrenz, die zwischen ihnen herrschte, war immer nur Ansporn für sie, aber niemals ein Grund für Haß und Intrige. So, jedenfalls, hatte es Vater empfunden, vielleicht sogar zu Recht, doch eines Tages machte er den Fehler, mit Holub, dem Goj, über Stalins Haß auf die Juden zu sprechen. Politik war bis dahin zwischen den beiden kein Thema gewesen, obwohl – oder vielleicht gerade weil – Holub, das Wunderkind, damals kein einfacher Student war, sondern zugleich auch dritter und mit Abstand jüngster Kulturattaché an der Prager Botschaft in Moskau. Es war ein seltsames Gespräch, das sie in der Institutskantine über den großen Stalin führten, Vater redete anfangs ganz leise, während Holub schwieg und schwitzte und mit den Fingern auf die Tischkante klopfte, und als Vater die Stimme hob, plötzlich alle Vorsicht vergessend, stand sein bester Freund stumm auf und lief hinaus. Schon am nächsten Tag schrieb Holub seinen Bericht, und so kam Vater vors Studententribunal, Holub...
| Erscheint lt. Verlag | 6.6.2012 |
|---|---|
| Verlagsort | Köln |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Belletristik • Bernsteintage • Biografie • Der falsche Gruß • Der gebrauchte Jude • Die Tochter • Erzählungen • Esra • Geschichten-Sammlung • Im Kopf von Bruno Schulz • Kaleidoskop • Kiepenheuer & Witsch • Liebesduell • maxim biller • Roman • Wenn ich einmal reich und tot bin |
| ISBN-10 | 3-462-30597-2 / 3462305972 |
| ISBN-13 | 978-3-462-30597-5 / 9783462305975 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich