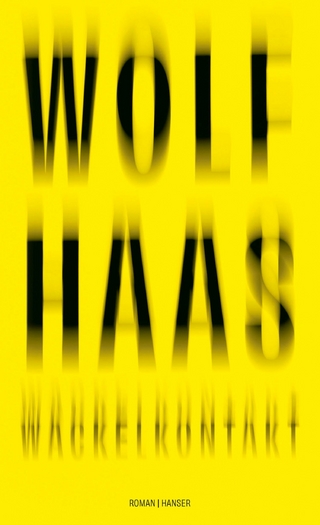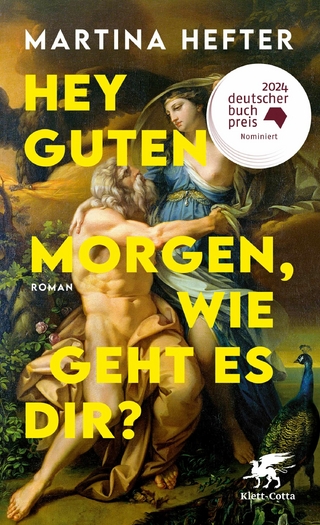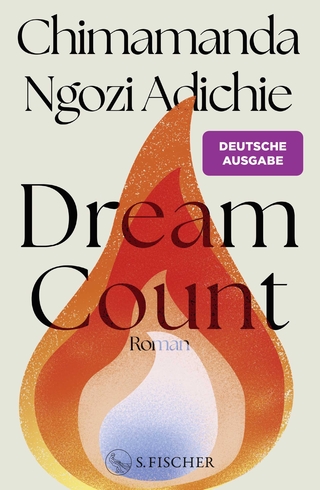Rumgurken (eBook)
224 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-46601-2 (ISBN)
Tex Rubinowitz, geboren 1961 in Hannover, lebt seit 1984 als Witzezeichner, Maler, Musiker und Schriftsteller in Wien. 2014 erhielt er den Bachmann-Preis.
Tex Rubinowitz, geboren 1961 in Hannover, lebt seit 1984 als Witzezeichner, Maler, Musiker und Schriftsteller in Wien. 2014 erhielt er den Bachmann-Preis.
Die Entenmuschelkur
We went up that mountain to see Jesus Christ, which turns out to be quite smaller than either the statue of liberty or the Eiffel tower. Guillermo got an awful toothache, and drank two enormous glasses full of whiskey in the restaurant, as a sort of anaesthetic. He said it didn’t do anything for the pain, just turned him into a drunk with a toothache.
Donald Baechler
Es ist Februar, ich bin krank. Eine schwere Lungenentzündung hat mich in ihrem gichtigen Würgegriff, ich huste mich um den Verstand. Meine an und für sich granitene Kehle ist so wund, dass das, was sie da so regelmäßig produziert und auswirft, ein kompaktes Quantum bronchialen Eiters darstellt, würfelförmig fast, ich warte auf Blut, hätte dann eigentlich jetzt mal langsam kommen können, dass das auch erledigt wäre. Die verquollene, eiskalte Denkniere ist dicht, komplett zu, ich höre dumpf, das Auge, über das sich zum Schutz die Nickhaut geschoben hat, gebrochen, Schwitzen und Frösteln lösen sich in Wellen ab, Glieder geschwollen, Gelenke versulzt, kochend heiße Füße, triefäugig, kurzatmig, rasselnd, hängetittrig, truthahnhalsig, schludrig, trostverlassen, alles kommt zusammen. Ich bin der Schatten eines Wracks im Zwielicht meines eigenen Mitleids, oder so ähnlich, niemand hilft mir, nichts geht mehr, ich bin alleine, fünfzig Jahre, nichts geleistet, hier kommt deine Strafe, Kafka kam nur bis Kierling, ich buche einen Flug nach Porto.
Ich besinne mich für meine letzte Stunde auf diese Stadt, weil ich hier zum ersten Mal ankam. Der Ring schließt sich («Ringen sluttet», Knut Hamsun), hier am Rande Europas fühlte ich mich zum ersten Mal wohl. Wie sang einst der große Genesis P. Orridge: «When all the numbers swim together and all the shadows settle», und jetzt sollte der gehetzte Schatten einer niedrigen Nummer hier endlich Ruhe finden. Porto befriedigte offenbar bestimmte Bedürfnisse, aber wodurch, wusste ich damals nicht, und ich weiß es bis heute nicht genau, irgendein okkultes Zusammenspiel von rätselhaften Sinneseindrücken und einer improvisierten Ordnung in aller Kaputtheit (die DDR löste das bei mir übrigens auch immer aus). Das gekachelte Land, immer wieder schmiege ich mich an die kühlende, trostspendende Fliese.
Dabei kenne ich Portugal, das restliche Land, überhaupt nicht, ich weiß nicht einmal, ob Lissabon überhaupt existiert. O.k., die Azoren kenne ich, sogar gut, na ja, zumindest vier von neun Inseln. Auf den Azoren habe ich sogar ein Konto eröffnet, Banco Comercial dos Açores, auf das ich immer wieder Geld transferiere, vom meinem anderen Konto, jenem auf den Åland-Inseln, Ålandsbanken, oder von diesem auf die Azoren, wo ich halt gerade bin, kleine Summen natürlich, und das auch nur, weil ich mir während des Überweisungsvorgangs eine selten benutzte Pipeline vorstelle, durch die das Sümmchen tröpfelt, dieser kaum beachtete Transfermuskel, einer muss ihn doch in Bewegung halten, dass ich also einer der wenigen bin, wenn nicht gar der Einzige, der dieses Nebengeleis überhaupt noch befährt (Mitleid mit Dingen).
Mit sechzehn war ich zum ersten Mal in Porto. Ich kaufte mir natürlich gleich eine Flasche Portwein meines Jahrgangs, diese schönen schwarzen Flaschen mit den groben, mit Schablonen aufgemalten Basisinformationen, PORTO 1961, macht das nicht jeder? Bei mir kam noch dazu, dass ich sechzehn Jahre nach Kriegsende geboren wurde, und 16 von hinten ist 61, das musste gefeiert werden. Ich leerte die schöne Flasche auf einen Sitz, dieser warme, süße Wein, spürte dann eigentlich gar nichts, bekam lediglich Sodbrennen und belegte Ohren. Vielleicht war’s ja alkoholfreier Wein, das glaube ich aber nicht, all die alkoholfreien Irrtümer wurden erst Jahre später gemacht.
Porto, eine verrottete, kariöse Stadt, in der die Möwen das urbane Gefüge prägen, und die Tauben den weit entfernten Strand. Die Möwen haben sie verdrängt, rausgeschmissen, eine Stadt, die offenbar nur noch von Katzenpisse zusammengehalten wird, jedes zweite Haus eine Ruine, in denen kranke Katzen nisten und nasses Brot fressen, sie haben nichts zu tun, außer zu resignieren. Wenn also nicht Schimmel und Katzen wären, würde das hier bald alles zusammenbrechen wie ein Kartenhaus, diese Stadt korrodiert, genau wie ich, passt ja. Es ist auch immer besser, in der Fremde krank zu sein, ein Unsichtbarer, in vertrauter Umgebung muss man sich dauernd rechtfertigen und falsches Mitgefühl erdulden, «Was, schon wieder krank?», «Ich dachte, du wirst nie krank?». Krankheit ist peinlich, so ist das nun mal, jeder siecht für sich allein.
Einmal am Morgen macht mich meine Qual in meinem schweißnassen Faulbett dann doch lachen, so schlimm kann es wohl dann doch nicht sein: Ich wache auf, ich muss niesen und gleichzeitig husten, und als ich den Mund aufmache, will sich auch noch ein Gähnen dazwischendrängen, sei es aus parasitären Gründen oder solchen der Effizienz.
Immer rufen mich meine portugiesischen Freunde an oder schicken Durchhalteparolen auf mein kleines Nokiatelefon. Paulo, ein Maracujabauer und ehemaliger Mosambiksöldner, fragt, ob’s mir gutginge, ob ich nicht mal vorbeikommen möge, ob ich etwas brauche, aber ich krächze kaum glaubhaft, ich sei auf dem Weg der Besserung. In Wirklichkeit verschlimmert sich mein Zustand, die Nässe kriecht mir in die Knochen, ins Gebälk, draußen regnet es sauer seit Tagen, ich fühle mich wie ein von seinem Schutzbefohlenen verlassenes Kind. Die verfluchte Kälte versucht zum Reaktorkern vorzudringen, ich liege da wie eine Sporttasche voller nasser Handtücher in einem Tunnel, dessen Ausgang zugemauert ist, ich bin so schwach, dass mir nur noch verblödete Metaphern einfallen.
Meine Hauptsorge gilt den Knien, die Knie sind immer so kalt, man muss die Knie wärmen, bei mir geht sehr viel über diese Organe, sie sind empfindlich wie Fühler. Als Walter Kempowski in seiner achtjährigen Zuchthauszeit einmal bestraft wurde, indem man ihn nackt in eine kahle Betonzelle setzte und mit kaltem Wasser übergoss, gab ein mitfühlender Aufseher (Russe) dem Schlotternden den Rat, seine Knie anzuhauchen, weil er wohl auch von der Leichtleitfähigkeit dieser Knorpelsensoren wusste. Deshalb bestelle ich mir hier, in der klammen Stadt, immer zwei Kaffees gleichzeitig und stelle sie mir auf die Knie. Manchmal schleppe ich mich auch fiebrig aus der muffigen Stube runter ins Restaurant Portista Marisqueira, gegenüber der phantastischen Parkhaustorte im brutalistischen Stil (dem Silo Auto), die aussieht wie das Guggenheimmuseum in New York. Das Wirtshaus ist so schön, dass man das Innere streicheln möchte, draußen leuchtet die Galp-Tankstelle orange, überhaupt geht nachts ein orangenes Glosen von dieser Stadt aus, man sieht es gut, wenn man sie von oben betrachtet, beispielsweise aus der umwerfenden Bar im siebzehnten Stock des Hotels Dom Henrique, direkt neben dem Autosilo. Da sieht man dann und wann geordnet ungeordnet Wolken orangener Pünktchen aufstieben, als seien es Funken, es sind aber nur von unten orange angestrahlte Taubenschwärme bei ihrer letzten Vergnügungstour des Abends, denn nachts tauschen sie ihr Revier wieder mit den Möwen, die sich zur Bettruhe an den Strand verziehen.
Das Glosen kommt natürlich vom fauligen Atem der Häuser, nachts, so kennt man’s, wenn man’s kennt, aus dem Hochmoor bei Worpswede, grün glimmende Irrwische, Faulgase sind das, hier ist das, was die Stadt aushaucht, eben orange.
Ich würge in der Portista Marisqueria ein frugales Mahl herunter, zwei Bolos de Bacalhau, frittierte Kugeln aus Stockfischabfällen und Kartoffelbrei, spüle mit Portwein nach, mir schmeckt das. Dabei beobachte ich Berto, den geistig behinderten Parkplatzeinweiser vorm großen Fenster, eine echte Hilfe ist er nicht, die Leute geben ihm Geld, damit er nichts tut, ab und zu kommt er rein und trinkt ein großes Glas warme Milch. Die Gegend hier ist absolut phantastisch, der schönste Teil Portos, fraglos, nebenan die Confeitaria Cunha, die so aussieht und in der man sich so behaglich fühlt wie in einer Bar im Weltraum. Ich würde diese Gegend ein retrofuturistisches Kleintokio nennen. Es gibt diese rätselhafte Autobahnspange (hinter der Metrostation Trindade, einem Meisterwerk von Souto de Moura), sie soll eine Kreuzung entlasten. Staus an der Kreuzung gibt es aber nach wie vor, man kann also beides benutzen, entlastet wird gar nichts. Die Spange steht auf Stelzen, so wie die vielen herrlichen, übereinandergeschichteten Kettenglieder Tokios, Autobahnen und Kanäle, überhaupt das Japanische an Portugal, oder umgekehrt, es ist ja nicht nur das Danke, das die Portugiesen den Japanern überlassen haben (Obrigado/Arigato), und dass sie ihnen beigebracht haben, wie man Tempura macht, kannten sie ja alles nicht. Knöpfe auch nicht, die kamen auch von den Portugiesen, und außerdem verbindet beide Nationen das ständige Lachen, Keckern eher, selbst bei Tragödien, wie den aktuellen in beiden Ländern, Finanzkollaps, Nuklearkatastrophe, aber es ist kein Lachen, wie wir es verstehen, wenn man uns kitzelt oder wenn wir einen Hund mit drei Beinen sehen, sondern eine soziale Technik, um mit ausweglosen Situationen fertigzuwerden. Und wenn das Portugiesische gesprochen klingt, als würde ein halskranker Holländer versuchen, Russisch zu gurgeln, all diese Nasallaute, so klingt es gesungen wie Japanisch. Man höre sich nur mal die Schnulzen von Amália Rodrigues an, während die sie begleitende Gitarre überraschenderweise wie eine Anton-Karas-Zither scheppert, genau die Musik dudelt übrigens gerade in der Portista Marisqueria, während ich schwach am Tresen hänge, aber vielleicht ist hier...
| Erscheint lt. Verlag | 1.6.2012 |
|---|---|
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Bachmann Preis • Bachmann-Preis 2014 • Ingeborg Bachmann Preis • Reiseberichte • Reisen |
| ISBN-10 | 3-644-46601-7 / 3644466017 |
| ISBN-13 | 978-3-644-46601-2 / 9783644466012 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 645 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich