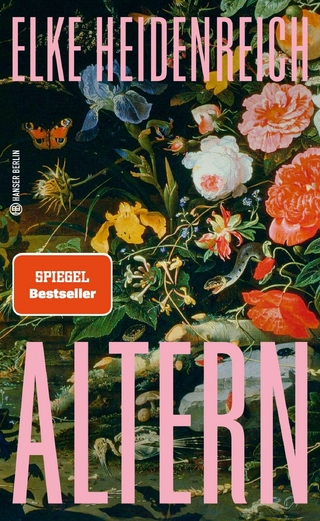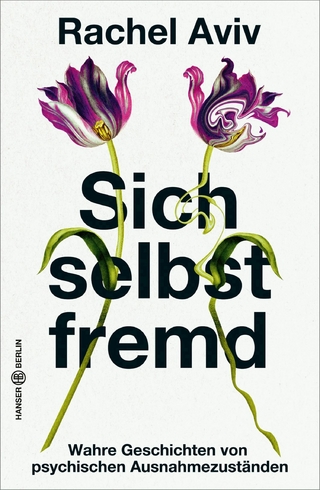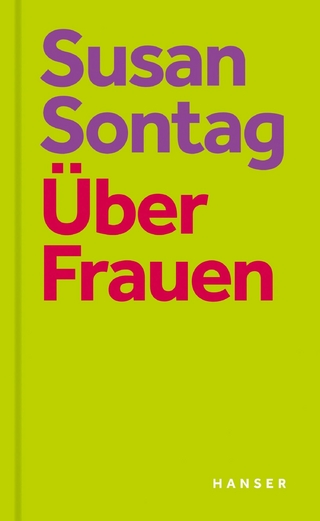Portraits (eBook)
320 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-401820-1 (ISBN)
Gerhard Roth, geboren 1942 in Graz und gestorben im Februar 2022, war einer der wichtigsten österreichischen Autoren. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, Erzählungen, Essays und Theaterstücke, darunter den 1991 abgeschlossenen siebenbändigen Zyklus »Die Archive des Schweigens« und den nachfolgenden Zyklus »Orkus«. Zuletzt erschienen die drei Venedig-Romane »Die Irrfahrt des Michael Aldrian«, »Die Hölle ist leer - die Teufel sind alle hier« und »Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe«. Sein nun letzter Roman »Die Imker« ist im Mai 2022 erschienen. Literaturpreise (Auswahl): Preis der »SWF-Bestenliste« Alfred-Döblin-Preis Marie-Luise-Kaschnitz-Preis Preis des Österreichischen Buchhandels Bruno-Kreisky-Preis 2003 Großes Goldenes Ehrenzeichen der Stadt Wien 2003 Jakob-Wassermann-Preis 2012 Jeanette-Schocken-Preis 2015 Jean-Paul-Preis 2015 Großer Österreichischer Staatspreis 2016 Hoffmann-von-Fallersleben-Preis 2016
Gerhard Roth, geboren 1942 in Graz und gestorben im Februar 2022, war einer der wichtigsten österreichischen Autoren. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, Erzählungen, Essays und Theaterstücke, darunter den 1991 abgeschlossenen siebenbändigen Zyklus »Die Archive des Schweigens« und den nachfolgenden Zyklus »Orkus«. Zuletzt erschienen die drei Venedig-Romane »Die Irrfahrt des Michael Aldrian«, »Die Hölle ist leer – die Teufel sind alle hier« und »Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe«. Sein nun letzter Roman »Die Imker« ist im Mai 2022 erschienen. Literaturpreise (Auswahl): Preis der »SWF-Bestenliste« Alfred-Döblin-Preis Marie-Luise-Kaschnitz-Preis Preis des Österreichischen Buchhandels Bruno-Kreisky-Preis 2003 Großes Goldenes Ehrenzeichen der Stadt Wien 2003 Jakob-Wassermann-Preis 2012 Jeanette-Schocken-Preis 2015 Jean-Paul-Preis 2015 Großer Österreichischer Staatspreis 2016 Hoffmann-von-Fallersleben-Preis 2016
Vincent van Gogh
Geheimnisse und Wahrheiten
Vincent van Gogh: Der Innenhof des Hospitals von Arles, 1889. Öl auf Leinwand, 73 × 92 cm. Sammlung Oskar Reinhart »Am Römerholz«, Winterthur
Ich war 21 Jahre alt und studierte im vierten Semester an der Grazer Universität Medizin, als ich mir die in gelbes, grobes Leinen gebundene Ausgabe einer Auswahl von Briefen Vincent van Goghs an seinen Bruder Theo kaufte, die vom Langen Müller Verlag gerade herausgebracht worden war. Ich nahm sofort den zweiten Band aus dem Schuber und begann mit dem Abschnitt »Arles 1888–1889«, denn zuallererst wollte ich die Briefe, in denen van Gogh vom Warten auf Paul Gauguin berichtet, lesen, von seinen Vorfreuden und Vorbereitungen auf die Ankunft des Malerfreundes, den Schwierigkeiten des darauffolgenden Zusammenlebens und schließlich der Selbstverletzung van Goghs, dem legendären »abgeschnittenen Ohr«.
Ich hatte 1957, im Alter von fünfzehn Jahren, schon Vincente Minellis berühmten Film »Lust for Life« mit Kirk Douglas in der Rolle van Goghs und Anthony Quinn als Gauguin gesehen, und die dort gezeigten Gemälde, das Leben und der Freitod des genialen Künstlers waren mir seither nicht mehr aus dem Kopf gegangen.
Ich las die Briefe van Goghs als Tagebuchaufzeichnungen, und ich bewunderte den klaren und farbigen Stil, in dem sie abgefasst waren. Hatte man den Maler nicht für einen Wahnsinnigen gehalten? Nirgendwo entdeckte ich jedoch die Diktion eines Verrückten, in jeder Zeile fand sich nur die eines äußerst begeisterungs- und verzweiflungsfähigen Künstlers, eines Analytikers und Sichhingebenden, eines Sehenden und Sehers, eines ebenso erhellten wie verdunkelten Geistes. Heute noch erinnere ich mich daran, wie sehr mich die farbigen und schwarz-weißen Abbildungen beeindruckten, mit denen die beiden Briefbände reichlich ausgestattet waren, welche die Gedanken und Beschreibungen in van Goghs Briefen als eine Einheit erkennen ließen. Die Bilder, fiel mir auf, waren wie Erzählungen und die Briefe wie Bilder.
Auch die Gemälde »Der Krankensaal des Hospitals von Arles« und »Der Innenhof des Hospitals von Arles« waren abgebildet, allerdings nur in Schwarz-Weiß. Da ich mich, weil ich soeben den zweiten Sezierkurs abgeschlossen und auch ein zweites Mal an einer Gehirnsektion teilgenommen hatte, besonders für Krankheit und Tod interessierte und ich außerdem am Anfang meiner Studienzeit infolge eines Herzstillstandes – einer sogenannten Synkope – beinahe ums Leben gekommen wäre und einen Monat im Krankenhaus hatte behandelt werden müssen, verweilte ich lange bei diesen beiden Bildern und überlegte mir ernsthaft, wie ich wieder krank werden könnte, um die Briefbände frei von Prüfungsdruck und ungestört lesen zu können. Ich war mir darüber im Klaren, dass ich ein Rätsel entdeckt hatte. Ich fasste ja damals alle großen Künstler und Wissenschaftler intuitiv als Rätsel auf: James Joyce und Franz Kafka, Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart, Leonardo da Vinci und Pablo Picasso oder Sigmund Freud und Albert Einstein. Sie verkörperten für mich mit ihrem Werk und ihren Biographien das Rätsel des Lebens überhaupt. Die Briefe und Bilder der beiden Bände führten mich zugleich in mich selbst und weit weg von mir. Immer wieder blätterte ich zu den Abbildungen nach vor oder zurück, und als ich zu van Goghs Verzweiflungstat, dem »abgeschnittenen« Ohr, kam, stieß ich auf das im September 1888 gemalte Bild »Das Nachtcafé«, von dem ich inzwischen zwei Fassungen kenne, die sich vor allem durch die Darstellung des Lichtes der Gaslampen unterscheiden. Sofort fasste ich diese Gemälde als Schlüsselbilder für den überreizten Geisteszustand und die Erschöpfung des Künstlers auf, die die spätere Selbstverletzung mitverursacht haben.
»In meinem Bild vom Nachtcafé habe ich auszudrücken versucht«, schrieb van Gogh, »dass das Café ein Ort sein kann, wo man sich ruinieren, wo man verrückt werden und Verbrechen begehen kann«, und in einem weiteren Brief an Theo machte er die merkwürdige Feststellung: »Manchmal kommt es mir vor, als sei die Nacht viel lebendiger und farbstärker als der Tag«, und: »Ich habe versucht, mit Rot und Grün die schrecklichen menschlichen Leidenschaften auszudrücken. Der Raum ist blutrot und mattgelb, ein grünes Billard in der Mitte, vier zitronengelbe Lampen. Überall ist Kampf und Antithese in den verschiedensten Grüns und Rots, in den kleinen Figuren der schlafenden Nachtbummler, in dem leeren, trübseligen Raum, im Violett und Blau. Das Blutrot und Gelbgrün des Billards kontrastiert mit dem zarten Louis-XV.-Grün der Theke, auf der ein rosa Blumenstrauß steht. Die weiße Kleidung des Wirts, der in einer Ecke des Backofens wacht, wird zitronengelb, blassgrün und leuchtend.«
Zwanzig Jahre später, 1989, habe ich dieses Gemälde für das ZEIT-Museum der 100 Bilder« beschrieben: »Die Lampen hängen als Gestirne in diesem roten Universum«, hielt ich fest, »in dem sich die Gleichgültigkeit der Schöpfung reproduziert. Das Zimmer ist Bühne und All. Der Billardtisch steht massiv in der Mitte des Raumes, als unverrückbares Schicksal, tragisch und unbeteiligt wie ein Seziertisch in einem gerichtsmedizinischen Institut. Dahinter der gelangweilte ›Gehilfe‹ in Weiß.« Ich war offensichtlich noch immer beeinflusst von meinen Erfahrungen in der Grazer Anatomie und erinnerte mich, ohne dass es mir bewusst war, an die Zeit, als ich die beiden Bände mit Briefen gekauft hatte. In meinem kurzen Essay bezeichnete ich van Gogh als Philosophen der Verzweiflung. »In seinen Bildern kommt das Ungewöhnliche im Allergewöhnlichsten zum Vorschein«, schrieb ich weiter. »Der Vorhang des üblichen Sinns ist zur Seite gezogen, und die Dinge stehen ohne sprachliche Bezeichnung da – überdeutlich erkennen wir die ungelösten Rätsel, die wir uns als alltagsphilosophische Voyeure vergeblich zu lösen bemühen.« Und: Van Gogh berühre den Kern der Dinge, dabei gelinge es ihm über den Weg des Bildes, eine Möglichkeit des religiösen Philosophierens zu finden. Alles in van Goghs später Malerei sei okkult und realistisch zugleich: die Schwertlilien ebenso wie die Tapetenmuster, zwei Stühle, ein Bett, der Gang des Irrenhauses in Saint-Rémy, es gebe für ihn keine tote Materie. Die Farben seien gleichsam Klopfgeister der Objekte, van Gogh könne diese hören. Zuletzt resümierte ich, dass unsere Zeit misstrauisch geworden sei gegenüber Geheimnissen. Ich schrieb das aus der Erfahrung heraus, die ich nach dem Abbruch meines Medizinstudiums im Grazer Rechenzentrum gemacht hatte, wo ich fast zehn Jahre lang Leiter der Organisationsabteilung gewesen war.
Erst kürzlich äußerte der österreichische Dirigent Nikolaus Harnoncourt in einem Interview ähnliche Gedanken. »Die Welt ist im Moment«, sagte er, »von der scheinbar rationalen Seite so besessen, dass, außer Habgier, überhaupt nichts mehr zählt. Die Logik kennt keine Moral. Wenn die Menschheit nur auf die Ratio vertraut, werden wir zu lauter Wölfen und Bestien werden.« Und weiter: »Die Aufgabe der Kunst ist unsagbar wichtig, aber geheimnisvoll und nicht zu definieren. Legt man sie auf eine Aufgabe fest, wird sie schon wieder einem Zweck zugeführt und pervertiert.« – »Wir leben in einer nur scheinbar entdeckten Welt«, beendete ich meinen Kommentar zu dem Bild. »Van Gogh spürte nachtwandlerisch noch im Profansten und Banalsten das Lost Paradise auf. Er öffnete den Blick auf eine neue Dimension: die magische Daseinserfahrung, die mit der Verzweiflung verbunden ist und uns die Welt aus einer visionären Perspektive zeigt – wenn diese Verzweiflung uns nicht wie ein Moloch verschlingt.« – Der Kunsthistoriker Roland Dorn hat herausgefunden, dass van Gogh, in Analogie zu den Romanzyklen Balzacs oder Zolas, unter dem Begriff »décoration« Bildpaare und Reihen entwickelte, in denen er selbständige Werke zueinander in Beziehung treten ließ. »Neben den vor allem in den Bildnissen geknöpften farblichen Beziehungen waren die ausnahmslos im selben Format gehaltenen Werke auch durch Form- und Motivkontraste miteinander verbunden. Dazu gehörten einfache Gegenüberstellungen wie nah und fern, innen und außen, offen und geschlossen, alt und neu, Tag und Nacht, öffentlich und privat.« Dorn sieht ein solches Bildpaar zum Beispiel im »Nachtcafé« und in »Vincents Schlafzimmer« ebenso wie im »Krankensaal des Hospitals von Arles« und dessen Gegenstück, dem »Innenhof«.
Das Pendant zum beschriebenen Nachtcafé – das Schlafzimmer des Künstlers im Gelben Haus vom Oktober 1888 – löst in mir jedes Mal, wenn ich es anschaue, unterdrückte Sehnsüchte nach dem Landleben aus, denn es verheißt eine langsamer vergehende Zeit. Während im »Nachtcafé« an die Rückwand eine schwarze Uhr gemalt ist, hängt im »Schlafzimmer« neben dem grünen Fenster lediglich ein schwarzgerahmter Spiegel, in dem man statt der Kreisbewegung der Zeiger sich selbst sehen könnte. »Diesmal«, schrieb Vincent an seinen Bruder Theo, »ist es ganz einfach mein Schlafzimmer, hier muss es mir die Farbe machen; indem ich durch Vereinfachung den Dingen einen größeren Stil gebe, soll einem der Gedanke an Ruhe oder ganz allgemein an Schlaf kommen. Kurz, der Anblick des Bildes soll den Kopf oder richtiger die Phantasie beruhigen. Die Wände sind blassviolett. Das Holz des Bettes und die Stühle sind frisches Buttergelb, das Laken und die Kopfkissen sehr helles Zitronengrün. Die Bettdecke ist scharlachrot. Der Waschtisch orange,...
| Erscheint lt. Verlag | 23.5.2012 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Schlagworte | André Heller • August Walla • Biographie • Bruno Gironcoli • Bruno Kreisky • Elias Canetti • Erinnerung • Essay • Essays • Eugène Ionesco • Franz Fuchs • Franz Gsellmann • Günter Brus • Ivan Osim • Max Frisch • Porträt • Simon Wiesenthal • Tennessee Williams • Thomas Bernhard • Vincent van Gogh • Wolfgang Bauer |
| ISBN-10 | 3-10-401820-0 / 3104018200 |
| ISBN-13 | 978-3-10-401820-1 / 9783104018201 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich