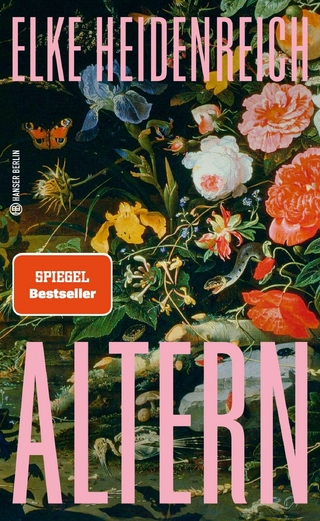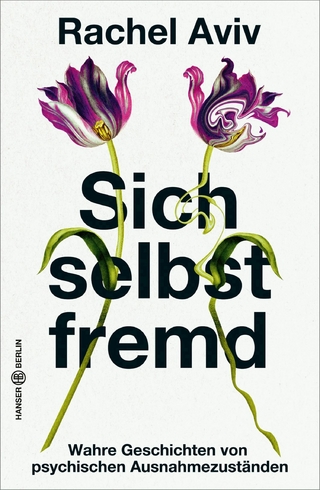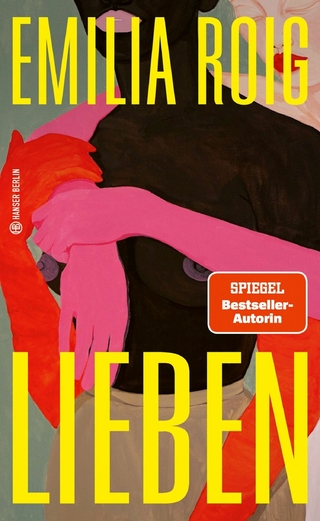Rede, daß ich dich sehe (eBook)
208 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-78370-2 (ISBN)
<p>Christa Wolf, geboren 1929 in Landsberg/Warthe (Gorzów Wielkopolski), lebte in Berlin und Woserin, Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Werk wurde mit zahlreichen Preisen, darunter dem Georg-Büchner-Preis, dem Thomas-Mann-Preis und dem Uwe-Johnson-Preis, ausgezeichnet. Sie verstarb am 1. Dezember 2011 in Berlin.</p>
Cover 1
Titel 4
Impressum 5
Rede, daß ich dich sehe 6
Inhalt 8
1. 12
Zeitschichten 14
Zu Thomas Mann 14
Begegnungen mit Uwe Johnson 27
C Gespräch im Hause Wolf über den in Vers und Prosa G sowohl als auch stückweis anwesenden Volker Braun 38
Autobiographisch schreiben 43
Zu Günter Grass' Beim Häuten der Zwiebel 43
Der Tod als Gegenüber 48
Zu Überlebnis von Ulla Berkéwicz 48
2. 56
Rede, daß wir dich sehen 58
Versuch zu dem gegebenen Thema »Reden ist Führung« 58
Nachdenken über den blinden Fleck 73
3. 98
Mit Realitäten umgehen, auch wenn sie einem nicht gefallen 100
Egon Bahr zum achtzigsten Geburtstag 100
Ein besonderes, unvergeßliches Licht 106
Paul Parin zum neunzigsten Geburtstag 106
Zu Rummelplatz von Werner Bräunig 109
»Jetzt mußt du sprechen« 111
Zum 11. Plenum der SED 111
In Zürich und Berlin 118
Zum fünfundsiebzigsten Geburtstag von Adolf Muschg 118
O Dichtung, herrlich, streng und sanft 121
Begegnungen mit Spanien und seiner Literatur 121
Kuckucksrufe 126
Kleine Rede zu einem günstigen Augenblick 126
4. 130
An Carlfriedrich Claus erinnern 132
Ein Ring für Nuria Quevedo 135
Angela Hampels Gestalten im Spannungsfeld 141
Entwürfe in Farbe - Radierungen der Helga Schröder 144
Köpfe - Ein Gespräch mit Martin Hoffmann 148
Zwiegespräch mit Bildern von Ruth Tesmar 154
Günther Ueckers Bilder aus Asche 157
5. 160
»Wir haben die Mephisto-Frage nicht einmal gestellt« 162
Gespräch mit Arno Widmann 162
»Bei mir dauert alles sehr lange« 174
Gespräch mit Hanns-Bruno Kammertöns und Stephan Lebert 174
»Wir haben dieses Land geliebt« 189
Gespräch mit Susanne Beyer und Volker Hage 189
»Bücher helfen uns auch nicht weiter« 200
Gespräch mit Evelyn Finger 200
Textnachweise 206
Bildnachweis 209
Begegnungen mit Uwe Johnson
?
Ich stelle mir vor, Uwe Johnson, der Mann, an den wir heute hier erinnern wollen, wäre unter uns. Er säße zum Beispiel, wie es ihm zukäme, in der ersten Reihe unserer Versammlung und wunderte sich, daß jemand und wer in seinem Namen einen Preis bekommen soll. Das wäre doch möglich. Das wäre doch normal, er war ja fünf Jahre jünger als ich, er könnte doch leben. Es müssen besondere Begleitumstände gewesen sein, die ihn mit knapp fünfzig Jahren sterben ließen.
Ich versuche, vorsichtig, einige dieser Umstände anzudeuten, indem ich schildere, wie ich ihn erlebt habe.
Soll ich sein Leben tragisch nennen? Ich halte das Wort zurück. Eine Versuchung, es zu verwenden, geht von dem Land aus, in dem wir uns befinden, in dem manche von uns leben, in dem er nicht bleiben konnte und nach dem er sich immer gesehnt hat. Mecklenburg. Es war Johnsons Land. »Aber wohin ich in Wahrheit gehöre, das ist die dicht umwaldete Seenplatte Mecklenburgs von Plau bis Templin, entlang der Elde und der Havel …« Ich glaube, es gab zu seinen Lebzeiten kaum einen Menschen, der umfassender und genauer über Mecklenburg Bescheid wußte als er. Es gibt ein Verzeichnis der mecklenburgischen Orte, die in seinen Büchern, insbesondere in den Jahrestagen, vorkommen: Es sind über hundert. Sechshundert Bücher über Mecklenburg fanden sich in seiner Bibliothek.
Auf Johnsons letzter Reise durch Mecklenburg, von der noch die Rede sein wird, berührt er auch Neubrandenburg, und natürlich Güstrow – jene Stadt, in der er sieben Jahre gelebt hat, in der er auf die John-Brinckman-Schule gegangen ist, vor der heute seine von Wieland Förster geschaffene Stele steht. Ich war dabei, als sie enthüllt wurde, ich sah sie zuerst von schräg hinten und fand, der Bildhauer hatte die Haltung des Rückens gut getroffen, der sich, etwas gebückt, vom Betrachter wegbewegt. Und ich war mir bewußt, daß dieser Schriftsteller nun – als Denkmal – zurückgekehrt war in jene Stadt, die er, zusammen mit Grevesmühlen, zu seinem fiktiven Ort Gneez verwandelt hat, der für die Personen seiner Jahrestage, in der Mehrzahl Mecklenburger, eine so große Rolle spielt.
Ich streiche auf seiner Mecklenburger Liste die Namen der Orte an, in denen auch ich gewesen bin, ich komme auf knapp dreißig. Wie er sind wir ja im Frühjahr 1945 als Flüchtlinge in dieses Land gekommen, weiter westlich allerdings. Später kam dieser Teil Mecklenburgs mir aus den Augen. Heute biegen wir, aus Berlin kommend, bei der Abfahrt Malchow von der Autobahn ab – ein Ort, in dem Heinrich Cresspahl gelebt hat, den wir aber rechts liegen lassen, um in Richtung Sternberg über Goldberg und Dobbertin zu unserem kleinen Dorf am Rande der Mecklenburgischen Seenplatte zu fahren. Mancherorts hätten wir, Johnson und ich, uns damals begegnen können. Die Zeitverschiebung in unserem Leben hat das verhindert. Sie hat auch verhindert, daß wir in den gleichen Jahren im Hörsaal 40 an der Leipziger Universität die Vorlesungen von Hans Mayer hörten – jenem Professor, der das außergewöhnliche Talent seines Studenten Johnson erkannte und ihn ideell und materiell förderte.
Verfehlt haben wir uns auch, als Johnson im August 1982 zum letzten Mal in Güstrow war, als ein »Mr. Johnson«, Mitglied einer englischen Reisegruppe. Ein, zwei Jahre später begannen wir, nicht mehr als zwanzig Kilometer südlich von Güstrow, unsere Sommer in einem alten mecklenburgischen Pfarrhaus zu verbringen. Wie oft sind wir seitdem in Güstrow gewesen, haben Freunde von der Bahn abgeholt, haben ihnen die Stadt gezeigt, mit ihnen vor den Barlach-Skulpturen gestanden, den Schwebenden Engel im Dom besucht. Wie oft habe ich dabei an Uwe Johnson gedacht. Da war er schon tot. Da war er 1984 in einem entfernten Ort an der englischen Themsemündung gestorben. Sein Herz hatte »versagt«. Es war ihm zuviel zugemutet worden.
Als unser erstes Mecklenburger Haus abgebrannt war, hat Uwe Johnson mir eine Karte geschrieben: »Ich höre, Ihr Haus ist abgebrannt, kann ich etwas für Sie tun?« Wir kannten uns. Zum ersten Mal hatten wir uns im Februar 1974 getroffen. Wir wohnten damals in Kleinmachnow, ein Ort zwischen Berlin und Potsdam. Plötzlich war eine Stimme am Telefon, die ich merkwürdigerweise erkannte. Ob es uns recht wäre, wenn er uns besuchen käme. Er hatte natürlich schon die Ankunftszeiten der Züge auf dem Bahnhof Schönefeld recherchiert, dort mußten wir ihn abholen, weil er, soweit ich mich erinnere, keine Sondergenehmigung für das Umfeld von Berlin hatte, die er als Westberliner gebraucht hätte. Es gab also umständliche und peinlich genaue Verabredungen, wann mein Mann ihn in Schönefeld treffen würde. Er, Johnson, war dann doch eine Stunde zu früh dagewesen, enttäuscht. Er habe sich unter einem Bahnhof etwas mit Bewirtschaftung vorgestellt.
Wir waren erfreut und irritiert darüber, daß er zu uns kommen wollte. Später erfuhren wir, daß er Nachdenken über Christa T. gelesen hatte. – Eine etwas skurrile Gestalt in schwarzer Lederjacke, mit einem grünen Hemd, für das er, wie er sagt, lange herumlaufen mußte, weil er das Kunststoffzeug nicht vertrage, und einer flachen runden Schirmmütze. Ein großer Konfektkarton wird mir überreicht. Es habe nichts anderes gegeben. Er selbst lehnt Süßes ab, sein Arzt habe ihm dazu geraten, da er gegen Süßes eine Abneigung habe. Dann essen Sie es eben nicht.
Erst allmählich begreife ich, daß er weniger essen, vielmehr trinken will, und bekomme es mit der Angst zu tun, daß unsere mäßigen Alkoholvorräte seinem Bedürfnis nicht gewachsen sein würden. Eine Flasche Wodka wird gerne angenommen, Nordhäuser Korn lehnt er ab: Seine Großmutter habe ihn davor gewarnt, es sei dasselbe wie Nortak-Tabak. Dann schon lieber Ihren vorzüglichen Gin. Im Gegensatz zu seiner sonstigen Höflichkeit, sogar Förmlichkeit, bedient er sich selbst. Und wird allmählich lockerer, beginnt sogar von seinen Empfindungen zu sprechen: Hier bei uns wisse er zum ersten Mal nicht, welche Rolle er spiele; sonst komme er zu alten Freunden oder zu alten Feinden, die alle ihre Vorstellung von ihm hätten, hier sei er eigentlich gar nichts und benehme sich ganz falsch. Protest läßt er generell nicht gelten.
Mich streift eine Ahnung, wie einer lebt, der sich in jedem Augenblick bewußt ist, daß er eine Rolle spielt. Und was für eine Spannung in ihm entstehen muß, wenn zwei Rollen miteinander streiten: An diesem Nachmittag ist es nach meiner Meinung die Rolle des höflichen, wißbegierigen Gastes und die eines übergenauen Kontrolleurs. Kein Wunder, wenn diese Spannung sich, auch bei anderen Gelegenheiten, manchmal in einem Ausbruch entlädt.
Im Lauf des Nachmittags zeigt sich, daß er jede Äußerung, jedes Schweigen von mir genau registriert und oft falsch gedeutet hat. Einer Korrektur mißtraut er. Auch versteht er manchmal nicht unsere Art von Ironie: Als ich mit normaler Stimme in einem normalen Satz »unsere Menschen« sage, glaubt er, mich bei einer ernstgemeinten Phrase ertappt zu haben. Er erzählt, wie man ihm seine Ironie in Mecklenburg abgewöhnt habe, als man ihm angesichts seines Erstaunens über im August noch nicht abgeerntete Felder ins Gesicht hinein behauptet hätte: Wir mähen eben nur sonntags.
Sein eigentliches Interesse gilt unserem Verhältnis zur DDR und seinem Verhältnis zur DDR. Wie müßte der Satz heißen, will er wissen, der, parallel zu Brechts Vorschlag: Minsk ist die langweiligste Stadt der Welt, über die DDR geschrieben werden sollte, um anzuzeigen, daß man über alles offen schreiben könne: Ich kann oder will keinen einzelnen Satz formulieren; etwas von einer »vertanen Chance« müßte darin vorkommen, meine ich, Johnsons Vorschläge weise ich als zu apodiktisch zurück. Ich muß wohl das Wort »Dialektik« verwendet haben, er sagte plötzlich: Auch er bemühe sich ja, Marxist zu sein.
Er fragt viel. Er setzt sich in seiner Phantasie eine Eisenbahnerfamilie zusammen, Vater, Mutter, zwei Kinder, die in Leipzig leben sollen. Er will alles über sie wissen. Ich habe das Gefühl, ihm nichts Neues sagen zu können, er nennt Einzelheiten, die mir unbekannt sind. Zwischendurch, bei negativen Schilderungen, wird er ironisch und belehrt uns: Das glaube er nicht. Er lese ja schließlich das Neue Deutschland.
Dann wieder fühlt man sich wie in einer Prüfung vor einem anspruchsvollen Examinator: Er fordert Geschichten, die ich schreiben müßte. Das könne doch besonders ergiebig sein vom Standpunkt dessen, der einmal geglaubt habe. Ob es für mich kein Problem gewesen sei, in die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft einzutreten. Ob die Arbeiter sich hier wirklich als sozialistische Eigentümer fühlten. In der Bundesrepublik könnten sie jedenfalls um ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen kämpfen. Hier hätten sie doch keine Mitbestimmung. Aber – das ist sein großer Vorbehalt gegenüber dem Land, das er vor fünfzehn Jahren gegen die DDR eingewechselt hat (er sei nicht freiwillig gegangen, sondern »verdrängt« worden, und im Westen verteidige er die DDR!), sein Vorbehalt also: daß das Dritte Reich in der Bundesrepublik noch immer nicht überwunden sei.
Es scheint, als argwöhne er, wir würden es ihm verübeln, daß er die DDR verlassen hat, und er müsse diesen Schritt verteidigen. Dafür sind ihm negative Belegstücke aus unserem Leben recht. Dann wieder sucht er doch noch nach Anlässen für Hoffnung. Wann also könne dieser Satz geschrieben werden, der die DDR...
| Erscheint lt. Verlag | 12.3.2012 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | Aufsatzsammlung • Christa • Deutsch • Georg-Büchner-Preis 1980 • Geschichte 1900-2011 • Geschichte 1970-2011 • Geschichte 2004-2011 • Interview • Künste • Literatur • Sinsheimer-Literaturpreis 2005 • Thomas-Mann-Preis 2010 • Uwe-Johnson-Preis 2010 • Wilhelm-Raabe-Preis der Stadt Braunschweig (abgelehnt) 1972 • Wolf • Wolf Christa • Wolf, Christa |
| ISBN-10 | 3-518-78370-X / 351878370X |
| ISBN-13 | 978-3-518-78370-2 / 9783518783702 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich