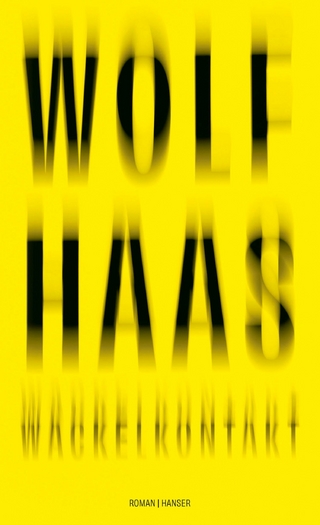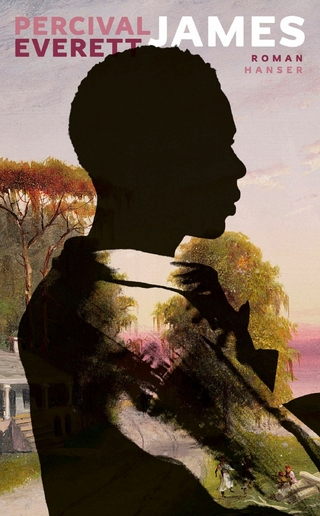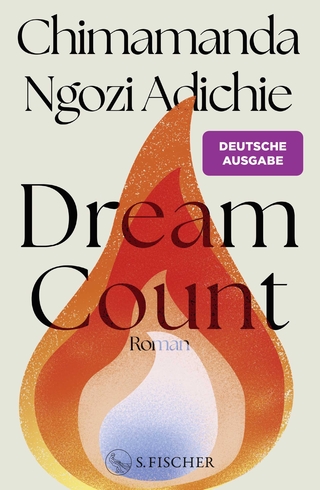Wahnsinns Liebe (eBook)
240 Seiten
dtv Deutscher Taschenbuch Verlag
978-3-423-41170-7 (ISBN)
Lea Singerpromovierte in Musik und Literaturwissenschaft sowie in Kunstgeschichte. 2010 erhielt sie den Hannelore-Greve-Literaturpreis der Hamburger Autorenvereinigung. Lea Singer lebt als Schriftstellerin und Publizistin in München.
Lea Singerpromovierte in Musik und Literaturwissenschaft sowie in Kunstgeschichte. 2010 erhielt sie den Hannelore-Greve-Literaturpreis der Hamburger Autorenvereinigung. Lea Singer lebt als Schriftstellerin und Publizistin in München.
Eigentlich müßte er erleichtert sein, daß der Kerl tot ist. Mit ihm ist ein Problem aus der Welt, das ihn selbst beinahe umgebracht hat. Was ihn belastet, ist dieser Brief, den er jetzt schreiben muß. Alles würde er zahlen, wenn ihm das jemand abnähme. Aber erstens hat er nicht einmal genug Geld für die fällige Miete, und zweitens gibt es niemanden, der diesen Brief für ihn schreiben könnte. Es ist ja nicht einfach ein Kondolenzbrief an den Bruder des Toten. Es soll ein Drohbrief werden, der auf keinen Fall drohend klingen darf. Aber es muß unmißverständlich daraus hervorgehen, daß sein Name in Zusammenhang mit diesem Todesfall nicht genannt werden darf. Es wissen zwar einige, wie und warum dieser Kerl mit fünfundzwanzig Jahren ums Leben kam. Doch die meisten Mitwisser halten dicht. Und die näheren Umstände seines Todes dürfen sich auf keinen Fall herumsprechen. »Geben Sie seine Kränkungen wegen der ganzen Mißerfolge als Grund für die Tat an«, schreibt er.
Kann man das so stehenlassen?
Er zieht ein Taschentuch heraus und wischt sich die Glatze ab. So fest muß er den Füller umklammert haben, daß er eine hartnäckige Delle in den Mittelfinger gedrückt hat.
Durch das geöffnete Fenster dringt die naßkalte Novemberluft herein. Sie ist schwer vom Geruch des verfaulenden Laubs, doch sie tut ihm gut. Die passende Luft zu seinem Vorhaben. Von nebenan hört er ein dumpfes Geräusch. Als wäre jemand zu Boden gefallen. Nein, er darf jetzt nicht an seine Frau denken. Das würde ihn ablenken von diesem Brief. Er will nicht wissen, was sie gerade macht und wie ihr zumute ist. Obwohl eben das sein Verhängnis geworden ist: daß er von ihr nichts weiß. Weder von dem, was ihr rundlicher, kleiner, weißer Körper begehrt, noch von dem, was sich hinter ihren dunklen Augen abspielt.
Vor ihm, über seinem Schreibtisch, steht eine Sperrholzwand, beklebt mit einer Girlandentapete. Sie ist nicht einmal an der Decke befestigt, sondern wird nur gehalten von Bücherregalen auf beiden Seiten. Zwei Fotos sind daran festgenagelt: zwei signierte Porträts des Mannes, den er einmal gehaßt hat und nun vergöttert. Von ihr, die er vor siebeneinhalb Jahren geheiratet hat, ist kein Bild zu sehen. Er wüßte nicht mal, in welcher Schublade er eines fände. Und ihr großes Porträt im Wohnzimmer wird er nun wohl vernichten. Oder verschenken. Nur dieses dünne Brett trennt die beiden, doch keine Wand könnte dicker sein.
Sie hat nicht damit gerechnet, daß er nach ihr schaut; ohne ersichtlichen Grund ist sie gerade gestolpert und hingefallen. Jetzt sitzt sie wieder am Schreibtisch und schreibt schnell, wie gehetzt. An denselben Adressaten wie ihr Mann. »Glauben Sie mir, er hat von uns beiden den leichteren Weg gewählt. Leben zu müssen ist in so einem Fall schrecklich schwer.« Sie setzt ab und schaut auf das Foto im angelaufenen Silberrahmen, das sie, ihren Mann und die beiden Kinder zeigt. Aber sie hat etwas anderes vor Augen: die Leiche eines jungen Mannes mit einer Schlinge um den Hals und einem Küchenmesser in der Brust. So sei er aufgefunden worden, hat man ihr gesagt. Wäre es besser, sie hätte das wirklich gesehen? Dann wären wenigstens die Fragen beantwortet, die sie nun verfolgen.
Haben seine Augen offengestanden? Ist seine Haut verfärbt gewesen? Was hat er getragen, oder war er nackt? Wer hat ihn angefaßt und wo? Und wie haben sie ihn abtransportiert?
Sie legt den Füller zur Seite und geht hinüber ins Schlafzimmer. Es ist ungeheizt. Trotzdem zieht sie sich ganz langsam aus und schaut sich an in dem Spiegel, der in die Schranktür eingelassen ist. So sieht eine Frau aus, die zwei schwere Geburten hinter sich gebracht hat und keine Zeit hat, viel für sich zu tun. Sie legt ihre Hände unter ihre Brüste, läßt sie beben, fährt langsam über den weißen Bauch, das Schamhaar, zu den Schenkeln hinunter. Und schließt die Lider. »Diese Frisur entstellt dich. Mach dein Haar auf«, hört sie ihn sagen. Blind greift sie nach oben, zieht die Nadeln und den Kamm heraus. Spürt, wie die Haare fallen und ihren nackten Körper wärmen. Sie öffnet die Augen. Bis zur Taille umhüllt sie dieses dunkelbraune, rötlich schimmernde Fell. »Du bist schön«, hört sie ihn wieder. »Du bist schön und warm und wohltuend. Und ich bin bei dir zu Hause.«
Die Tür wird aufgerissen. Ihr Mann steht da. »Was machst du hier? Bist du des Wahnsinns? Es ist eiskalt hier.«
Er dreht sich weg und schlägt die Türe hinter sich zu.
Sie aber bleibt stehen. Tränenlos starrt sie sich an. Wozu hat sie ihn noch, diesen Körper? Überflüssiges, nutzloses Fleisch.
Strümpfe, Wäsche, Bluse, Rock, Schuhe. Sie kehrt zurück in jenes Abteil, das sie ihr Zimmer nennt, an ihren Schreibtisch, in die Gegenwart. Doch niemand kann ihr die Erinnerung nehmen. Unwillkürlich lächelt sie. Drei Jahre hat sie gelebt. Und gelernt, was Liebe ist. Sie zieht die Schreibtischschublade auf und holt eine Horndose heraus. Braune Haare sind darin, seine Haare. Sie steckt die Nase hinein. Immer noch riechen sie nach ihm. Alles ist da, ganz nah. Und Mathilde sieht sich selbst am Anfang dieser Geschichte. Eine Frau von achtundzwanzig Jahren, geduldig, still, ohne Wünsche.
Um drei ahnt sie noch nicht, daß sich von diesem Tag an ihr Leben verändern wird. Sie bemerkt nur, daß es muffig riecht im Wohnzimmer. Wie immer haben sie ihre feuchten Mäntel übereinander auf einem Stuhl gestapelt. Warum stört keinen von den Männern dieser Geruch? Sie will sich nicht daran gewöhnen. Dabei hat sie sich an so vieles gewöhnt. Auch daran, daß alle sich immer hier zusammenrotten, ausgerechnet in dieser düsteren engen Wohnung. »… aber sie hat durchaus ihren Reiz«, sagen Besucher meistens verlegen. Ihr Mann und sie haben versucht, mit Phantasie und ohne Geld aus den vier kleinen, hohen, schlecht geschnittenen Zimmern das Beste zu machen. Die Gründerzeitmöbel, die sie aus Berlin mithergebracht haben, sind heiter wie Beichtstühle. Deswegen haben sie die Wände im Eßzimmer gelb, in seinem Arbeitsraum türkisfarben tapeziert, die Türen und eine Kommode azurblau lackiert, alte Orientteppiche, Kelims und geerbte Kaschmirschals über das Sofa, den Diwan und den Tisch gelegt und rotgrundige Teppiche auf den Boden, egal wie abgetreten oder abgenutzt sie sind.
Ärmlich zu wohnen, damit hat sie keine Probleme. Denn verglichen mit ihrer Kindheit ist das hier prächtig. Fließend Wasser, eine Toilette, die sie nur mit ihrem Bruder teilen, der Wand an Wand mit ihnen wohnt; es ist ihr angenehm zu wissen, daß sie beim Putzen der Schüssel nur mit den Spuren von Menschen zu tun hat, die ihr vertraut sind. Und dann liegt die Wohnung in der Liechtensteinstraße, die in diesem Abschnitt zwar so wenig repräsentativ ist wie die Beiseln rechts und links, sich dafür aber im Alsergrund befindet. Im neunten Wiener Bezirk. Und der hat einen Ruf, der entschieden romantischer ist, als es Treppenhäuser mit Schwamm in der Wand, morsche Parkettböden und Zinkbadewannen in dunklen Küchen sind. Wer im Alsergrund haust, hat kein Geld, aber Einfälle, heißt es. Kein Renommee und keine Posten, aber gute Aussichten auf Nachruhm. Jedenfalls wohnen hier Maler, Psychoanalytiker, Musiker, Schriftsteller, Journalisten, Theaterleute und eben auch Komponisten wie Zemlinsky und Schönberg.
Wie immer hält sich Mathilde Schönberg auch an diesem Nachmittag heraus aus seinem Zimmer, aus seinem Kreis. Daß die Besucher sie übersehen wie einen Einrichtungsgegenstand, wie einen Ofen, der Wärme zu spenden, aber nicht aufzufallen hat, das macht ihr längst nichts mehr aus. Denn sie erbringen dafür eine Gegenleistung: Sie machen ihren Mann erträglich. Wenn sich die Meute wieder verzogen hat, wenn sie die Asche zusammenfegt, die Aschenbecher leert, die Tassen spült, ist er immer gutgelaunt. Seine vorstehenden Augen sind dann nicht mehr voll Weltschmerz, sie schauen wach, sogar optimistisch. Man müßte, denkt Mathilde dann, in Apotheken Bewunderung in Flaschen kaufen können. Auf jeden Menschen wirkt sie wie Medizin, mehr noch: wie eine Glücksdroge. Und von der verabreichen die Schüler Schönberg große Dosen. Sie sind ihm geradezu verfallen. Oft kommt es Mathilde so vor, als würden sie ihm auch noch in den Tod folgen, obwohl sie wissen, daß er keineswegs der Befreier oder gar der Erlöser ist. Es reicht ihnen, daß so viele gegen ihn hetzen und es schon fast einem religiösen Bekenntnis gleichkommt, für ihn zu sein. Das schweißt sie zusammen. Und ihre Anbetung wirkt Wunder. Auch an diesem Nachmittag. Schon als Mathilde die ersten beiden Kannen Kaffee hineinträgt, sieht sie Schönberg an, daß seine Niedergeschlagenheit sich für ein paar Stunden verkrochen hat. Wie verwandelt scheint er. Die wulstige Falte zwischen seinen Brauen ist geglättet. Doch sie hört, daß gar nicht von fachlichen Problemen die Rede ist, sondern von irgendeinem Mann, über den sie anscheinend alle einer Meinung sind. Üblicherweise läßt Mathilde das, worüber in der Schülerrunde geredet wird, an sich ablaufen. Doch heute merkt sie, wie ihre Neugier wachgekitzelt wird, schon allein von der Erregtheit, mit der sie über diesen Mann herziehen. Es könnte sich um einen Kollegen aus einem anderen Lager handeln, denn jeder erklärt ihn für verrückt. Einstimmig wird der Kerl als größenwahnsinnig verurteilt; der eine gibt seinen Kommentar erhitzt ab, der nächste abgeklärt wie ein alter Nervenarzt. Dreist, unberechenbar und hemmungslos, das sind noch die harmloseren Beschimpfungen. Wahrscheinlich, hört sie, sei die angestammte Heimat dieses Menschen der Narrenturm im Allgemeinen Krankenhaus, ordentlich vergittert. Aufgebracht reden sie...
| Erscheint lt. Verlag | 1.1.2012 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Arnold Schönberg • Biografischer Roman • Dreiecksbeziehung • eBook • Ehebruch • Entfremdung • Frauenschicksal • gelebte Geschichte • Künstlerroman • Liebesaffäre • Literatur • Mathilde Schönberg • Richard Gerstl • Romanbiografie • Wien |
| ISBN-10 | 3-423-41170-8 / 3423411708 |
| ISBN-13 | 978-3-423-41170-7 / 9783423411707 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 203 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich