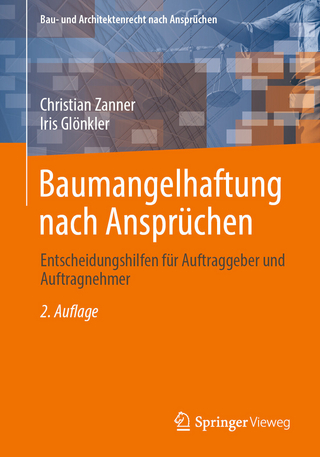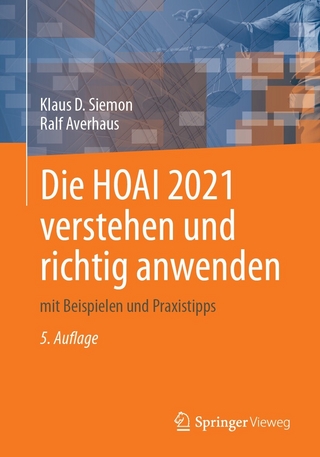Die elektive Konkurrenz. (eBook)
475 Seiten
Duncker & Humblot GmbH (Verlag)
978-3-428-53268-1 (ISBN)
Dr. Thomas Bachmann, geboren 1980 in Mühlhausen (Thüringen), studierte Rechtswissenschaft in Jena und Alicante (Spanien). Seine Dissertation aus dem Jahr 2009 wurde ausgezeichnet mit dem Promotionspreis der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seit 2011 ist Bachmann als Rechtsanwalt in der Rechtsabteilung der Siemens Aktiengesellschaft in Erlangen tätig.
Vorwort 6
Inhaltsübersicht 8
Inhaltsverzeichnis 10
Einleitung 28
A. Ausgangslage 28
B. Ziele der Untersuchung 31
C. Gang der Untersuchung 32
Kapitel 1: Die elektive Konkurrenz im historischen Kontext 35
A. Die Entwicklung der elektiven Konkurrenz 35
I. Die actio im römischen Recht 35
II. Die Klagenkonkurrenz im gemeinen Recht 36
1. Traditionelle gemeinrechtliche Klagenkonkurrenzen 36
2. Die elektive oder „vollständige“ Konkurrenz der Klagen nach Savigny 38
a) Der Begriff der Konkurrenz nach Savigny 38
b) Der Begriff des Klagrechts nach Savigny 39
III. Die Entwicklung des Anspruchs nach Windscheid 40
1. Der Anspruch 40
2. Die Überwindung der prozessrechtlichen elektiven Konkurrenz 41
IV. Die elektive Konkurrenz und die Anspruchskonkurrenzen 42
1. Die Anspruchshäufung 43
2. Die Gesetzeskonkurrenz 43
3. Die Anspruchskonkurrenz 44
a) Die echte Anspruchskonkurrenz 44
b) Die Anspruchsnormenkonkurrenz 45
c) Das Merkmal der Anspruchskonkurrenz: Die Erfüllungsgemeinschaft 46
d) Das Merkmal der elektiven Konkurrenz: Die Geltendmachung 47
e) Die Abgrenzungsprobleme am Beispiel des Bürgenrückgriffs 48
aa) Beispiel: Der Bürgenrückgriff 48
bb) Die Selbständigkeit der Rückgriffsansprüche 49
cc) Die Erfüllungsgemeinschaft der Rückgriffsansprüche 50
dd) Fazit: Der Bürgenrückgriff 51
4. Die elektive Konkurrenz heute: Überleben aktionenrechtlichen Denkens 52
V. Das Gestaltungsrecht in der elektiven Konkurrenz 54
1. Das Gestaltungsrecht nach Seckel 54
2. Einordnung in das moderne Verständnis der elektiven Konkurrenz 56
VI. Fazit: Die historische Entwicklung der elektiven Konkurrenz 57
B. Parallele: Die historische Entwicklung der Wahlschuld und der Ersetzungsbefugnis 58
I. Die obligatio alternativa 58
II. Die Pendenztheorien 60
III. Die Bestimmbarkeit der Schuld: Parallele zur Ersetzungsbefugnis 63
1. Die unbestimmte, aber bestimmbare Schuld 63
2. Die bestimmte Schuld mit Ersetzungsbefugnis des Schuldners 65
3. Die bestimmte Schuld mit Ersetzungsbefugnis des Gläubigers 66
IV. Die Kodifikation der Wahlschuld in den §§ 262 ff. BGB 68
V. Die praktische „Wertlosigkeit“ der Wahlschuldregeln 69
1. Problem: Die Zweifelsregel der Schuldnerwahl nach § 262 BGB 70
2. Problem: Die Rückwirkung der Wahl nach § 263 Abs. 2 BGB 71
VI. Die „Flucht“ in die Ersetzungsbefugnis und die elektive Konkurrenz 72
1. Beispiele: § 179 Abs. 1 BGB und § 340 Abs. 1 BGB – von der Wahlschuld zur elektiven Konkurrenz 73
2. Beispiele: § 81 BEG und § 843 Abs. 3 BGB – von der Wahlschuld zur Ersetzungsbefugnis des Gläubigers 76
3. Beispiel des neuen Schuldrechts: § 439 Abs. 1 BGB 77
VII. Ausblick 78
C. Fazit zu Kapitel 1: Die elektive Konkurrenz im historischen Kontext 80
Kapitel 2: Die Gläubigerwahlrechte im Schuldverhältnis 81
A. Die Struktur des Schuldverhältnisses 81
I. Das Schuldverhältnis 81
II. Die Strukturelemente im Schuldverhältnis 82
B. Die Rechte des Gläubigers 83
I. Das Forderungsrecht – der Anspruch 83
II. Trennung von Primäranspruch und Sekundäranspruch 84
III. Das Gestaltungsrecht 86
C. Der Inhalt des Forderungsrechts 87
I. Synonyme des Forderungsrechts: Schuld, Forderung, Obligation 87
II. Die Leistung – das Leistungsgebot 88
III. Die Leistungsmodalitäten 88
D. Die Gläubigerwahlrechtsfälle 90
I. Die Optionen des Gläubigers: Recht und Tun 90
II. Beispiele 91
1. Optionale Leistungsgebote: „Tun 1 oder Tun 2“ 91
2. Optionale Rechte: „Recht 1 oder Recht 2“ 92
3. Problem: „Tun oder Recht“? 93
III. Einordnung der drei Typen von Gläubigerwahlrechten 95
1. Die Wahlschuld mit Gläubigerwahlrecht 95
a) Der Gehalt der Wahlschuld mit Gläubigerwahlrecht 95
b) Das Gläubigerwahlrecht als Gestaltungsrecht 96
2. Die Ersetzungsbefugnis des Gläubigers 97
a) Die gestaffelten Leistungsgebote 98
b) Das ausfüllende Gestaltungsrecht 98
3. Die elektive Konkurrenz 99
a) Beispiele 100
b) Der Begriff der elektiven Konkurrenz 100
IV. Fazit: Die Gläubigerwahlrechtsfälle 103
E. Fazit zu Kapitel 2: Die Gläubigerwahlrechte im Schuldverhältnis 103
Kapitel 3: Die logische Einordnung der Gläubigeroptionen 105
A. Die Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten 105
I. Das monadische System 107
1. Die einfache Schuld 107
2. Der monadische Wahrheitswert 108
3. Beispiele 109
4. Fazit: Das monadische System 110
II. Die Abgrenzung der Optionenvielfalt zur Wahl 110
B. Das dyadische System 111
I. Die Wittgensteinsche Wahrheitswertetafel 112
II. Die Fälle miteinander verträglicher Optionen 114
1. Tautologie 115
2. Disjunktion 115
3. Replikation 116
4. Präpendenz 116
5. Implikation 117
6. Postpendenz 117
7. Äquivalenz 118
8. Konjunktion 118
III. Die Fälle miteinander nicht verträglicher Optionen 119
1. Exklusion 119
2. Kontravalenz 119
3. Postnonpendenz 120
4. Postsektion 120
5. Pränonpendenz 120
6. Präsektion 121
7. Rejektion 121
8. Antilogie (Kontradiktion) 122
IV. Die Gläubigerwahlrechtsfälle im dyadischen System 122
1. Die Wahlschuld mit Gläubigerwahlrecht 123
2. Die Ersetzungsbefugnis des Gläubigers 124
3. Die elektive Konkurrenz 125
a) Abgrenzung zu Fällen kompatibler Rechte 125
b) Beispiel inkompatibler Rechte 126
4. Fazit: Die Gläubigerwahlrechtsfälle im dyadischen System 127
V. Fazit: Das monadische und das dyadische System 128
C. Nähere Begrenzung der Ausschließlichkeit: Die Alternativität 128
I. Die Bedeutung der Alternativität 129
II. Terminologisches Problem: Herkunft und Festlegung als Zweizahl im Sprachgebrauch 130
III. Logische Einordnung der Alternativität 132
1. Der Begriff „Disjunktive“ bei Savigny und Pescatore 132
2. Alternativität im logischen Sinne: Die drei Bedeutungen des „oder“ 133
a) Mögliche Bedeutungen des „oder“ 133
b) Einordnung der „Disjunktive“ 134
3. Die Alternativität von Leistungsgeboten 135
a) Die Wahlschuld mit Gläubigerwahlrecht 135
b) Die Ersetzungsbefugnis des Gläubigers 136
4. Die Alternativität von Rechten in elektiver Konkurrenz 137
a) Die Konkurrenz zwischen Primäranspruch und Sekundärrecht 137
b) Die Konkurrenz der Sekundärrechte 137
c) Fazit: Die Alternativität von Rechten in elektiver Konkurrenz 140
IV. Fazit: Die Alternativität 140
D. Die Entstehung der Alternativität im System der Gläubigerwahlrechte 141
I. Die Enstehung der Alternativität 141
1. Die Begründung der Alternative 141
a) Anknüpfung an das Ereignis 1 142
b) Beispiele 142
c) Fazit: Die Begründung der Alternative 143
2. Die Vermehrung der Optionen zur Alternative 144
a) Anknüpfung an das Ereignis 2 144
b) Beispiel 145
c) Fazit: Die Vermehrung der Optionen zur Alternative 146
II. Die Vermehrung der Rechte im neuen Leistungsstörungsrecht 146
a) Die Unmöglichkeit der Leistung gemäß § 275 BGB 146
b) Frühere Rechtslage: Der Wegfall des Primäranspruchs nach § 326 Abs. 1 S. 2 HS 2 BGB a. F. 147
c) Problem: Das Schicksal des Erfüllungsanspruchs gemäß § 439 BGB 148
aa) Problemaufriss: Das Schicksal des Erfüllungsanspruchs bei Mängeln 149
bb) Lösung: Die Modifikation des Erfüllungsanspruchs 150
cc) Vergleich: Das Schicksal des Erfüllungsanspruchs im CISG 151
III. Die zeitliche und qualitative Staffelung der Optionen 152
IV. Trennung von Staffelung und Alternativität der Rechte 153
1. Die Staffelung von alternativen und kompatiblen Rechten 153
2. Beispiele 155
V. Die elektive Konkurrenz zwischen nicht gestaffelten Rechten 156
1. Beispiel: Die Konkurrenz zwischen dem Erfüllungsanspruch und einem Gestaltungsrecht ohne Leistungsstörung 156
2. Beispiel: Die Begründung des von Anfang an gestörten Schuldverhältnisses nach § 179 Abs. 1 BGB 157
VI. Fazit: Die Entstehung der Alternativität 158
E. Fazit zu Kapitel 3: Die logische Einordnung der Gläubigeroptionen 159
Kapitel 4: Die Fälle elektiver Konkurrenz im System der Gläubigerrechte 160
A. Vorüberlegung: Auswahl der Fälle und internationaler Vergleich 160
I. Die systematische Auswahl der Fälle 160
II. Der Vergleich zu CISG, PECL und DCFR 161
1. Das UN-Kaufrecht (CISG) 161
2. Die Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts (PECL) 162
3. Der Entwurf eines Gemeinsamen Referenzrahmens (DCFR) 163
B. Die elektive Konkurrenz gleichrangig primärer Ansprüche 165
I. Verhaltene Ansprüche 165
1. Die Definition nach Langheineken 165
2. Der Grad der Wirkungslosigkeit eines Anspruchs 167
II. Die Konkurrenz verhaltener Ansprüche am Beispiel des § 179 Abs. 1 BGB 168
1. Beispiel 168
2. Die Besonderheiten des Falls 169
3. Logische Einordnung der Konkurrenz 170
III. Vergleich zu PECL und DCFR 170
IV. Fazit: Die elektive Konkurrenz gleichrangig primärer Ansprüche 171
C. Die Konkurrenz der Nacherfüllungsvarianten 171
I. Die Varianten der Nacherfüllung gemäß § 439 Abs. 1 BGB 172
1. Frühere Rechtslage 172
a) Nachlieferung: Der modifizierte Erfüllungsanspruch 173
b) Nachbesserung: Der selbständige Gewährleistungsanspruch 173
c) Die Gläubigerwahl: Elektive Konkurrenz 174
2. Heutige Regelung: § 439 Abs. 1 BGB 174
3. Auslegung der Nacherfüllungsalternative 176
a) Gesetzeswortlaut 176
b) Systematische Auslegung 176
c) Historische Auslegung 177
aa) Interpretation von Art. 3 Richtlinie 1999/44/EG 177
bb) Gesetzesbegründung 178
cc) Frühere Rechtslage und Abschlussbericht der Schuldrechtskommission 179
dd) Rückgriff auf Art. 46 CISG 181
ee) Zwischenergebnis: Historische Auslegung 182
d) Teleologische Auslegung 182
aa) Die Einschränkung der Käuferposition durch § 263 BGB 183
bb) Die Stärkung der Verkäuferposition durch § 264 Abs. 2 BGB 184
cc) Zwischenergebnis: Teleologische Auslegung 187
4. Lösungsansätze zum teleologischen Widerspruch zwischen § 439 BGB und den Wahlschuldregeln 187
a) Mindermeinung: Anwendung der §§ 262 ff. BGB auf § 439 Abs. 1 BGB 187
b) Richtlinienkonforme Auslegung von § 439 Abs. 1 BGB 188
c) Beschränkung des Anwendungsbereichs der §§ 262 ff. BGB 189
d) Anfechtung der Wahl gemäß § 119 Abs. 2 BGB 190
e) Keine endgültige Bindungswirkung des Gestaltungsrechts 190
f) Spezialität des § 439 BGB gegenüber den §§ 262 ff. BGB 192
g) Fazit: Lösungsansätze zum teleologischen Widerspruch zwischen § 439 BGB und den Wahlschuldregeln 193
5. Folgeproblem: Das Wahlrecht innerhalb der Nacherfüllungsvariante 194
6. Fazit: Die Varianten der Nacherfüllung gemäß § 439 Abs. 1 BGB 196
II. Vergleich zu Art. 46 Abs. 2 und Abs. 3 CISG: Elektive Konkurrenz 196
III. Vergleich zu PECL und DCFR: Alternative Leistungen 198
1. Art. 9:102 (1) PECL 198
2. Art. III.-3:302 (2) DCFR 199
IV. Fazit: Die Konkurrenz der Nacherfüllungsvarianten 200
D. Das Verhältnis zwischen Primäranspruch und Schadensersatzanspruch statt der Leistung 201
I. Prämisse: Elektive Konkurrenz getrennter Ansprüche 201
1. Die Ausschließlichkeit von Primäranspruch und Schadensersatz 201
2. Trennung der Ansprüche 202
II. Logische Einordnung der Konkurrenz 203
III. Die Verhaltenheit und Erfüllbarkeit der Ansprüche 204
1. Die Rangfolge der Ansprüche vor erfolglosem Fristablauf 204
2. Verhaltener Schadensersatzanspruch statt der Leistung nach erfolglosem Fristablauf 204
3. Problem: Verhaltener Primäranspruch nach erfolglosem Fristablauf? 205
a) Problemaufriss und Stellungnahme 205
b) Die Lösungsansätze der Gegenmeinung 207
aa) Die Aufforderung zur Gläubigerwahl durch den Schuldner 207
bb) Das Angebot der Leistung durch den Schuldner 208
cc) Stellungnahme 209
dd) Folgeproblem: Das erfolglose Angebot 210
4. Fazit: Die Verhaltenheit und Erfüllbarkeit der Ansprüche 211
IV. Vergleich zu CISG, PECL und DCFR 211
1. Art. 45 Abs. 1 b), Abs. 2 und Art. 74 ff. CISG 212
2. Art. 8:102 und Art. 9:501 PECL 214
3. Art. III.-3:102 und Art. III.-3:701 ff. DCFR 215
4. Fazit: Vergleich zu CISG, PECL und DCFR 215
V. Fazit: Das Verhältnis zwischen Primäranspruch und Schadensersatz statt der Leistung 216
E. Das Verhältnis zwischen Primäranspruch und Rücktrittsrecht 216
I. Erklärung der Konkurrenz 216
1. Der Gestaltungscharakter des Rücktritts 216
2. Die Konkurrenz zum Primäranspruch 217
II. Logische Einordnung der Konkurrenz 218
III. Vergleich zu CISG, PECL und DCFR 218
1. Art. 49 und Art. 64 CISG 219
a) Der Ausnahmecharakter des Rechts zur Vertragsaufhebung 219
b) Die elektive Konkurrenz zum Anspruch auf Erfüllung 219
c) Kein Vorrang der Erfüllung 220
2. Art. 9:301 PECL 220
a) Der Ausnahmecharakter und die Ex-nunc-Wirkung des Rechts zur Vertragsaufhebung 220
b) Die elektive Konkurrenz zum Anspruch auf Erfüllung 221
3. Art. III.-3:502 ff. DCFR 222
a) Der Ausnahmecharakter des Rechts zur Vertragsaufhebung 222
b) Die elektive Konkurrenz zum Anspruch auf Erfüllung 223
4. Fazit: Vergleich zu CISG, PECL und DCFR 223
IV. Fazit: Das Verhältnis zwischen Primäranspruch und Rücktrittsrecht 224
F. Das Verhältnis zwischen Primäranspruch und Gestaltungsrechten (Anfechtung, Kündigung, Minderung) 224
I. Das Verhältnis zwischen Erfüllungsanspruch und Anfechtungsrecht 224
1. Die elektive Konkurrenz zum Anspruch auf Erfüllung 224
2. Problem: Die Konkurrenz zwischen den Gewährleistungsrechten und der Anfechtung 225
3. Vergleich zu CISG, PECL und DCFR 227
II. Das Verhältnis zwischen Primäranspruch und Kündigungsrecht 229
III. Das Verhältnis zwischen Primäranspruch und Minderungsrecht 230
1. Das besondere Gestaltungsrecht im Kauf- und Werkvertragsrecht 230
2. Die elektive Konkurrenz zum Nacherfüllungsanspruch 231
3. Logische Einordnung der Konkurrenz 232
4. Vergleich zu CISG, PECL und DCFR 232
a) Der Vorrang des Nacherfüllungsrechts des Verkäufers nach Art. 50 CISG 233
b) Art. 9:401 i. V. m. 8:102 PECL und Art. III.-3:601 i. V. m. III.-3:102 DCFR 233
IV. Fazit: Das Verhältnis zwischen Primäranspruch und Gestaltungsrechten 234
G. Das Verhältnis zwischen den Gestaltungsrechten 234
I. Die elektive Konkurrenz von Gestaltungsrechten 235
II. Logische Einordnung der Konkurrenz 236
1. Die Staffelung der Rechte 236
2. Die schwache Ausschließlichkeit der Gestaltungsrechte 237
III. Vergleich zu CISG, PECL und DCFR 238
1. CISG: Die elektive Konkurrenz zwischen Recht zur Vertragsaufhebung und Minderung 238
2. PECL und DCFR: Die elektive Konkurrenz zwischen den Gestaltungsrechten 240
IV. Fazit: Das Verhältnis zwischen den Gestaltungsrechten 240
H. Das Verhältnis zwischen den Schadensersatzansprüchen gemäß §§ 280 ff. BGB 241
I. Trennung der Schadensersatzansprüche nach dem Interesse des Gläubigers 241
1. Die Unterscheidung zwischen positivem und negativem Interesse 241
2. Die Einteilung der §§ 280 ff. BGB nach Schaden und Gläubigerinteresse 243
a) Schadensersatz statt der Leistung nach §§ 280 Abs. 1, 3 281 BGB
b) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung nach §§ 280 Abs. 2, 286 BGB 244
c) Schadensersatz neben der Leistung nach § 280 Abs. 1 BGB 244
II. Grundsatz: Keine Konkurrenz der Schadensersatzansprüche 245
III. Die Wahlrechte des Gläubigers im Rahmen des § 281 BGB 247
1. Problem: Der Verzögerungsschaden im Anspruch nach § 281 BGB 247
a) Frühere Rechtslage 247
b) Heutige Rechtslage 248
c) Fazit: Der Verzögerungsschaden im Anspruch nach § 281 BGB bzw. § 286 BGB 249
2. Das Wahlrecht zwischen kleinem und großem Schadensersatz 250
a) Die Teilleistung des Schuldners 250
b) Die Schlechtleistung des Schuldners 251
c) Bewertung des Wahlrechts 252
3. Weitere Wahlrechte im Rahmen des § 281 BGB 252
IV. Vergleich zu CISG, PECL und DCFR 253
1. Grundsatz: Der allgemeine Schadensersatzanspruch für alle Schäden 253
2. Das Zusammenspiel zwischen Schadensersatzanspruch und Recht zur Vertragsaufhebung 254
a) Kein großer Schadensersatz ohne Vertragsaufhebung 254
b) Die Wahl nach Tätigung eines Deckungsgeschäfts 255
V. Fazit: Das Verhältnis zwischen den Schadensersatzansprüchen gemäß §§ 280 ff. BGB 255
I. Das Verhältnis zwischen Schadensersatzanspruch und Rücktrittsrecht 256
I. Frühere Rechtslage: Die Alternativität von Rücktritt und Schadensersatz 256
II. Keine Alternativität der Rechte nach heutigem § 325 BGB 257
1. Trennung von Schadensersatz und Rücktritt 258
a) Allgemein: Systematik, Rechtscharakter und Tatbestand 258
aa) Die Aussage des § 325 BGB 258
bb) Die systematische Trennung der Rechte 258
cc) Der Charakter der Rechte 259
dd) Der Zweck der Rechte 259
b) Trennung von Rücktrittsrecht und Schadensersatzanspruch neben der Leistung 260
aa) Keine Konkurrenz zwischen Rücktrittsrecht und § 280 Abs. 1 BGB 260
bb) Keine Konkurrenz zwischen Rücktrittsrecht und Verzugsschadensersatz 261
c) Trennung von Rücktrittsrecht und Schadensersatzanspruch statt der Leistung 261
d) Fazit: Trennung von Schadensersatz und Rücktritt 262
2. Problem: Die Wahl des Gläubigers zwischen Surrogations- und Differenzmethode 262
a) Frühere Rechtslage: Der Schadensersatz wegen Nichterfüllung nach Surrogations- und Differenzmethode 263
b) Bewertung dieses Wahlrechts nach heutiger Rechtslage 264
aa) Logische Einordnung des Wahlrechts 264
bb) Rechtliche Einordnung des Wahlrechts 265
cc) Trennung der Erklärungen des Gläubigers 266
3. Logische Einordnung des Verhältnisses zwischen Schadensersatzanspruch und Rücktrittsrecht 267
a) Die vier logischen Handlungsvarianten: Tautologie 267
b) Die Unterscheidung zwischen Schadensersatz statt der Leistung und Schadensersatz neben der Leistung 268
c) Beispiel eines Schadensersatzes statt der Leistung 269
4. Fazit: Keine Alternativität der Rechte nach heutigem § 325 BGB 270
III. Die Alternativität der Rechtsfolgen von Rücktritt und Schadensersatz 270
1. Der Einfluss des Rücktritts auf den Schadensersatz 271
a) Der Einfluss auf die Gegenleistung des Gläubigers 271
b) Der Einfluss auf den Nutzungsausfall 272
c) Der Einfluss auf die Leistung des Schuldners 273
aa) Grundsatz: Die Wahl zwischen kleinem und großem Schadensersatz 273
bb) Keine Wahl bei Rücktrittserklärung 274
2. Die schadensrechtliche Überlagerung der Rücktrittsfolgen 275
a) Die „Aufbesserung“ der Rückgewähransprüche 275
aa) Beispiel 275
bb) Die Ausweitung des Differenzschadens 275
cc) Stellungnahme 276
b) Die Beschränkung der Rückgewähransprüche 278
aa) Beispiel 278
bb) Der rücktrittsrechtliche Nutzungsersatz als Schaden 278
cc) Der Gesamtvermögensvergleich und die normative Schadensberechnung 278
dd) Stellungnahme 279
3. Das Wahlrecht des Gläubigers vor dem Hintergrund der alternativen Rechtsfolgen 280
a) Trennung von elektiver Konkurrenz und automatischer Schadensberechnung 280
b) Problem: Die nachteilige Wahl des Rücktritts 281
aa) Problemaufriss 281
bb) Beispiel 282
cc) Lösungsansätze 283
c) Lösungsansatz 1: Der Vorrang des Schadensersatzrechts 283
aa) Frühere Rechtslage: Der Vorrang des Rücktrittsrechts 283
bb) Heutige Rechtslage: Vorrang des Schadensersatzrechts? 284
cc) Beispiel: Rücktrittsbedingter Nutzungsausfall der mangelhaften Sache 285
dd) Kritik 286
d) Lösungsansatz 2: Das ius variandi 287
e) Fazit: Die nachteilige Wahl des Rücktritts 288
IV. Vergleich zu CISG, PECL und DCFR 288
1. Keine elektive Konkurrenz: Der Schadensersatz ohne oder neben Vertragsaufhebung 289
2. Kein großer Schadensersatz ohne Vertragsaufhebung 289
3. Kombination beider Rechte: Die Alternativität der Rechtsfolgen 290
a) Die Vertragsaufhebung und der Schadensersatz nach der Differenzmethode 290
b) Die Vertragsaufhebung und der Deckungskauf 291
c) Die Konkurrenz der Rechtsfolgen bezüglich der Gebrauchsvorteile 292
aa) CISG, DCFR: Vorteilsausgleich nach Vertragsaufhebung 293
bb) PECL: Kein Vorteilsausgleich nach Vertragsaufhebung 293
4. Fazit: Vergleich zu CISG, PECL und DCFR 294
V. Fazit: Das Verhältnis zwischen Schadensersatzanspruch und Rücktrittsrecht 294
J. Das Verhältnis zwischen Schadensersatzanspruch und Minderungsrecht 295
I. Keine Konkurrenz zwischen Minderung und Schadensersatz neben der Leistung 295
1. Der Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung 296
2. Der sonstige Schadensersatz neben der Leistung 296
II. Problem: Die elektive Konkurrenz zwischen Minderung und Schadensersatz statt der Leistung 298
1. Problemaufriss 298
a) Beispiel 298
b) Streitstand 299
2. Stellungnahme 299
a) Vergleich zum Verhältnis zwischen Rücktritt und Schadensersatz statt der Leistung 300
b) Die Ausschließlichkeit der Rechte 301
c) Offenes Problem: Die voreilige Minderung 301
d) Fazit: Die elektive Konkurrenz zwischen Minderung und Schadensersatz statt der Leistung 303
III. Logische Einordnung des Verhältnisses zwischen Schadensersatz und Minderung 303
1. Das Verhältnis zwischen Schadensersatz neben der Leistung und Minderung 303
2. Das Verhältnis zwischen Schadensersatz statt der Leistung und Minderung 304
IV. Vergleich zu CISG, PECL und DCFR 305
1. Art. 45 Abs. 1 b), 2 und Art. 50 CISG 305
2. Art. 9:401 (3) PECL und Art. III.-3:601 (3) DCFR 306
V. Fazit: Das Verhältnis zwischen Schadensersatzanspruch und Minderungsrecht 306
K. Das Verhältnis zwischen Schadensersatzanspruch und Aufwendungsersatzanspruch 307
I. Die Alternativität zwischen Schadensersatzanspruch und Aufwendungsersatzanspruch 307
1. Die elektive Konkurrenz zwischen Schadensersatz statt der Leistung und Aufwendungsersatz 307
2. Frühere Rechtslage: Die Rentabilitätsvermutung 308
3. Heutige Rechtslage: Die Rentabilitätsvermutung 309
4. Fazit: Die Alternativität zwischen Schadensersatzanspruch und Aufwendungsersatzanspruch 310
II. Keine Alternativität zwischen Schadensersatzanspruch und Aufwendungsersatzanspruch 311
1. Der Schadensersatz neben der Leistung 311
a) Grundsatz: Keine elektive Konkurrenz 311
b) Ausnahme: Elektive Konkurrenz 311
2. Ausnahme bei Schadensersatz statt der Leistung: Keine elektive Konkurrenz? 312
III. Logische Einordnung des Verhältnisses zwischen den Rechten 313
IV. Vergleich zu CISG, PECL und DCFR 313
1. Art. 74 CISG 314
2. Art. 9:502 PECL und Art. III.-3:702 DCFR 314
V. Fazit: Das Verhältnis zwischen Schadensersatzanspruch und Aufwendungsersatzanspruch 315
L. Das Verhältnis zwischen Aufwendungsersatzanspruch und Rücktrittsrecht 316
I. Die Stellung des Aufwendungsersatzanspruchs im BGB 316
1. Problem: Parallele zum Schadensersatz statt der (ganzen) Leistung 316
2. Das Verhältnis zum Rücktrittsrecht 317
a) Beispiel 317
b) Das Zusammenspiel der Rechte: Anwendung des § 325 BGB 317
c) Logische Einordnung des Verhältnisses der Rechte 318
II. Vergleich zu CISG, PECL und DCFR 319
1. Allgemein: Die Aufwendungen als ersatzfähiger Schaden 319
2. Besonderheit: Die Aufwendungen aus Erhaltungspflichten nach Art. 85 f. CISG 320
III. Fazit: Das Verhältnis zwischen Aufwendungsersatzanspruch und Rücktrittsrecht 320
M. Das stellvertretende commodum nach § 285 BGB im System der Gläubigerrechte 320
I. Das Verhältnis zum Primäranspruch 321
II. Das Verhältnis zu den Schadensersatzansprüchen 322
1. Keine Alternativität zwischen Schadensersatzanspruch und Anspruch aus § 285 BGB 322
a) Schadensersatz neben der Leistung 322
b) Schadensersatz statt der Leistung 323
2. Problem: Bewertung als elektive Konkurrenz? 323
a) Merkmale der elektiven Konkurrenz 324
aa) Trennung der Ansprüche 324
bb) Keine logische Ausschließlichkeit der Ansprüche 325
b) Fazit: Keine elektive Konkurrenz 326
III. Das Verhältnis zum Rücktrittsrecht 326
1. Beispiel des Rücktritts wegen Teilunmöglichkeit 326
2. Logische Einordnung der Beziehung 327
3. Problem: Surrogationsmethode bei Rücktritt und § 285 BGB? 328
IV. Das Verhältnis zum Minderungsrecht 328
1. Beispiel 328
2. Die Anwendbarkeit des § 285 BGB im besonderen Schuldrecht 329
3. Logische Einordnung der Beziehung 330
4. Problem: Die gesetzliche Minderung nach § 326 Abs. 3 S. 2 BGB 331
V. Das Verhältnis zum Aufwendungsersatzanspruch 332
1. Parallele zum Schadensersatz statt der Leistung: Keine elektive Konkurrenz 332
2. Problem: Die Kombination der Rechte 332
a) Analogie zu § 285 Abs. 2 BGB 332
b) Beschränkung auf rentable Aufwendungen 333
3. Fazit: Das Verhältnis zum Aufwendungsersatzanspruch 334
VI. Vergleich: Das stellvertretende commodum in CISG, PECL und DCFR 334
1. Art. 79 Abs. 5 CISG i. V.m. Art. 84 Abs. 2 b) CISG analog 334
a) Die Folgen der Unmöglichkeit 334
b) Die Entlastung des Schuldners und das stellvertretende commodum 335
c) Das Verhältnis zu Vertragsaufhebung und Minderung 336
2. Art. 8:101 i. V.m. 8:108 PECL sowie Art. 9:309 PECL analog? 337
3. Art. III.-3:101 (2) i. V.m. III.-3:104 DCFR sowie Art. III.-3:513 (1) DCFR analog? 338
4. Fazit: Das stellvertretende commodum in CISG, PECL und DCFR 339
VII. Fazit: Das stellvertretende commodum nach § 285 BGB im System der Gläubigerrechte 339
N. Fazit zu Kapitel 4: Die Fälle elektiver Konkurrenz im System der Gläubigerrechte 340
Kapitel 5: Das Wahlrecht und die Lösung der elektiven Konkurrenz 342
A. Das Wahlrecht 342
I. Das Wahlrecht der Wahlschuld 343
1. Das Wahlrecht als initiatives Gestaltungsrecht 343
2. Beispiel 345
II. Das Wahlrecht der Ersetzungsbefugnis 346
1. Das Wahlrecht als Gestaltungsrecht 346
a) Die Leistung und die Ersatzleistung 346
b) Das Wahlrecht des Schuldners: Gestaltungserklärung und Erfüllungsversuch 347
c) Das Wahlrecht des Gläubigers und der „Wettlauf“ mit dem Schuldner 347
2. Beispiel 348
III. Das Wahlrecht in der elektiven Konkurrenz 348
1. Vorüberlegung: Unterschied zu Wahlschuld und Ersetzungsbefugnis 349
2. Die Wahl eines normalen Anspruchs 350
a) Der normale Anspruch 350
b) Die Ausübungsfreiheit und die Erfüllung des Anspruchs 350
c) Beispiel 351
3. Die Wahl eines Gestaltungsrechts 353
a) Die Gestaltungswirkung der Wahl 353
b) Beispiel 353
4. Die Wahl eines verhaltenen Anspruchs 354
a) Die materiellrechtliche Bedeutung der Wahl 354
b) Beispiel: Die Wahl des Schadensersatzanspruchs statt der Leistung nach §§ 280 Abs. 1, 3 281 BGB
c) Sonderfall: Die Wahl der verhaltenen Ansprüche nach § 179 Abs. 1 BGB 356
5. Fazit: Das Wahlrecht in der elektiven Konkurrenz 358
IV. Problem: Bedeutet Wahlrecht auch Wahlpflicht? 358
1. Problemaufriss 358
a) Das Dilemma des Schwebezustands für den Schuldner 359
b) Beispiel: Die elektive Konkurrenz von Gewährleistungsrechten im Kaufrecht 360
c) Lösungsansatz: Spiegelung des Wahlrechts in einer Wahlpflicht? 362
aa) Die negative Ausübungsfreiheit der Rechte 362
bb) Die Begrenzung der negativen Ausübungsfreiheit durch Zwang 363
2. Die faktische Wahlpflicht durch gesetzlichen Zwang 364
a) Der gesetzliche Zwang zur Wahl 364
b) Der faktische Zwang durch Verjährung 364
c) Der faktische Zwang durch Zeitablauf vor der Verjährung 365
aa) Beispiel: Der Verlust des Anfechtungsrechts nach § 121 Abs. 1 S. 1 BGB 366
bb) Beispiel: Der Verlust des Rechts zur Vertragsaufhebung nach Art. 49 Abs. 2 CISG 367
3. Die faktische Wahlpflicht durch das Zwangsrecht des Schuldners 368
a) Das Zwangsrecht des Schuldners 368
b) Das Beispiel der Wahlschuld mit Gläubigerwahlrecht: § 264 Abs. 2 BGB 368
4. Fazit: Keine allgemeine Wahlpflicht 370
V. Fazit: Das Wahlrecht 371
B. Der Zweck des Wahlrechts 371
I. Die Zweckrichtung in den Fällen der Gläubigerwahl 372
1. Der Zweck der Wahl in der Wahlschuld mit Gläubigerwahlrecht 372
a) Der ökonomische Zweck 372
b) Der Anpassungszweck 374
aa) Der Versicherungszweck 374
bb) Der Wahlzweck 375
cc) Auseinanderfallen und Disharmonie der Zwecke 375
2. Der Zweck der Ersetzungsbefugnis des Gläubigers 376
3. Der Zweck der Wahl in einer elektiven Konkurrenz 377
a) Der Zweck der Wahl zwischen Primäranspruch und alternativen Sekundärrechten 377
aa) Die Wahl zwischen Erfüllungsstadium und Abwicklungsstadium 377
bb) Beispiel 378
b) Der Zweck der Wahl zwischen alternativen Sekundärrechten 379
aa) Die Wahl zwischen alternativen Formen der Abwicklung 379
bb) Beispiel 379
II. Die Bewertung des Wahlrechtzwecks 380
1. Der Versuch teleologischer Abgrenzung von Wahlschuld und elektiver Konkurrenz 380
2. Die Berücksichtigung des Zwecks im Rahmen der Bindungswirkung eines Rechts 382
III. Fazit: Der Zweck des Wahlrechts 382
C. Die Grenzen des Wahlrechts und das ius variandi 383
I. Die absoluten Grenzen des Gläubigerwahlrechts 383
1. Vorüberlegung: Die anfängliche Einengung der Optionenvielfalt 384
a) Die qualitative Stufung der Optionen zur Verhinderung von Konkurrenzen 384
b) Beispiel: Das qualitative Gefälle der Rechtsbehelfe im CISG 384
2. Die Erfüllung der Leistungspflicht durch den Schuldner 385
a) Die Wahlschuld mit Gläubigerwahlrecht 386
b) Die Ersetzungsbefugnis des Gläubigers 386
c) Die elektive Konkurrenz 387
aa) Die elektive Konkurrenz zwischen Primär- und Sekundäransprüchen 387
bb) Die elektive Konkurrenz zwischen Sekundäransprüchen 388
3. Die Unmöglichkeit der Gläubigeroptionen 389
a) Die Wahlschuld mit Gläubigerwahlrecht 389
b) Die Ersetzungsbefugnis des Gläubigers 390
c) Die elektive Konkurrenz 391
4. Verjährung, Zeitablauf und Verwirkung 392
5. Das vertraglich vereinbarte Ende des Wahlrechts 394
6. Fazit: Die absoluten Grenzen des Gläubigerwahlrechts 395
II. Die Ausübung der Wahl 395
1. Trennung zwischen Beginn und Ende der Bindung an die Wahl 395
a) Die Unterscheidung zwischen der Wirkung ex tunc und der Wirkung ex nunc 395
b) Beispiel: Die Wirkung der Anfechtung nach § 142 Abs. 1 BGB 396
c) Beispiel: Die Wirkung der Wahl in der Wahlschuld nach § 263 Abs. 2 BGB 396
2. Die Ausübung der Wahl und die „Definität“ der Entscheidung 397
a) Trennung der Wahlerklärung von der bloßen Ankündigung der Wahl 397
b) Beispiel: Die Wahl der Rechte nach § 326 Abs. 1 BGB a. F. 397
aa) Die Ablehnungsandrohung vor der Wahl der Rechtsbehelfe 397
bb) Übertragung auf die heutige Rechtslage 399
III. Das ius variandi 401
1. Problemaufriss: Die nachteilige Wahlentscheidung des Gläubigers 401
2. Ursprung und Dogmatik des ius variandi 403
3. Das ius variandi als Grundregel 405
IV. Die Gläubigerwahl in der elektiven Konkurrenz: Bindung an die Wahl oder ius variandi? 406
1. Die Wahl des Primäranspruchs 407
a) Keine Bindung an die getroffene Wahl 407
b) Beispiele 408
2. Die verschiedenen Bezugspunkte der Bindung an die Wahl des Sekundärrechts 410
3. Die Wahl des Sekundäranspruchs 412
a) Die Bindung an den Sekundäranspruch gegenüber dem Primäranspruch 412
aa) Die Bindung an den Schadensersatzanspruch statt der Leistung nach § 281 Abs. 4 BGB 412
bb) Keine Bindung an den Aufwendungsersatzanspruch 413
cc) Fazit: Keine Bindung an Sekundäransprüche ohne ausdrückliche Regelung 414
b) Die Bindung an den Sekundäranspruch gegenüber anderen Sekundärrechten 415
aa) Keine Bindung an den Sekundäranspruch 415
bb) Beispiel: Der Schadensersatz statt der ganzen Leistung 416
c) Fazit: Die Wahl des Sekundäranspruchs 417
4. Die Wahl des Gestaltungsrechts 417
a) Die Bindung an das Gestaltungsrecht gegenüber dem Primäranspruch 418
aa) Die Unwiderruflichkeit der Gestaltungserklärung 418
bb) Beispiel 420
b) Die Bindung an das Gestaltungsrecht gegenüber anderen Sekundärrechten 421
aa) Meinungsstand zum Rücktritt nach § 326 Abs. 1 S. 1 BGB a. F. 421
bb) Problem: Übertragbarkeit auf die heutige Rechtslage? 424
cc) Beispiel: Der Wechsel vom Rücktritt zum kleinen Schadensersatz 425
dd) Beispiel: Der Wechsel zwischen Rücktritt und Minderung 426
ee) Stellungnahme 427
ff) Fazit: Die Bindung an das Gestaltungsrecht gegenüber anderen Sekundärrechten 431
5. Fazit: Die Bindung an die Gläubigerwahl in der elektiven Konkurrenz 431
V. Parallele zur Gläubigerwahl zwischen Leistungsgeboten: Bindung an die Wahl oder ius variandi? 432
1. Die Bindung an die Wahl in der Wahlschuld mit Gläubigerwahlrecht 433
aa) Grundsatz: Die Bindung an die Wahl nach § 263 Abs. 1 BGB 433
bb) Ausnahmen: Keine Bindung an die Wahl nach § 263 Abs. 1 BGB 433
cc) Beispiel: Die Wahl zwischen den Nacherfüllungsvarianten nach § 439 Abs. 1 BGB 436
2. Die Bindung an die Wahl der Ersetzungsbefugnis des Gläubigers 439
3. Fazit: Die Bindung an die Gläubigerwahl zwischen Leistungsgeboten 440
VI. Die Schranken des ius variandi 441
1. Die absoluten Grenzen des ius variandi 441
2. Das rechtskräftige Urteil über das Gewählte 442
3. Das Gebot von Treu und Glauben nach § 242 BGB 443
a) Zeitlicher und quantitativer Maßstab 444
b) Qualitativer Maßstab: Das Vertrauen des Schuldners in die getroffene Wahl 445
aa) Beispiel: Die Klage des Schuldners 446
bb) Beispiel: Die Zusage des Schuldners 447
cc) Beispiel: Die erkennbare Vorbereitungshandlung des Schuldners 447
4. Fazit: Die Schranken des ius variandi 448
VII. Fazit: Die Grenzen des Wahlrechts und das ius variandi 448
D. Fazit zu Kapitel 5: Das Wahlrecht und die Lösung der elektiven Konkurrenz 449
Zusammenfassende Thesen 450
Kapitel 1 450
Kapitel 2 451
Kapitel 3 451
Kapitel 4 452
Das System der Gläubigerrechte im Bürgerlichen Gesetzbuch 453
Das System der Gläubigerrechte in CISG, PECL und DCFR 456
Kapitel 5 458
Literaturverzeichnis 461
Sachverzeichnis 473
| Erscheint lt. Verlag | 20.4.2010 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Schriften zum Bürgerlichen Recht |
| Zusatzinfo | Tab., Abb.; 475 S. |
| Sprache | deutsch |
| Gewicht | 1 g |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► Privatrecht / Bürgerliches Recht |
| Schlagworte | Elektive Konkurrenz • Gläubigerwahlrechte • Leistungsstörungsrecht |
| ISBN-10 | 3-428-53268-6 / 3428532686 |
| ISBN-13 | 978-3-428-53268-1 / 9783428532681 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich