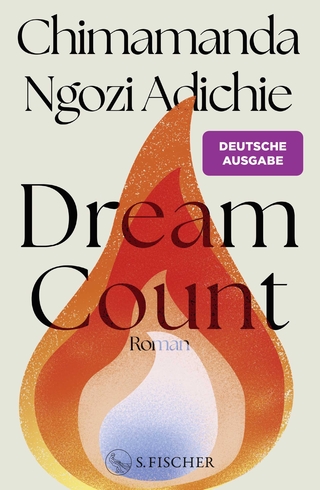Kurzer Frühling (eBook)
400 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-401065-6 (ISBN)
Valentin Senger, geboren 1918 in Frankfurt am Main, arbeitete nach einer Lehre zum Technischen Zeichner als Konstrukteur. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er Journalist und arbeitete zunächst für die Sozialistische Volkszeitung, später für den Hessischen Rundfunk. Valentin Senger starb 1997 in Frankfurt am Main.
Valentin Senger, geboren 1918 in Frankfurt am Main, arbeitete nach einer Lehre zum Technischen Zeichner als Konstrukteur. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er Journalist und arbeitete zunächst für die Sozialistische Volkszeitung, später für den Hessischen Rundfunk. Valentin Senger starb 1997 in Frankfurt am Main.
Ein ruiniertes Bücherbord
Die amerikanischen und englischen Bomber hatten Frankfurt gründlich zerstört. Alt- und Innenstadt waren eine Trümmerwüste, aus der hie und da, wie zufällig, ein stehengebliebenes Haus sich hochreckte, dem halbzerfressenen letzten Zahnstummel eines alten Mannes ähnlich. Die Stadt lag im Koma. Es gab nichts zu essen, kein Trinkwasser, kein Gas, keinen Strom und keine Kohlen, um Tee zu kochen oder eine Suppe zu wärmen.
Papa, mittlerweile fünfundsiebzig Jahre alt, kletterte mit mir über ein zusammengestürztes Haus in der Hochstraße, ganz in der Nähe unserer Wohnung. Wir waren dabei, Brennholz aus den Trümmern zu klauben. Papa trug einen Rucksack und ich einen großen Sack, an dem ich zum besseren Halten eine kurze dicke Schnur befestigt hatte. So machten es auch die Kohlenträger.
In den Straßen, wo noch Menschen in halbzerstörten Häusern oder in Kellern wohnten, war es gar nicht einfach, Holz aus den Trümmerbergen zu holen. Viele waren entweder schon leergeräumt oder von anderen Holzsuchern besetzt.
Ich grub und zerrte die Bretter oder Balkenreste heraus, und Papa, der etwas unterhalb stand, zerkleinerte und verstaute sie. Es hatte Vorteile, daß wir zu zweit Brennholz beschaffen gingen. Der im Trümmerschutt wühlte, brauchte nicht auch ständig auf das zusammengetragene Holz aufzupassen.
Denn es gab Holzsucher, vor allem Kinder, die sich auf bequemere Art Trümmerholz beschafften. In einem unbewachten Augenblick nahmen sie es anderen weg. Den Bestohlenen wäre es nicht in den Sinn gekommen, darin etwas moralisch Verwerfliches zu sehen. Natürlich war es ärgerlich, wenn sich ein Halbwüchsiger eine Bohle, die man mit Mühe und Schweiß aus dem Schutt herausgeholt hatte, blitzschnell unter den Arm klemmte und davonrannte, aber das war Überlebenspraxis. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit warf ihm der Bestohlene fluchend einen halben Ziegelstein nach.
Um an die Reste von Dielen, Zimmertüren, Schränken und Stühlen zu gelangen, mußte man den Schutt mit Hacke und Schippe beiseite räumen. Ich grub seitlich unter einem Mauerrest und legte das Ende eines dunkelbraunen Brettes frei. Es hatte zu einem Bücherbord gehört, denn als ich es mit Mühe aus dem Mauerschutt herauszerrte, sah ich einen Haufen Bücher und Broschüren darunter, zum Teil zerrissen, einige noch fast unbeschädigt. Ich nahm ein paar Bücher hoch, klopfte den Mörtelstaub ab und las die Titel: Dr. Joseph Goebbels, »Signale der neuen Zeit«; Ernst Jünger, »Der Krieg als inneres Erlebnis«; »Kampf um Deutschland – ein Lesebuch für die deutsche Jugend«; und – mit einem dicken Hakenkreuz in der Mitte – »Das Programm der NSDAP und seine weltanschaulichen Grundgedanken« von Gottfried Feder. Ich legte die Bücher zur Seite. Als ich den zweiten Packen hochnahm, hatte ich einen Stoß antisemitischer Machwerke in der Hand: »Die Geheimnisse der Weisen von Zion« von Gottfried zur Beek; »Handbuch der Judenfrage« von Theodor Fritsch; »Rasse und Seele«; und eine angesengte Broschüre mit dem Titel »Kaiser, Erzbischof und Juden – eine Zusammenstellung von Tatsachen aus der Geschichte der Stadt Frankfurt am Main«. Immer mehr Bücher zog ich aus dem Schutt. Mich überkam ein Gefühl, als müßte ich nur noch ein bißchen weitergraben, um auf all die widerlichen Gestalten zu stoßen, die mir in den zwölf Jahren des Schreckens so viele Ängste bereitet hatten. Höchst lebendig, wenn auch mucksmäuschenstill und feige, saßen sie in ihren Löchern und warteten auf ihre Zeit: vom Nebenhaus der »Rübe ab!«-Luftschutzwart, welcher Juden, Kommunisten, Hundertfünfundsiebzigern und Russen »ohne langen Prozeß die Rübe absäbeln« wollte; der Gesangslehrer unserer Schule, der mit öliger Stimme von der minderwertigen Rasse tönte, die man eliminieren müsse; der Prokurist meiner Lehrfirma, der Juden und Zigeuner mit Läusen und Wanzen verglich; die Denunziantin von gegenüber, die ihre Untermieterin, eine junge Büroangestellte, wegen »Blutschande« mit einem jüdischen Freund bei der Gestapo anzeigte und sie in den Tod trieb. Und all die andern, die keine Sekunde gezögert hätten, meine Familie und mich den Nazi-Henkern auszuliefern, würden sie geahnt haben, wer wir waren.
Ich unterbrach meine Arbeit und blätterte in den verschmutzten und versengten Pamphleten. Bis ich Papa ärgerlich rufen hörte: »Walja!« Und noch einmal »Walja!«
Ich wandte den Kopf und sah ihn mit einem bösen Gesicht bei den halbgefüllten Holzsäcken stehen. Er fuchtelte mit den Armen herum, als wolle er mir jede Buchseite einzeln aus den Händen reißen.
»Hast du nichts Wichtigeres zu tun, als Bücher zu betrachten. Ausgerechnet jetzt!«
Recht hatte er. Wir schindeten uns in der Sonnenhitze, weil wir dringend Brennbares brauchten, und ich betrachtete Bücher. Ließ mich von zufällig im Trümmerschutt erhalten gebliebenen Druckwerken pathologischer Antisemiten aus der Fassung bringen und vergaß, was ich in den Resten des zerbombten Hauses suchte.
Aber ich konnte mich dennoch nicht von den Büchern losreißen. »Moment noch, Papa, gleich mache ich weiter.« Ich nahm das zerrissene Handbuch der Judenfrage hoch und blätterte ein wenig darin. Angst beschlich mich. Das Dritte Reich war zerschlagen, Hitler tot, die Judenvernichtung hatte ein Ende. Aber war damit für die Handvoll am Leben gebliebener Juden wirklich eine Zukunft ohne Angst gewonnen?
»Machst du jetzt weiter oder nicht?«
»Sofort. Ich habe ein paar Nazibücher gefunden.«
»Und darum läßt du mich hier stehen?«
Er schüttelte den Kopf und setzte sich mit einem Seufzer auf einen Stein.
Ich blickte hinunter zu Papa. Von hier oben wirkte er noch kleiner, als er in Wirklichkeit war. Die fünfundsiebzig Jahre hatten ihn zusammengedrückt. Doch nicht nur die fünfundsiebzig Jahre, auch Mamas Tod. Seit sie nicht mehr lebte, lebte auch er nur noch halb, verkroch sich immer mehr in sich, zog sich zu ihr zurück.
Dabei war er nie inaktiv gewesen. An seinem Arbeitsplatz in der Fabrik hatte er seinen Mann gestanden, es als Spitzendreher zum Einrichter gebracht, hatte an den großen Metallarbeiterstreiks 1924 und 1929 teilgenommen, in den Frankfurter Adlerwerken eine Gruppe der kommunistischen Roten Gewerkschafts-Opposition gegründet, Beiträge kassiert, Flugblätter verteilt und Zeitungen verkauft. Selbst noch in der Hitlerzeit, als jede kleinste Auffälligkeit, eine falsche Bewegung oder seine jiddische Aussprache ihm und damit auch seinen Angehörigen den Tod bringen konnte, war er nicht untätig. Jüdischen Freunden, die von der Gestapo gesucht wurden, besorgte er Verstecke, bis sie ins Ausland fliehen konnten, unserer Familie auf krummen Wegen Lebensmittel und Bezugsscheine für Schuhe und russischen Zwangsarbeiterinnen, die er zu betreuen hatte, entgegen strengen Verboten manche Erleichterungen, bis ihn deswegen die Gestapo verhaftete und einen Tag lang verhörte.
Trotzdem habe ich nur noch die Erinnerung an einen müden und immer gütigen Papa, der nie schrie, nie richtig wütend wurde. Wäre er es doch nur einmal geworden! Hätte er nur ein einziges Mal so gebrüllt wie Rektor Beyer, wenn ein Schüler ihm ein Widerwort gab, oder wie der Kohlenträger über uns im dritten Stock, wenn er betrunken nach Hause kam und seine Frau beschimpfte! Ein gezischtes »Idi k tschortu! – Geh zum Teufel!« war das Schlimmste, was er jemals zu mir gesagt hat.
Sonst beschwichtigte er immer nur und zog sich zurück hinter Mama. Er hatte, solange ich mich erinnern kann, nie das Bedürfnis gehabt, aus ihrem Schatten herauszutreten. Jakob, der Mann von Olga, sagte man in Freundes- und Genossenkreisen, nie umgekehrt. Und er war noch stolz darauf, stolz auf Mama.
Was mußte er für ein Kerl gewesen sein, damals, als er noch Moissee Rabisanowitsch hieß, durch Europa fuhr, ein russischer Revolutionär, um den Wind zu säen, der als Sturm die Romanows vom Zarenthron fegte. Es gab noch einige Fotos von ihm aus dieser Zeit. Da war er groß und schlank, mit einem verwegenen Schnauzbart, wie ihn der junge Trotzki und der legendäre Reitergeneral Budjonni trugen. Und wie stolz hielt er auf diesen Fotos den Kopf hoch, die Augen sprühten unter den buschigen Augenbrauen. Papa war in seiner Jugend ein schöner Mann gewesen. Wenn ich ihn je um etwas beneidet habe, dann um dieses Aussehen und den Eindruck, den er damit bei den Frauen gemacht haben muß. Ich war in diesem Lebensalter ein häßliches Entlein, nach dem sich kein Mädchen umschaute, ein Nichts, das auf Anordnung von Mama ein Nichts bleiben mußte, um nicht aufzufallen, damit die Familie in der Hölle des Faschismus überleben konnte.
Es ist eigentlich kein Wunder, daß Papa so klein und müde geworden war. Zwei Drittel seines Lebens, über fünfzig Jahre, hat er in Angst gelebt. Wer kann ermessen, was das heißt: in Angst leben?
Die Sonne brannte, Papa schwitzte, und die Schweißtropfen zogen sich unter dem Hutrand wie eine Perlenkette über seine Stirn. Er nahm den Hut vom Kopf, wischte ihn aus, tupfte sich mit dem Taschentuch die feuchte Perlenkette fort und setzte ihn wieder auf. Dann nahm er den Kopf in die gespreizten Hände und stützte die Ellenbogen auf die Knie. Sein Jackett hatte auf dem runden Rücken einen dunklen Schweißfleck.
Ich wühlte weiter in dem Schutt und holte etwa zwei Dutzend Bücher hervor. »Nimm sie, Papa, und steck sie in den Sack.« Ich hielt ihm den Stoß Bücher hin.
»Bist du meschugge, Walja! Was sollen wir mit den Büchern? Willst du sie lesen oder verbrennen?«
»Steck sie in den Sack. Bitte. Ich will sie mit nach Hause nehmen.«
Papa tat, worum ich ihn bat, obwohl er mich für verrückt hielt.
»Du schleppst sie auch selbst...
| Erscheint lt. Verlag | 11.11.2011 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Autobiographie • Familie • Frankfurt • Frankfurt am Main • Judentum • Kassel • Kommunismus • KPD • Nachkriegszeit • Nationalsozialismu • Nationalsozialismus • Roman |
| ISBN-10 | 3-10-401065-X / 310401065X |
| ISBN-13 | 978-3-10-401065-6 / 9783104010656 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 874 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich