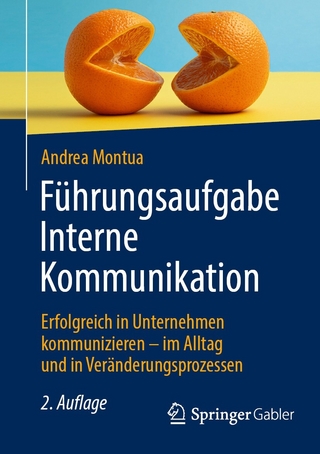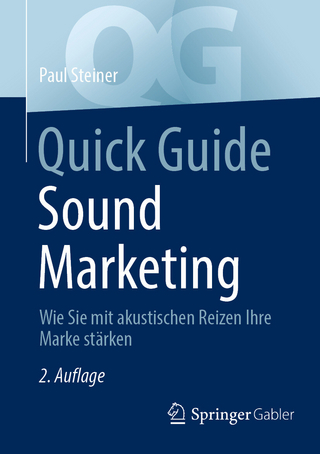Qualitative Marktforschung in Theorie und Praxis (eBook)
XXVI, 691 Seiten
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-8349-6790-9 (ISBN)
'Dieses Buch ist unverzichtbar! [...] Das Lesen dieses gar nicht trockenen Lehrbuches macht Freude, die einzelnen Kapitel sind systematisch strukturiert, die praxisorientierten Beiträge mit jeweils etwa 20 Seiten lassen sich unabhängig und auch peu à peu lesen. Wenn es nicht ein Lehrbuch wäre, würde man sagen: Das ist der richtige Schmöker für Marktforscher. Lesen!' planung & analyse
In der 2. Auflage wurden alle Beiträge überarbeitet und aktualisiert. Neue Beiträge zu Impliziten Methoden, der Standortbestimmung einer Branche im Umbruch und dem Image der qualitativen Marktforschung wurden aufgenommen.
Gabriele Naderer ist Professorin im Studiengang Markt- und Kommunikationsforschung an der Hochschule Pforzheim mit Schwerpunkt qualitative und psychologische Marktforschung.
Eva Balzer arbeitet selbstständig als qualitative Marktforscherin.
Gemeinsam gründeten sie 2005 den Arbeitskreis Qualitative Markt- und Sozialforschung (AKQua) im BVM (Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e. V.).
Gabriele Naderer ist Professorin im Studiengang Markt- und Kommunikationsforschung an der Hochschule Pforzheim mit Schwerpunkt qualitative und psychologische Marktforschung.Eva Balzer arbeitet selbstständig als qualitative Marktforscherin. Gemeinsam gründeten sie 2005 den Arbeitskreis Qualitative Markt- und Sozialforschung (AKQua) im BVM (Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e. V.).
Geleitwort 5
Zur zweiten Auflage 5
Zur ersten Auflage 5
Vorwort 7
Inhaltsverzeichnis 9
Die Herausgeberinnen 13
Autorenverzeichnis 14
Teil A: Qualitative Marktforschung –Einführung und Überblick 26
Standortbestimmung einer Branche im Umbruch 27
1 Einführung 28
2 Erfolgsfaktoren für die Zukunft der qualitativen Marktforschung 29
2.1 Wissenschaftstheoretische Verankerung 29
2.2 Methodenentwicklung und -evaluation 30
2.3 Nähe zur akademischen Forschung 32
2.4 Fachliche Qualifikation 33
3 Fazit 33
Literaturverzeichnis 34
Das Image der qualitativen Marktforschung 35
1 Einführung 36
2 Methodisches Vorgehen 37
3 Ergebnisse zum Image der qualitativen Marktforschung 38
3.1 In den Zielen vereint? 38
3.2 Fokusgruppen und sonst gar nichts? 39
3.3 Die qualitative Analyse – eine Blackbox? 40
3.4 Qualifiziertes Expertenwissen oder eine Frage der emotionalen Intelligenz? 41
3.5 Qualitative Marktforschung – eine weibliche Persönlichkeit? 42
4 Fazit 43
Literaturverzeichnis 44
Standortbestimmung aus theoretischer Perspektive 46
1 Einführung 47
2 Theoretische Standortbestimmung 48
2.1 Begriffsbestimmung 48
2.2 Das Verhältnis zu akademischen Forschungsdisziplinen 48
2.3 Die konstituierenden Merkmale 50
3 Theorie und Praxis 52
3.1 Einsatz in komplexen Forschungsprozessen 53
3.2 Aufgaben- und Kompetenzfelder 53
3.3 Stichprobendesign 54
3.4 Erhebungsphase 55
3.5 Auswertung und Analyse 55
4 Gütekriterien und Forschungsethik 56
5 Fazit 58
Literaturverzeichnis 59
Standortbestimmung aus historischer Perspektive 61
1 Einführung 62
2 Das Verhältnis der Marktforscher zur Theorie 63
2.1 Die akademischen Wurzeln der Marktforschung 63
2.2 Die langsame Abkehr der Marktforscher von der Theorie 65
2.3 Gründe für den Theorieverlust 67
3 Die Dichotomie qualitativer und quantitativer Marktforschung 70
3.1 Die Ursprünge der Dichotomie 71
3.2 Von den Anfängen qualitativen Forschens bis 1945 72
3.3 Qualitative Marktforschung ohne Identität 74
3.4 Qualitative Marktforschung tritt erstmalig auf den Plan: Motivforschung 75
3.5 Geburtswehen einer Identität 77
3.6 Entwicklung der „Geschwister“ vom Motivforschungsstreit bis heute 78
4 Fazit 81
Literaturverzeichnis 82
Teil B: Wissenschaftliche Disziplinen und theoretische Grundlagen 86
Psychodynamik 87
1 Einführung 88
2 Der tiefenpsychologische Ansatz der Freudianer 89
3 Exkurs: Neurowissenschaftliche Erkenntnisse 90
4 Der Ansatz der Mythologie nach Jung 91
5 Der Paradigmenwechsel 93
6 Der neue psychodynamische Ansatz in der Marktforschung 94
7 Fazit 96
Literaturverzeichnis 99
Morphologie 100
1 Einführung 101
2 Ursprung und theoretische Wurzeln 102
2.1 Ganzheitspsychologie und F. Sander 102
2.2 W. Dilthey und die Phänomenologie 103
2.3 S. Freud und die Psychoanalyse 103
2.4 „Morphologische Schriften“ von J. W. Goethe 105
3 Die Grundlage: Die Morphologische Psychologie von W. Salber 105
3.1 Entwicklung eigenständiger Konzeptionen 105
3.2 Handlungseinheiten 106
3.3 Wirkungseinheiten 110
4 Morphologische Markt- und Medienforschung 111
4.1 Die Pionierarbeiten 111
4.2 Erweiterung durch die kulturpsychologische Perspektive 112
5 Methodisches Vorgehen 115
5.1 Methode und Verfahren 115
5.2 Morphologische Methode 115
5.3 Präferierte Verfahren 116
5.4 Analysetechniken 117
5.5 Sample 117
5.6 Anwendungsbereiche 118
6 Fallbeispiel Gerolsteiner Naturell: Von der qualitativen An alyse bis zur Entwicklung von Produkt und Kommunikation 119
7 Fazit 124
Literaturverzeichnis 125
Kognitionspsychologie 127
1 Einführung 128
2 Historischer Abriss 128
3 Grundlagen der Kognitionspsychologie 129
3.1 Definition von Kognitionspsychologie 129
3.2 Das Menschenbild in der Kognitionspsychologie 130
3.3 Wissenschaftstheoretische Grundlagen 131
3.4 Angewandte Kognitionspsychologie 136
4 Praktische Relevanz für die qualitative Marktforschung 137
5 Fazit 139
Literaturverzeichnis 140
Soziologie 141
1 Einführung 142
2 Entwicklungslinien der Soziologie 144
3 Soziologie als Grundpfeiler der qualitativen Marktforschungspraxis 146
4 Perspektiven: ein stärkeres soziologisches Profil in der qualitativen Marktforschung 148
4.1 Qualitative Marktforschung aus konsumsoziologischer Perspektive 149
4.2 Biographische Marktforschung 151
5 Fazit 154
Literaturverzeichnis 157
Ethnographie 160
1 Einführung 161
2 Begriffe und ihre Einordnung 161
3 Geschichte und theoretische Wurzeln der ethnographischen Marktforschung 162
4 Ethnographische Marktforschung heute 165
4.1 Der ethnographische Blick 165
4.2 Der Beitrag ethnographischer Marktforschung für das Verständnis von Märkten 166
5 Paradigmen der ethnographischen Forschung 167
6 Beispiele für ethnographische Methoden 169
7 Fazit 171
Literaturverzeichnis 173
Linguistik 175
1 Einführung 176
2 Linguistik und qualitative Marktforschung heute 178
3 Linguistische Formen der Textanalyse: Bereicherung der Auswertungspraxis 179
4 Linguistische Metaforschung: Optimierung der Durchführungspraxis 182
5 Fazit 185
Literaturverzeichnis 186
Semiologie 188
1 Einführung 189
2 Historische Verankerung 189
3 Theoretische Annahmen 191
4 Methoden der Analyse 195
4.1 Hermeneutischer Ansatz 195
4.2 Rhetorischer Ansatz 197
4.3 Essenzieller Ansatz 199
4.4 Semiometrischer Ansatz 200
5 Methoden der Datenerhebung 201
5.1 Expertenanalyse 201
5.2 Exploration mit Verbrauchern 202
6 Fazit 203
Literaturverzeichnis 204
Teil C: Forschungsprozess und Methodenkonzepte 205
Der qualitative Forschungsprozess 206
1 Die Rahmenbedingungen 207
1.1 Der Unterschied zwischen akademischer und angewandter Forschung 207
1.2 Zur Geschichte des qualitativen Paradigmas 209
1.3 Das soziale Umfeld 212
2 Planung von Markt-, Medien- und Sozialforschung 213
2.1 Der Forschungsgegenstand 213
2.2 Literatur und andere Informationsquellen 214
2.3 Der Methodenstreit: qualitativ vs. quantitativ 215
2.4 Die drei Datenformen: Alltags-, qualitative und quantitative Daten 216
2.5 Das Sample 218
2.6 Zeit- und Kostenplanung 219
3 Methoden 220
3.1 Die gegenwärtig verwandten Methoden 220
3.2 Das System der Methoden im Handlungsraum 222
4 Methodologie 225
4.1 Die qualitative Datenform in der akademischen Literatur 225
4.2 Die qualitative Datenform bei den sozialwissenschaftlichen Klassikern 227
4.3 Das Deutungsdilemma 228
4.4 Drei Arten von Methodologien: erklärend,beschreibend, entdeckend 229
4.5 Regeln der heuristischen Methodologie 233
4.6 Vergleich der Methodologien 234
5 Der Forschungsverlauf 235
5.1 Lineare, zirkuläre, dialogische Verläufe 235
5.2 Voruntersuchung und Nachbereitung 238
5.3 Variation/Triangulation 238
5.4 Die Analyse 239
5.5 Die Berichterstattung 242
6 Fazit 244
Literaturverzeichnis 245
Qualitative Stichprobenkonzepte 249
1 Einführung 250
2 Systematik der Stichprobenverfahren 251
3 Absichtsvolle Stichprobenziehung 253
3.1 Datengesteuerte Verfahren der absichtsvollen Stichprobenziehung 254
3.2 Theoriegesteuerte Verfahren der absichtsvollen Stichprobenziehung 256
3.2.1 Qualitative Stichprobenpläne 256
3.2.2 Gezielte Auswahl von Falltypen 259
3.2.3 Gemischte Verfahren der Stichprobenziehung 260
4 Fazit 260
Literaturverzeichnis 262
Qualitative Interviews 264
1 Einführung 265
2 Verfahrensüberblick 266
2.1 Typ 1: Narrative Interviews 267
2.2 Typ 2: Diskursiv-dialogische Interviews 268
2.3 Typ 3: Experteninterviews (akteursspezifische Interviews) 270
2.4 Zwischenfazit 271
3 Interviewverlauf 274
3.1 Kontaktaufnahme/Vorgespräch 274
3.2 Warming-up 275
3.3 Intervieweröffnung 276
3.4 Exposition: Nachfragen/Themen einführen 276
3.5 Interview-unspezifische Momente 279
3.6 Interviewabschluss und Nachgespräch 280
4 Interviewkontext 281
4.1 Interviewsetting 281
4.2 Ansprüche an die Interviewenden 283
4.3 Leitfadeneinsatz 284
4.4 Allgemeine Anmerkungen zur Leitfadenentwicklung 285
4.5 Aufzeichnung, Mitschrift, Prä-/Postskript 286
5 Generelle Überlegungen zu Anwendungsbereichen und Zielgruppen 287
6 Fazit 289
Literaturverzeichnis 291
Gruppendiskussionsverfahren 295
1 Einführung 296
2 Begriffsbestimmung und Abgrenzung 298
3 Der Einsatz von Gruppendiskussionen 299
4 Struktur und Verlauf von Gruppendiskussionen 301
5 Anforderungen an den Moderator 305
5.1 Spezifische Moderationstechniken 308
5.2 Vom Umgang mit Störungen 308
6 Auswahl und Struktur der Teilnehmer 310
7 Räumliche und technische Rahmenbedingungen 312
8 Protokollierung und Auswertung 313
9 Fazit 315
Literaturverzeichnis 316
Qualitative Beobachtungsverfahren 318
1 Einführung 319
2 Einordnung und Abgrenzung 320
2.1 Definition von Beobachtungsverfahren 320
2.2 Klassifikation von Beobachtungsverfahren 321
3 Strukturelle Merkmale 324
3.1 Strategische Aufgabendefinition 325
3.2 Biotik der Untersuchungssituation 326
3.3 Datenerhebung 328
3.4 Datenauswertung 329
3.5 Ergebnispräsentation 331
3.6 Zusammenfassung 331
4 Vor- und Nachteile 332
5 Anforderungen an die Beobachter und Beobachtertraining 335
6 Datenschutz und Anonymität 336
7 Einsatzgebiete in der qualitativen Marktforschung 338
8 Fazit 345
Literaturverzeichnis 346
Indirekte psychologische Methoden 349
1 Einführung 350
2 Die theoretischen Wurzeln in direkter psychologischer Methoden 351
3 Übersicht über indirekte psychologische Methoden 353
3.1 Die Systematik indirekter psychologischer Methoden 353
3.2 Assoziative Verfahren 355
3.3 Projektive Verfahren 357
3.3.1 Ergänzungstechniken 357
3.3.2 Konstruktionstechniken 360
3.3.3 Ausdruckstechniken 363
3.4 Kreative Verfahren 364
3.5 Auswertung und Analyse indirekter Methoden 366
4 Fazit 366
Literaturverzeichnis 368
Implizite Methoden 369
1 Einführung 370
2 Grenzen expliziter Verfahren und Bedeutung impliziter Verfahren 371
3 Die bisherigen impliziten Methoden 372
3.1 Priming 373
3.2 Der IAT (Implicit Association Test) 373
4 Integration impliziter Messverfahren und qualitativer Methodenkonzepte 376
4.1 Projektive Verfahren 376
4.2 Die narrative Exploration 377
4.3 Intuitive Methoden – Erfassung impliziter und expliziter Prozesse 380
5 Fazit 382
Literaturverzeichnis 383
Qualitative Online-Forschung 386
1 Der Stellenwert qualitativer Online-Methoden 387
2 Qualitative Online-Befragung 388
3 Qualitative Beobachtung 395
4 Dokumentenanalyse 398
5 Fazit 400
Literaturverzeichnis 401
Auswertung & Analyse qualitativer Daten
1 Einführung 406
2 Konstituierende Merkmale 407
3 Dokumentation 410
4 Der Auswertungsprozess 412
5 Entwicklungslinien und theoretische Verankerung 415
5.1 Verfahren für Einzel- und Gruppenerhebungen 416
5.1.1 Qualitative Inhaltsanalyse 417
5.1.2 Narrativ-biographische und psychodynamische Ansätze 419
5.1.3 Hermeneutische Analyse 421
5.2 Spezifische Verfahren für Gruppenerhebungen 423
5.2.1 Die Konversationsanalyse 423
5.2.2 Die Diskursanalyse 424
6 Auswertung nonverbaler Daten 426
6.1 Körpersprache im Kontext verbaler Daten 427
6.2 Nonverbale Daten bei indirekten Erhebungen 427
6.3 Analyse von Beobachtungsdaten 428
7 Computergestützte Analyse 429
8 Fazit 430
Literaturverzeichnis 432
Teil D: Anwendungsfelder 434
Innovationsforschung 435
1 Einführung 436
2 Der Einsatz von Kreativitätstechniken in der qualitativen Marktforschung 437
2.1 Historische Entwicklung 437
2.2 Allgemeine Kennzeichnung des Instrumentariums 439
2.3 Kreativitätstechniken mit besonderer Integrationsfähigkeit in die qualitative Marktforschung 440
2. 4 Fallbeispiele der Anwendung von Kreativitätstechniken 442
2.4.1 Hypothesen-Matrix 442
2.4.2 TILMAG-Methode 446
2.4.3 Morphologischer Kasten 449
3 Fazit 452
Literaturverzeichnis 454
Kommunalforschung 456
1 Einführung 457
2 Qualitative Kommunalforschung 458
3 Anwendungsfelder qualitativer Methoden in ausgewählten Bereichen der Kommunalpolitik 460
3.1 Positionierung einer Stadt 460
3.2 Stadtmarketing 461
3.3 Einzelhandel und Kommune 462
3.4 Hochschule und Kommune 463
3.5 Probleme der Standortverlagerung 464
3.6 Wahlkampfwerbung 464
3.7 Kooperative Maßnahmen von Bund, Land und Kommune zur Realisierung kommunaler Ziele 465
3.8 Die Kommune als Bestandteil der Region 466
4 Fazit 467
Literaturverzeichnis 468
Motivforschung 469
1 Einführung 470
2 Wissenschaftliche Grundlagen 471
2.1 Psychologische Konstrukte und Modelle 471
2.2 Das Means-End-Chain-Modell 472
2.3 Die Explorationstechnik Laddering 475
3 Die MotivationsStrukturAnalyse 477
3.1 Methode 477
3.2 Anwendungsbereiche 478
4 Fazit 484
Literaturverzeichnis 485
Politikforschung 486
1 Einführung 487
2 Das Verhältnis von kommerzieller und akademischer Politikforschung 487
3 Historische Entwicklung 488
4 Anforderungen an die kommerzielle qualitative Politikforschung 490
5 Besonderheiten bei der Anwendung qualitativer Methoden in der kommerziellen Politikforschung 492
5.1 Besonderheiten der Stichprobe 493
5.2 Besonderheiten im Erhebungsprozess 494
6 Fazit 495
Literaturverzeichnis 497
Usability-Forschung 498
1 Einführung 499
2 Usability als Gegenstand – wider die scheinbare Einfachheit 500
2.1 Usability – kein technisches Forschungsfeld 500
2.2 Usability – abhängig vom historischen und räumlichen Kontext 501
2.3 Usability-Forschung beschränkt sich nicht auf Website-Optimierung 502
3 Methoden der Usability-Forschung –viele Wege führen nach Rom 504
3.1 Usability-Forschung als Anwendungsbereich qualitativer Forschung 504
3.2 Qualitative Usability-Forschung ist in allen Phasen der Website-Entwicklung sinnvoll 505
3.3 Raum und Situation beeinflussen den Charakter der Erhebung 506
3.4 Spezielle Tools erweitern das Spektrum herkömmlicher qualitativer Techniken 507
4 Qualitative Methode und Usability-Forschung – Dialog von Theorie & Praxis
4.1 Qualitative Methoden bieten der Usability-Forschung ein umfassendes Fundament 508
4.2 Techniken der Usability-Forschung als Potenzial für qualitative Methoden 509
5 Fazit 509
Literaturverzeichnis 510
Werbewirkungsforschung 511
1 Einführung 512
2 Werbung und das Konstrukt der Werbewirkung 512
3 Zur Entwicklung der Werbewirkungsforschung 514
4 Methodische Besonderheiten der Werbewirkungsforschung 517
5 Zielsetzungen quantitativer und qualitativer Ansätze innerhalb des Prozesses der Werbewirkungsforschung 518
6 Zur qualitativen Exploration von Werbewirkungsdimensionen 520
7 Untersuchung der Wirkungszusammenhänge 524
8 Fazit 525
Literaturverzeichnis 526
Zielgruppe Kinder 528
1 Einführung 529
2 Entwicklungsphasen der Zielgruppe 530
2.1 Sensomotorisches Stadium (0-2 Jahre) 531
2.2 Präoperationales Stadium (2-7 Jahre) 531
2.3 Konkretoperationales Stadium (7-11 Jahre) 532
2.4 Formaloperationales Stadium (11-16 Jahre) 533
3 Auswirkungen auf die Praxis 533
3.1 Die Untersuchungssituation 534
3.2 Die Rolle des Moderators/Interviewers 534
4 Die wichtigsten Erhebungsverfahren 535
4.1 Die Beobachtung 536
4.2 Einzel- oder Paar-Interviews 536
4.3 Psychologische Gruppenveranstaltungen 537
4.4 Einzelne Techniken und ihre Anwendung 538
4.5 Vermeidbare Fehlerquellen 539
5 Fazit 540
Literaturverzeichnis 541
Zielgruppe Mitarbeiter 542
1 Einführung 543
2 Perspektivwechsel 544
2.1 Personalbezogene Marktforschung 544
2.2 Personalmarketing 545
2.3 Personalführung 546
3 Anwendungen 549
3.1 Prämissen 549
3.2 Workshop 551
3.3 Gespräch 554
4 Fazit 559
Literaturverzeichnis 561
Zukunftsmanagement 563
1 Einführung 564
2 Differenzierung von Zukünften als methodische Basis 565
3 Anwendung qualitativer Methoden im Zukunftsmanagement 567
3.1 Zukunftsradar: Information über mögliche Zukünfte erfassen 567
3.2 Annahmenanalyse: die wahrscheinliche Zukunft verstehen 568
3.3 Chancenentwicklung: die machbare Zukunfterfinden 569
3.4 Visionsentwicklung: die gewünschte Zukunft bestimmen 570
3.5 Überraschungsanalyse: der überraschenden Zukunft vorbeugen 571
3.6 Strategieentwicklung: die zu schaffende Zukunft planen 573
4 Fazit 573
Literaturverzeichnis 574
Teil E: Branchenspezifische Anforderungen 576
Die Automobilbranche 577
1 Einführung 578
2 Dem subjektiven Produkterlebnis qualitativ auf der Spur 580
3 Die Rolle des Marktforschers: Experten-und Konsumentensicht vereinen 581
4 Das Methoden-Portfolio: auf ein hochkomplexes Produkt zugeschnitten 582
5 Autofahrer ist nicht gleich Autofahrer: die Zielgruppen 586
6 Fazit 588
Literaturverzeichnis 589
Fast Moving Consumer Goods 590
1 Einführung 591
2 Der Verbraucher und sein Kaufentscheidungsprozess bei FMCG 592
3 Die Anbieter von FMCG und ihre Akteure 593
4 Exkurs: Das Marktforschungsartefakt 594
5 Qualitative Marktforschung als Problemlöser 597
6 Verknüpfung qualitativer und quantitativer Marktforschungsansätze 598
7 Fazit 598
Literaturverzeichnis 599
Die Dienstleistungsbranche 600
1 Einführung 601
2 Dienstleistungen als zentraler Forschungsgegenstand 602
2.1 Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft 602
2.2 Charakteristische Merkmale einer Dienstleistung 603
3 Der Einsatz qualitativer Marktforschung im Dienstleistungsbereich 605
3.1 Herausforderungen und typische Anwendungssituationen 605
3.2 Empfehlungen aus der Marktforschungspraxis 608
4 Fazit 610
Literaturverzeichnis 611
Der Handel 613
1 Einführung 614
2 Der Weg von der quantitativen Absatzzur qualitativen Kundenforschung 615
3 Inhalte und Ziele qualitativer Marktforschung im Handel 616
3.1 Handelsmarketing und Handelsmarktforschung 617
3.2 Trade Marketing und Trade-Marketing-Forschung 618
3.3 Category Management und Category Management Forschung 618
4 Qualitative Methoden für die Marktforschung im Handel 619
4.1 Qualitative Forschungsmethoden in der Vorund Nach-Kaufphase 620
4.2 Besonderheiten bei der Erforschung der Kaufphase im engeren Sinne 620
4.3 Adaption qualitativer Forschungsmethoden für den POS 621
4.4 Grenzen der qualitativen Forschung am POS 623
5 Fazit 623
Literaturverzeichnis 624
Der Pharmamarkt 626
1 Einführung 627
2 Stellenwert qualitativer Methoden im Pharmamarkt 627
3 Besonderheiten der qualitativen Pharmamarktforschung 630
3.1 Datenschutz 630
3.2 Stichprobe 630
3.3 Erhebung 631
3.4 Analyse und Interpretation 632
4 Fazit 633
Literaturverzeichnis 634
Teil F: Internationale qualitative Marktforschung 635
Theoretische Forschungsperspektive: global vs. lokal 636
1 Einführung 637
2 Anforderungen an internationale qualitative Marktforschung 637
3 Zum Selbstverständnis qualitativer Marktforscher 638
4 Zum Gegenstandsverständnis internationaler qualitativer Forschung 639
5 Forschungsdesign: global vs. lokal 640
5.1 Stichprobe und Rekrutierung 641
5.2 Methoden 641
5.3 Techniken 642
5.4 Analyse 643
6 Fazit 645
Literaturverzeichnis 646
Praktische Durchführung: zentral vs.dezentral 647
1 Einführung 648
2 Die Organisation von internationalen qualitativen Studien 648
2.1 Hauptmerkmale zentraler Organisation 648
2.2 Hauptmerkmale dezentraler Organisation 649
2.3 Entscheidungsdeterminanten für zentrale oder dezentrale Organisation 650
2.3.1 Die Struktur des auftraggebenden Unternehmens 650
2.3.2 Methodische Aspekte 651
2.3.3 Praxisorientierte Anforderungen 651
3 Vor- und Nachteile zentraler und dezentraler Durchführung in einzelnen Phasen des Untersuchungsprozesses 652
3.1 Das Briefing 652
3.2 Das Angebot 653
3.3 Rekrutierungsleitfaden (Screener) 654
3.4 Diskussionsleitfaden 654
3.5 Die Erhebung 656
3.6 Analyse und Ergebnisbericht 657
4 Fazit 659
Literaturverzeichnis 660
Stichwortverzeichnis 661
Personenregister 665
| Erscheint lt. Verlag | 16.6.2011 |
|---|---|
| Co-Autor | Bernad Batinic, Florian Bauer, Renate Blank, Julia David, Natacha Dagneaud, Christine Garnier, Richard Gehling, Timo Gnambs, Gert Gutjahr, Gábor Hahn, Brigitte Holzhauer, Werner Kaiser, Edeltraud Kaltenbach, Verena Kanther, Rolf Kirchmair, Gerhard Kleining, Marina Klusendick, Kay-Volker Koschel, Henry Kreikenbom, Thomas Kühn, Franz Liebel, Jens Lönneker, Jörg Maas, Maryse Mappes, Petra Mathews, Günter Mey, Pero Micic, Alexandra Miller, Katja Mruck, Karsten Müller, Christin de Panafien, Dieter Pflaum, Stephan Polomski, Claudia Puchta, Jutta Rietschel, Olaf Rüsing, Michael Siewert, Uta Spiegel, Margit Schreier, Anja Schweitzer, Maxi Stapelfeld, Tammo Straatmann, Manfred Zerzer |
| Zusatzinfo | XXVI, 691 S. 107 Abb. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Marketing / Vertrieb |
| Schlagworte | Datenerhebung • Internationale Marktforschung • Kommunikationsforschung • Marktforschung • Psychologische Marktforschung |
| ISBN-10 | 3-8349-6790-4 / 3834967904 |
| ISBN-13 | 978-3-8349-6790-9 / 9783834967909 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 5,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich