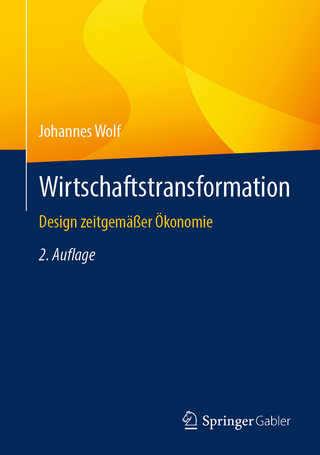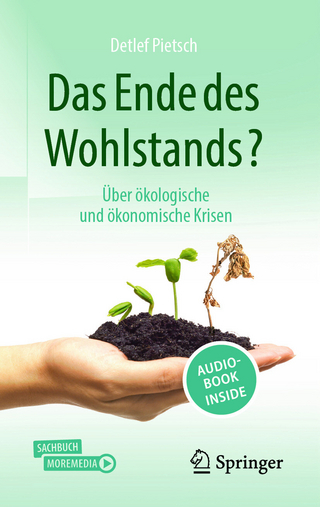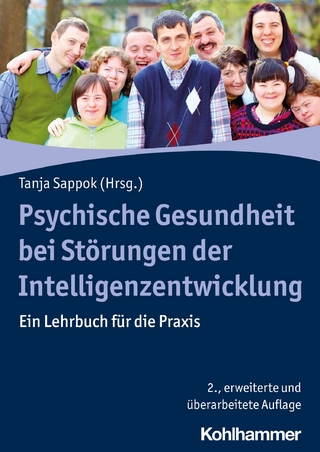Soziologie in der Stadt- und Freiraumplanung (eBook)
VII, 384 Seiten
VS Verlag für Sozialwissenschaften
978-3-531-92010-8 (ISBN)
Dr. Annette Harth und Priv. Doz. Dr. Gitta Scheller sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Institut für Freiraumentwicklung der Fakultät für Architektur und Landschaft an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover.
Dr. Annette Harth und Priv. Doz. Dr. Gitta Scheller sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Institut für Freiraumentwicklung der Fakultät für Architektur und Landschaft an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover.
Inhalt 5
Einführung 8
Literatur: 23
I SOZIOLOGIE IN DER STADT- UND FREIRAUMPLANUNG:ENTWICKLUNGEN, PERSPEKTIVEN, PLÄDOYERS 24
Stadtsoziologie und Planungsbezogene Soziologie:Entwicklungen und Perspektiven 24
1 Zur institutionellen Verankerung der Stadtsoziologie an deutschenHochschulen 25
2 Ursachen für den Rückgang 32
zu a) Stadtsoziologie im Kontext des soziologischen Diskurses 32
zu b) Stadtsoziologie im Kontext der Stadt- und Freiraumplanung 37
3 Diskussion: Mögliche Konsequenzen der De-Institutionalisierung 40
Literatur: 47
Stadtsoziologie und Planung – Notizen zu einemzunehmend engen und ambivalenten Verhältnis 50
1 Die Geschichte der Stadtsoziologie ist die Geschichte der Stadt 50
2 Die Kulturalisierung der Planung 53
3 Die Pädagogisierung der Planung 54
4 Die Versozialwissenschaftlichung der Planung 55
5 Das Veralten der Stadtplanung – neue Aufgaben fürSozialwissenschaftler 58
6 Soziologie und Planung – ein gespanntes Verhältnis 59
Literatur: 65
Soziologie und Räumliche Planung. Zur Notwendigkeit des Wissens über die gesellschaftlicheRaumproduktion und Geschlechterkonstruktionen 67
Raumproduktion und Geschlechterkonstruktionen 69
Gender Mainstreaming 73
Öffentlichkeit und öffentliche Räume 74
Lebensstile und demographischer Wandel 76
Migration und „Transnationale Räume“ 78
Identität und Raumproduktion 80
Literatur: 81
Die letzten Mohikaner? Eine zögerliche Polemik 84
Vorbei? 84
Es war einmal… 85
Missverständnisse und mehr 86
Neue Zeiten 88
Wollen wir das denn wirklich wissen! 89
II BEISPIEL FREIRAUMPLANUNG UND LANDSCHAFTSARCHITEKTUR: DIE INTEGRATION SOZIALER ASPEKTEUND SOZIOLOGISCHER INHALTE 93
Soziale und sozialwissenschaftliche Orientierungen beiVorläufern der Freiraumplanung 93
Zu sozialen Orientierungen in der kommunalen Freiraumplanung 95
Sanierung und Freiräume 98
Thermenpalast - die Vision eines sozial ausgerichteten Freizeitbades in den1920er Jahren 101
Gartendenkmalpflege und soziale Ansätze 103
Beispiele eines sozial orientierten Naturschutzes –Der Ruhrsiedlungsverband 104
Hans Klose und eine soziale Orientierung im Naturschutz 106
Moderner urbaner Naturschutz in Frankfurt am Main 108
Die Berliner Stadtplanung und der Naturschutz 108
Naturschutz, soziale Orientierung und Gesetzgebung 110
Soziale Orientierungen in der traditionellen Naturschutzbewegung: derVerein Naturschutzpark e. V. 112
Zur Zerstörung sozialer Ansätze in freiraumplanerischen Aufgabenfelderndurch den Nationalsozialismus 114
Literatur: 115
Anmerkungen zum Versuch, Sozialwissenschaften in die Ausbildung von Landschaftsarchitekten zuintegrieren 119
I 119
II 120
III 121
IV 124
V 125
VI 126
VII 127
Literatur: 131
Wachsende sozialpolitische Herausforderungen fürdie Landschaftsarchitektur 134
Heutige Renaissance des Gesellschaftlichen 136
Sozialpolitische Herausforderungen für die Landschaftsarchitektur 141
III DER ‚GEBRAUCHSWERT’ VON SOZIOLOGIE AUS SICHTDER PLANUNGS- UND ENTWURFSPRAXIS 145
Theorie für die Praxis? Untersuchungen einerschwierigen Beziehung 145
1 Planer und Nutzer, Profis und Laien: Was wissen die einen von denanderen und worauf stützen sie ihr Wissen? 146
Plausibilität, Spekulation, Ichbezug 147
Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung 148
Nutzer, Auftraggeber und Marktkenntnis 149
Studium, Fortbildung und Fachliteratur 149
Zwei Welten 151
2 Nach dem Studium: Welche Bedeutung messen Absolventinnen undAbsolventen der „Theorie“ für ihre Arbeit in der Praxis bei? 152
Erst in der Praxis… 153
„Theorie“ – ein Missverständnis 154
„Der praktische und der theoretische Städtebau“ 155
Wie zusammenfinden? 156
Theorie und Praxis in den Planungswissenschaften – schon lange eineschwierige Beziehung 157
3 Was bleibt? Was folgt? 158
Theorie - wozu? 159
Theorie-Praxisaustausch als notwendiger Lernprozess 160
Literatur: 161
Das Spiel von Angebot und Nachfrage in derstädtischen Freiraumplanung 163
Bestimmende Nachfrage 163
Angebotsorientierung der kommunalen Freiraumplanung 164
Annäherung der Nachfrage an das Angebot 167
Erläuternde Beispiele 168
Fragen 170
Literatur: 170
Zum Stellenwert sozialwissenschaftlicher Analysenund Methoden im Alltag von Freiraumplanungsbüros 172
1 Kleingartenkonzeption Bremen – Sozialempirische Erkenntnisse alsBasis für Planungsempfehlungen 173
Revision des Richtwertes 178
Marketing 179
Kleingartenentwicklungs-Management 179
2 Integriertes Handlungskonzept „Soziale Stadt“ Espelkamp –Planungskonzept mit sozialwissenschaftlicher „Aufladung“ 180
Schwerpunkt 2007 – Stadtteil Gabelhorst 183
Schwerpunkt 2008: Anger Ost 184
Schwerpunkt 2009: Anger West 184
3 Marktplatz Detmold – Konsensbildungsverfahren zur künftigenGestaltung 185
4 Resümee 188
Literatur: 189
Die Entwerfer und die Menschen 191
1 Entwurf neuer Portraits zeitgenössischer Kulturlandschaften -Forschungsprojekt „Einblenden“ 192
2 Menschen entwerfen – Studienprojekt „Texas“ 196
2.1 „Garten für einen Modezar“ (Daniel Stimberg) 197
2.2 „Zoé’s Garten” (Chloé Sanson) 198
3 Entwurf neuer Charaktere und ihre zukünftige Kulturlandschaft -Internationale Summer School „Old Country for new men“ 199
4 Ausblick 204
Literatur: 204
Der soziologische Beitrag zum Entwerfen urbaner Landschaften. Ein Essay 206
1 Ein Blick auf 1968ff 206
2 Raumverständnis als (urbanes) Raumgeschehen 210
3 Entwerfen als Verstehensprozess 211
3.1 Fragen und Aufgaben erfinden – die Idee steht am Anfang 213
3.2 Verstehen von Fragen, Aufgabe und Idee 214
3.3 Arbeiten in verschiedenen Maßstäben – oder: keine maßgeschneiderten Produkte 217
3.4 Umsetzen – fest gefügt oder Möglichkeitsraum? 219
3.5 Evaluieren: Ernst-August-Platz – eine Schnelldiagnose als Zukunftsaufgabe 220
Literatur: 222
IV DER BEITRAG DER SOZIOLOGIE:KONZEPTE, ANALYSEN UND BEFUNDE 224
Der „lokale Lebenszusammenhang“ alsstadtsoziologische Kategorie 224
1 Zum Begriff des „lokalen Lebenszusammenhangs“ 225
2 Bedeutung des „lokalen Lebenszusammenhangs“ in ausgewähltenstadtsoziologischen Studien 228
2.1 Zu lokalen Lebenszusammenhängen in der neuen Stadt Wolfsburg 228
2.2 Lebenszusammenhänge in Städten und Stadtvierteln in Ostdeutschland nachder Wende 231
3 Konsequenzen für die zukünftige Berücksichtigung des „lokalen Lebenszusammenhangs“ 234
Literatur: 237
Jenseits der Werkästhetik – Wulf Tessins ‚Ästhetik des Angenehmen’ als Beitrag zu einem neuenVerständnis von Landschaftsarchitektur 240
Die Angst vor dem schlechten Geschmack 241
Plädoyer für ein rezeptionsästhetisches Entwurfsverständnis 244
Anwendungsprobleme? 246
Muss immer alles angenehm sein? 247
Alles gar nicht so heiß? 249
Versöhnliche Töne 251
Literatur: 254
Freiraumkulturmanagement – zum Reiz einessperrigen Begriffs 255
1 Das anspruchsvoll Machbare: Freiraumkultur als Ingenieurskunst 256
Das Beispiel: Saarbrückens neue Stadtmitte am Fluss 257
2 Das gesellschaftlich Gewünschte: Freiraumkultur als alltäglicheAneignung von Freiraum und Inszenierung des Lebens in der Stadt 258
Das Beispiel: Inszenierung von Lebenskunst im Saarbrücker Stadtleben 259
3 Das politisch Umsetzbare: Freiraumkultur als demokratischeHerausforderung 261
Das Beispiel: Saarbrückens Zivilgesellschaft 263
4 Fazit: Elemente eines freiraumkulturbezogenenPlanungsverständnisses 265
Verzweifelt gesucht: Freiraumkulturmanagerin/-manager 268
Literatur: 270
Innovation in der Stadtplanung? 272
1 Verlaufslogik – Phasierung des Innovationsprozesses 277
2 Organisatorische Dimension: Strukturen der Innovation in derStadtplanung 279
3 Symbolische Dimension: Verdichtung von innovativen Konzepten zuLeitbildern 282
Schlussbemerkungen 282
Literatur: 283
Stadtwohnen 285
Der Abschied von der umgrenzten Bürgerstadt um 1800 286
Der Bau kompakter urbaner Stadterweiterungen seit der Mitte des 19.Jahrhunderts 287
Neue urbane Stadtteile aus einem Guss um 1900 290
Der ideologische Kampf gegen das Stadtwohnen vor dem Ersten Weltkrieg 294
Dezentralisierter Reformwohnungsbau nach dem Ersten Weltkrieg,Abkoppelung von den benachbarten europäischen Ländern 295
Großstadtfeindschaft im Nationalsozialismus… 297
…und im Wiederaufbau (West) 297
Wiederentdeckung der Qualitäten der historischen Stadt seit Mitte der1970er Jahre 299
Seit den 1990er Jahren: Renaissance des Leitbilds der kompakten, sozialund funktional gemischten europäischen Stadt und neue Trägerformen 299
Neue urbane Gebäudetypen – in Konkurrenz mit dem eigenen Umland odermit anderen Metropolen? 301
Neue soziale Polarisierungen 303
Neues Stadtwohnen – alles andere als ein Selbstläufer 304
Literatur: 305
Welche soziale Mischung in Wohngebieten? 307
1 Problem 307
2 Empirische Befunde 308
Dimensionen 309
Mischung der Dimensionen 310
Räumliche Einheit 311
Soziale Folgen 312
Planerische Eingriffe 313
3 Folgerungen 316
Ein Nachwort 318
Literatur: 318
Die Wolfsburg-Forschungen als Beispiel für Wandelund Kontinuität der empirischen Stadtsoziologie 323
1 Zentrale Befunde der vier soziologischen Wolfsburg-Studien 325
1.1 Stadtwerdung und Urbanität 325
1.2 Soziale Integration 328
1.3 Verhältnis Volkswagen – Stadt 330
2 Die Wolfsburg-Studien im Kontext der stadtsoziologischen Diskussion 333
3 Umgang mit der Frage des Planungsbezugs 338
4 Bedeutung der Wolfsburg-Forschung für die Stadt- undPlanungsbezogene Soziologie 342
Literatur: 345
Zur Relevanz des Gebrauchswerts von Freiräumen 350
1 Öffentlich nutzbare Freiräume – Das Beispiel Parkanlagen 351
1.1 Ältere Menschen im Park 352
1.2 Männer und Frauen im Park 355
2 Freiräume im (Geschoss-) Wohnungsbau – Freiräume in Siedlungen 357
2.1 Anforderungen an Freiraumqualität 358
2.2 Gründe für mangelnde Freiraumqualität 359
2.3 Perspektiven 360
3 Privat und gemeinschaftlich genutzte Gärten – Neue Garteninitiativen 360
Fazit 365
Literatur: 365
Potenziale und Grenzen multifunktionalerLandnutzung am Beispiel Hannover-Kronsberg 368
1 Einleitung 368
2 Die Umgestaltung des Kronsberges zu einer multifunktionalenLandschaft 370
3 Ergebnisse der Begleitforschung 371
4 Schlussfolgerungen 374
Literatur: 377
| Erscheint lt. Verlag | 1.11.2010 |
|---|---|
| Zusatzinfo | VII, 384 S. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie | |
| Schlagworte | Freiraum • Raum • Soziologie • Stadtforschung • Stadtplanung • Stadtsoziologie • Urbanistik • Versozialwissenschaftlichung |
| ISBN-10 | 3-531-92010-3 / 3531920103 |
| ISBN-13 | 978-3-531-92010-8 / 9783531920108 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich