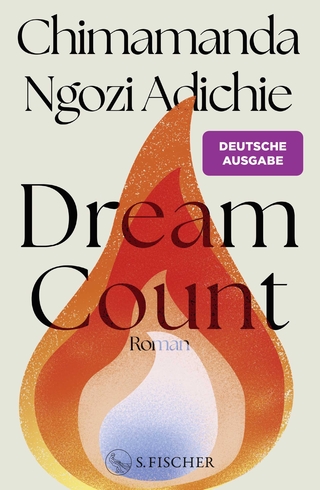Aprilwetter (eBook)
224 Seiten
Piper Verlag
978-3-492-95102-9 (ISBN)
Thommie Bayer, 1953 in Esslingen geboren, studierte Malerei und war Liedermacher, bevor er 1984 begann, Stories, Gedichte und Romane zu schreiben. Neben anderen erschienen von ihm die Romane »Das Glück meiner Mutter«, »Das innere Ausland« und der für den Deutschen Buchpreis nominierte Roman »Eine kurze Geschichte vom Glück«.und zuletzt »Einer fehlt«. Thommie Bayer lebt mit seiner Frau in Staufen bei Freiburg.
Thommie Bayer, 1953 in Esslingen geboren, studierte Malerei und war Liedermacher, bevor er 1984 begann, Stories, Gedichte und Romane zu schreiben. Neben anderen erschienen von ihm "Die gefährliche Frau", "Singvogel", der für den Deutschen Buchpreis nominierte Roman "Eine kurze Geschichte vom Glück" und zuletzt "Das innere Ausland".
Daniel ist noch immer nicht zu erreichen, nur der Anrufbeantworter meldet sich, also nimmt Benno ein Handtuch über die Schulter, packt die Tramezzini und die Badehose in eine Plastiktüte und zieht die Tür hinter sich ins Schloss. Einen Moment überlegt er, ob er die Treppe hochsteigen und an der Wohnungstür klingeln soll, aber dann nimmt er den Weg nach unten und klingelt an der Haustür.
Es ist wie im Stau oder an der Supermarktkasse, man entscheidet sich immer für die falsche Schlange. Er hört ihre Stimme durch die Sprechanlage: »Kannst du hochkommen?« Sie klingt klein und matt.
»Was ist los?«, fragt er an der Tür, ein bisschen außer Atem, denn er hat sich beeilt und zwei Stufen auf einmal genommen. Sie sieht blass aus. »Ich bin irgendwie krank«, sagt sie, »ich glaub, ich kann nicht zum See.«
»Willst du allein sein?«
»Nein.«
Sie hat sich beim Joggen einen Sonnenstich eingefangen, hat leichtes Fieber und Kopfweh, alle Jalousien sind heruntergelassen, die ganze Wohnung ist helldunkel gestreift. Sie streckt sich auf dem Sofa aus, nimmt ein feuchtes Tuch und legt es auf ihr Gesicht. »Bleibst du ein bisschen da?«, fragt sie, und es klingt wieder so klein und ängstlich wie eben durch die Sprechanlage. »Ich werd kindisch, wenn ich krank bin. Ich will nicht allein sein.«
»Soll ich dir was vorlesen?«
»Nein. Nur da sein. Und reden.«
Aber sie reden nichts. Benno sitzt im Sessel und schaut sich die Lichtstreifen auf dem Boden an, Christine liegt da, streckt irgendwann ihre Hand aus nach ihm, er sieht es, nimmt die Hand und hält sie eine Weile, bis ihm der Arm von der ungewöhnlichen Haltung wehtut und er wieder loslässt.
»Tut mir gut, dass du da bist«, sagt sie.
Und dann vergehen wieder Minuten, in denen sich Benno die Stille anhört – es ist keine wirkliche Stille, denn von draußen dringen ein paar Verkehrsgeräusche und hin und wieder Stimmen herein, aber entfernt, durch ein gekipptes Fenster in einem anderen Raum, Daniels zukünftigem Arbeitszimmer, in dem bis jetzt nur Schreibtisch und Regale stehen und Kartons voller Bücher und CDs.
»Ist das da unten ein Versteck?«, fragt sie und hebt dafür das Tuch auf ihrem Gesicht an.
»Jede Wohnung ist ein Versteck«, sagt Benno.
»Nicht die Wohnung, das Café.«
»Da bin ich doch den ganzen Tag unter Leuten.«
»Die alle nichts von dir wollen.«
Er sagt nicht, was ihm auf der Zunge liegt, nämlich: doch, sie wollen Kaffee, denn sie hat ja recht. In der kurzen Zeit, die sie jetzt hier ist, hat sie erfasst, worum es geht: sich zu schützen, zu maskieren, den Neuanfang nicht zu gefährden und in einer Art Energiesparmodus durchs Leben zu kommen. Sie legt das feuchte Tuch zur Seite.
»Worauf willst du eigentlich raus?«, fragt Benno und weiß gleichzeitig, dass er die Antwort nicht hören will. Aber jetzt sind sie schon da gelandet, jetzt geht es nur noch vorwärts wieder raus aus der Enge dieses Wortwechsels, der Ecke, in die sie ihn mit dieser Frage manövriert hat – das Inquisitorische an ihr ist neu, denkt er, das hatte sie früher nicht.
»Du kommst mir vor wie abgeschaltet, wie auf Standby«, sagt sie leise, »oder wie auf der Flucht. Wie einer, der sich nicht erlaubt, die Nase aus dem Fenster zu stecken, weil er fürchtet, entdeckt oder erkannt oder verhaftet zu werden.«
Er schweigt und wartet auf den Rest der Beschreibung. Nicht lange. Sie schaut zur Decke, knüllt das Tuch in ihrer Hand – es ist nicht mehr so feucht, dass Tropfen austreten würden, dann streckt sie ihre andere Hand wieder nach ihm aus, er will gerade danach greifen, da zieht sie sie zurück und streift sich damit eine Strähne aus der Stirn.
»Du lebst wie jemand, der aus einer anderen Welt kommt. Oder aus einer anderen Zeit. Kein Computer, kein Auto, kein Handy, kein Anrufbeantworter, nicht mal Musik hast du bei dir. Außer der natürlich, die du selber machst. Daran ist es mir auch aufgefallen. Gestern Nacht, als du dieses schöne Stück gespielt hast, und ich hab’s ganz leise, nur durch den Boden gehört, da hab ich so was wie deine Seele gehört. Ich weiß kein besseres Wort dafür, falls du den Ausdruck kitschig findest, musst du das jetzt halt mal verzeihen. Es war wie in einer Zeitmaschine, ich war wieder dort bei euch beiden, im Studio, in Frankreich, im grünen Haus – eure Musik ging einem sofort ins Innere, ohne Umweg über den Kopf, man hat sich reich gefühlt und war bewegt und wusste gar nicht, ob nun fröhlich oder traurig oder ergriffen oder was weiß ich, man war sofort in einer eigenen Welt, wenn ihr nur ein paar Takte gespielt habt. So war’s gestern Abend auch, ich war wieder in dieser Welt. Ich nenne das deine Seele.«
Er schweigt.
»Ich glaube, du bist traurig und versuchst auf eine stoische und deine eigene Traurigkeit nicht ernst nehmende Art, damit umzugehen.«
»Ich brauch kein Handy«, sagt er, »und ich brauch keinen Computer. Was soll das? Wieso ist was falsch an mir, wenn ich dieses Zeug nicht benutze?«
Sie lässt sich nicht beirren von dieser unaufrichtigen Antwort, die sich am Symptom festbeißt, um von der Ursache abzulenken. Sie spricht weiter, konzentriert und nachdenklich, so als müsse sie die Gedanken erst suchen und sortieren: »Das mit der Seele hab ich gemerkt, als Daniel versuchte, ohne dich weiterzumachen. Er hat noch zwei Alben aufgenommen, war auf Tour mit sehr guten Musikern, hat sehr schöne Stücke gemacht, aber er hat genau gespürt, dass er ohne dich weniger als die Hälfte war, die Musik war schön und nichts weiter. Nur schön. Weil du nicht drin warst, war die Seele nicht drin, das, was einem so direkt in die Mitte reingegriffen hat. Dein Stück gestern Abend hat das. Daniels Stücke hatten das nicht. Er hat deswegen aufgehört. Er hat gemerkt, dass er nur mit dir zusammen was Besonderes war, ohne dich war’s nur noch hübsch, er sagte, wie ein Rahmen ohne Bild oder wie ein Bild ohne Figuren – das hat ihm nicht gereicht. Ich weiß nicht, ob es ihm immer noch fehlt, ob er sich danach sehnt, wieder der Musiker zu sein, der er mal war, ich glaub’s eigentlich nicht, er kommt mir lebendig und zufrieden vor, aber mir hat’s gestern Abend schier das Herz zerrissen, als ich dich spielen hörte und dachte, wenn Daniel jetzt hier wäre, dann würde er heulen und nicht mehr aufhören damit.«
Sie schweigt einen Moment lang, aber Benno weiß, dass sie noch nicht am Ende ist, er wartet. Und sie spricht weiter.
»Du bist ein Musiker. Du musst Musik machen. Du bist derjenige von euch beiden, der den Inhalt hatte. Daniel hatte nur was zur Form beizutragen.«
»Wieso denkst du so nach über mich?«, fragt er hilflos und noch immer auf der Suche nach einem Ausweg aus dieser Verhörsituation, inzwischen sogar eher einer Urteilsverkündung, der er sich weder gewachsen fühlt, noch gewillt ist, dem Druck einfach nachzugeben.
»Das tu ich, seit du weg bist«, sagt sie, »seit vierzehn Jahren.«
—
Ein paar Tage lang geisterten sie im grünen Haus herum wie Gäste, denen man ein falsches Quartier zugewiesen hat. Es ist immer schwer, nach einer Reise wieder zurückzufinden, aber diesmal war es noch schwerer, weil sie sich hier noch nicht eingelebt hatten, weil sie eigentlich noch gar nicht hier sein sollten – die Ferien waren abgebrochen worden – und weil Daniel und Benno nicht zusammen sein wollten. Daniel sagte nichts dergleichen, er benahm sich auch nicht so, dass Benno sicher sein konnte, aber wenn sie nicht probten oder irgendwas zu planen oder besprechen hatten, war er immer woanders, verkrochen in seinem Zimmer, im Garten, irgendwo, und las in einem dicken Fantasyroman, Stein und Flöte oder er tat zumindest so als ob.
Christine war beschäftigt – sie packte ihre Sachen zu Hause und wollte keine Hilfe dabei, erst wenn sie alles beisammen hätte und der Transport dran sei, sagte sie. Im grünen Haus herrschte Leerlauf immer dann, wenn sie nicht da war.
Benno fragte sich immer wieder, ob Daniel mit Christine geschlafen hatte, aber er fragte nur sich, nicht Christine, nicht Daniel. Waren sie zu dritt, dann versuchte er, aus ihrem Verhalten zu lesen, aber es blieb wie in Frankreich: Christine war inzwischen die Verbindung zwischen ihnen geworden – war sie da, war alles einfach und fühlte sich richtig an –, sie zog Daniel nicht vor, separierte sich weder mit ihm noch mit Benno, hielt den Kontakt immer zu beiden lebendig, und in diesen Momenten fühlte sich Benno auch wie früher eins mit Daniel, wusste, was der dachte, wollte, fühlte oder fürchtete, und wusste, dass es Daniel genauso ging. Christine war eine Art Adapter geworden für die Benno-Daniel-Einheit, die bisher ohne funktioniert hatte.
Und sie strebte keinen anderen Zustand an. Wie in Frankreich erlosch ihr Esprit und alles Strahlen, wenn sich für Momente oder Minuten ein Zusammensein zu zweit ergab. Es waren nie längere Zeiträume. Immer nur Momente oder Minuten.
—
Sie schafften es gerade noch, den Umzug zu bewerkstelligen, bevor Christine wieder arbeiten musste. Danach räumten Daniel und Benno ihr Bücherregal ein – sie hatte erstaunlich viele Bücher und nur wenige CDs, zogen eine Rigipswand zwischen ihrem Zimmer und dem Esszimmer ein, strichen sie weiß und hängten ihre Bilder auf, so, wie Christine sie am Abend zuvor an die Wand gelehnt hatte. Als alles fertig war, feierten sie den Einzug mit einem selbst gekochten Essen, bei dessen Zubereitung Christine die Führung übernahm und Benno und Daniel nur die Handlanger abgaben: Ratatouille mit Kartoffeln und Salat und hinterher Eis mit Birnenkompott. Sie deckten den Tisch im Garten und saßen dort mit einer Flasche echtem, teurem Champagner bis tief in die...
| Erscheint lt. Verlag | 4.10.2010 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Benedict Wells • Beziehung • Beziehungsprobleme • Buch • Bücher • Das Herz ist eine miese Gegend • Das innere Ausland • Dreiecksbeziehung • Dreiecksgeschichte • dreier • Eifersucht • Gefühle • Leidenschaft • Liebe • Liebesreigen • Liebesroman • Martin Suter • Roman • Romantik • Sehnsucht • Vertrauen • Wiedersehen |
| ISBN-10 | 3-492-95102-3 / 3492951023 |
| ISBN-13 | 978-3-492-95102-9 / 9783492951029 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich