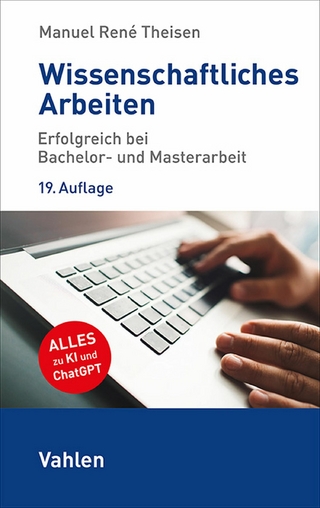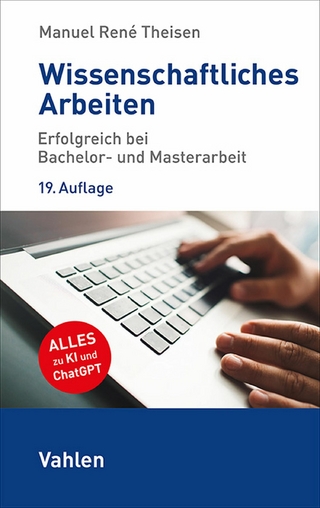Der Ruf von Branchen (eBook)
XXII, 354 Seiten
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-8349-8398-5 (ISBN)
Henrik Hautzinger promovierte am Lehrstuhl für Strategisches Marketing der Universität Witten/Herdecke und ist als International Business Analyst bei einem Pharmaunternehmen in der Schweiz tätig.
Henrik Hautzinger promovierte am Lehrstuhl für Strategisches Marketing der Universität Witten/Herdecke und ist als International Business Analyst bei einem Pharmaunternehmen in der Schweiz tätig.
Geleitwort 6
Vorwort 8
Inhaltsverzeichnis 10
Abbildungsverzeichnis 16
Tabellenverzeichnis 17
Abkürzungsverzeichnis 19
1 Einleitung 22
1.1 Die Relevanz des Branchenund Unternehmensrufs 22
1.2 Forschungsfragen und Eingrenzung der Untersuchung 27
1.3 Aufbau der Arbeit 30
2 Definition, Entstehung und Wirkung der Rufkonstrukte 34
2.1 Der Ruf von Unternehmen 34
2.1.1 Definition von Unternehmensruf 34
2.1.2 Corporate Image, Corporate Identity und Corporate Brand – Abgrenzung der Corporate Reputation von verwandten Konstrukten 38
2.1.3 Identifikation von ökonomischen und vorökonomischen Treibern des Unternehmensrufs 41
2.1.4 Branchenmerkmale als indirekte Treiber des Unternehmensrufs 46
2.2 Der Ruf von Branchen 49
2.2.1 Definition und Klassifikation von Branchen 49
2.2.2 Identifikation der Branche als Rufträger 51
2.2.3 Definition von Branchenruf 53
2.3 Die Rolle der Stakeholder bei der Rufbildung 55
2.3.1 Grundlegende Stakeholderansätze zur Erklärung der Rufbildung 58
2.3.2 Spezifische Stakeholderaspekte im Kontext von Reputation 60
2.4 Der Zusammenhang zwischen Ruf und unternehmerischen Zielgrößen 62
2.4.1 Strategische Zielgrößen einer Unternehmung und Auswirkungen des Rufs 62
2.4.2 Das Wirkungsgefüge von Ruf und unternehmerischen Zielgrößen 66
3 Die Messung der Rufkonstrukte 70
3.1 Generelle Aspekte und Determinanten der Rufmessung 70
3.2 Verschiedene Ansätze zur Messung des Unternehmensrufs 75
3.2.1 AMERICA’S MOST ADMIRED COMPANIES des FORTUNE Magazin 75
3.2.2 Die Imageprofile des MANAGER-MAGAZINs 77
3.2.3 Der GLOBAL REPTRAKTM PULSE des REPUTATION INSTITUTE 78
3.2.4 Der Unternehmensruf nach HELM (2007a) 80
3.2.4.1 Charakteristika und Indikatoren des Messmodells 80
3.2.4.2 Kritische Würdigung des Messansatzes 83
3.3 Der Stand zur Messung des Branchenrufs 84
3.3.1 Industrieökonomische Aspekte zur Messung des Branchenrufs 85
3.3.2 FOMBRUNs (1996) ‚reputational capital’ von Branchen 86
3.3.3 Messansätze für das Branchenimage 87
3.4 Fazit zur Messung des Branchenund Unternehmensrufs 89
4 Wechselwirkungen zwischen Branchenund Unternehmensruf 90
4.1 Der Einfluss des Branchenrufs auf den Ruf einer Unternehmung 91
4.1.1 Wirkungen des Branchenrufs auf ein nicht-diversifiziertes Unternehmen 91
4.1.2 Wirkungen des Branchenrufs auf ein diversifiziertes Unternehmen 97
4.2 Der Einfluss des Unternehmensrufs auf den Ruf einer Branche 103
4.2.1 Möglichkeiten und Grenzen der Einflussnahme auf den Branchenruf durch ein einzelnes Unternehmen 103
4.2.2 Möglichkeiten und Grenzen der Einflussnahme auf den Branchenruf durch eine Gruppe von Unternehmen 110
4.3 Das Wirkungsgefüge von Branchenund Unternehmensruf 113
4.3.1 Erklärungsansätze für die Wirkungsrichtungen der Wechselbeziehung 113
4.3.2 Erklärungsansätze zur Wahrscheinlichkeit, Stärke und Relationen der Wechselbeziehungen 116
4.4 Erste empirische Erkenntnisse zur Wechselbeziehung zwischen dem Branchenund Unternehmensruf 122
4.4.1 Herleitung und Darstellung der Fragestellung zur Wechselbeziehung 122
4.4.2 Ausgestaltung der empirischen Untersuchung zur konzeptionellen Darstellung der Wechselbeziehungen zwischen den Reputationen 124
4.4.3 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse zur direkten Abfrage der Wechselbeziehung 129
5 Konzeptionelle Betrachtung der Branchenund Unternehmensreputation 136
5.1 Neue Institutionenökonomik als Bezugsrahmen 136
5.1.1 Die Principal-Agent-Theorie 136
5.1.1.1 Darstellung der Principal-Agent-Problematik 136
5.1.1.2 Reputation als impliziter Mechanismus in der Principal-Agent-Theorie 138
5.1.2 Die Informationsökonomie als Teilbereich der NeuenInstitutionenökonomik 140
5.1.2.1 Unsicherheit über die Qualität von Gütern 141
5.1.2.2 Abbau von Qualitätsunsicherheit durch Reputation 144
5.2 Neue Industrieökonomik als Bezugsrahmen 149
5.2.1 Reputation als Ressource 149
5.2.2 Der Branchenruf als Common-Pool-Ressource 152
5.2.3 Reputation als Eintrittsbarriere in eine Branche 154
5.2.4 Reputation als Mobilitätsbarriere zwischen Strategischen Gruppen in einer Branche 157
5.3 Fazit zur konzeptionellen Betrachtung 161
6 Die Handlungsrelevanz des Branchenrufs am Beispiel von potentiellen Bewerbern 164
6.1 Die Branche und potentielle Bewerber 164
6.1.1 Bedeutung von potentiellen Bewerbern als Stakeholder 164
6.1.2 Identifikation der Branche im Kontext der Arbeitgebersuche 167
6.2 Determinanten der Entscheidungsfindung von Bewerbern 170
6.2.1 Rolle und Bedeutung des Branchenrufs bei der Bewerbungsentscheidung 170
6.2.2 Rolle und Bedeutung des Unternehmensrufs bei der Bewerbungsentscheidung 177
6.2.3 Rolle und Bedeutung der Arbeitgeberattraktivität bei der Bewerbungsentscheidung 180
6.3 Determinanten der Informationsverarbeitung bei Bewerbern 182
6.3.1 Involvement bei der Arbeitsplatzsuche 182
6.3.2 Wissen über Branche und Unternehmen 187
6.4 Zusammenfassung der Hypothesen 190
7 Empirische Untersuchung zur Handlungsrelevanz des Branchenrufs bei potentiellen Bewerbern 192
7.1 Spezifikation des Strukturgleichungsmodells 192
7.1.1 Das Grundmodell 193
7.1.2 Das erweiterte Modell 194
7.2 Grundlagen der empirischen Untersuchung 194
7.2.1 Untersuchungssubjekte und Untersuchungsgegenstände 195
7.2.1.1 Potentielle Bewerber als Untersuchungssubjekte 195
7.2.1.2 Festlegung der in der Untersuchung betrachteten Branchen 196
7.2.1.3 Festlegung der in der Untersuchung betrachteten Unternehmen 199
7.2.1.4 Zusammenfassung und Wahl des Befragungsdesigns 200
7.2.2 Online-Befragung als Erhebungsmethode und Ablauf der Untersuchung 202
7.2.3 Rekrutierung der Teilnehmerstichprobe und Antwortverhalten 205
7.2.4 Soziodemographische Daten der Stichprobe und Analyse der Datengrundlage 209
7.3 Die Operationalisierung von theoretischen Konstrukten 211
7.3.1 Die Entwicklung eines Messansatzes 212
7.3.2 Die epistemische Beziehung von latenten Variablen 213
7.3.2.1 Formative und Reflektive Beziehung 213
7.3.2.2 Zur Wahl der epistemischen Beziehung 216
7.4 Die Messansätze der empirischen Untersuchung 219
7.4.1 Der Ansatz zur Messung des Branchenrufs 219
7.4.1.1 Definition des Konstrukts 219
7.4.1.2 Itemgenerierung und Vorstudien 220
7.4.1.3 Das Messmodell für Branchenreputation 223
7.4.1.4 Abgrenzung des Branchenrufs vom Unternehmensruf und inhaltliche Besonderheiten 229
7.4.2 Der Ansatz zur Messung des Unternehmensrufs nach HELM (2007a) 231
7.4.3 Der Ansatz zur Messung der Bewerbungsabsicht 232
7.4.4 Der Ansatz zur Messung der Arbeitgeberattraktivität Branche/Unternehmen 234
7.4.5 Determinanten der Einflussstärke 238
7.4.5.1 Die Messung von Involvement 238
7.4.5.2 Die Messung von Wissen 239
7.4.6 Die Skala zur Beurteilung der Items 241
7.5 Güteprüfung des Strukturgleichungsmodells mit dem Partial-LeastSquares(PLS)-Verfahren 242
7.5.1 PLS im Vergleich zur Kovarianzstrukturanalyse 243
7.5.2 Grundlegende Richtlinien der Güteprüfung 245
7.5.3 Gütekriterien und Güteprüfung auf Messmodellebene 247
7.5.3.1 Die formativen Konstrukte 247
7.5.3.2 Die reflektiven Konstrukte 255
7.5.4 Gütekriterien und Güteprüfung auf Strukturmodellebene 258
7.5.5 Gütekriterien und Güteprüfung der zentralen mediierenden Effekte 262
7.5.6 Gütekriterien und Güteprüfung der moderierenden Effekte des erweiterten Modells 265
7.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung 270
7.6.1 Die grundlegenden Ergebnisse der Untersuchung 270
7.6.2 Kritische Würdigung der Untersuchung 276
8 Implikationen für das Reputationsmanagement und weitere empirische Forschung 282
8.1 Implikationen für das Reputationsmanagement von Branchen 282
8.1.1 Grundsätzliche Strategien für das Management der Branchenreputation 282
8.1.2 Branchenstrategien für den Wettbewerb auf dem Bewerbermarkt 286
8.2 Implikationen für das Reputationsmanagement bei Unternehmen 288
8.2.1 Grundsätzliche Strategien für das Management der Unternehmensreputation 288
8.2.2 Unternehmensstrategien für den Wettbewerb auf dem Bewerbermarkt 289
8.3 Ansätze für weiterführende empirische Untersuchungen 291
8.4 Abschließendes Fazit 293
Anhangsverzeichnis 298
Anhang I: Fragebogen zur Wechselbeziehung 298
Anhang II: Fragebogen zur Bewerberbefragung 302
Anhang III: Der Indikatorenpool zum Branchenruf 309
Literaturverzeichnis 310
3 Die Messung der Rufkonstrukte (S. 49-50)
3.1 Generelle Aspekte und Determinanten der Rufmessung
Primäres Ziel jeder Reputationsmessung ist es, die eigentlich nicht greifbare Größe Ruf in eine messbare Dimension zu verwandeln. Auf Basis des Rufsniveaus lassen sich nicht nur rein komparative Aussagen treffen, vielmehr können aus dem Ruf Erklärungen für vergangene und Prognosen über zukünftige Geschäftsentwicklungen abgelesen werden (BROMLEY 1993: 164). Dabei handelt es sich bei der Reputation um eine nicht-finanzielle Größe. Der Informationswert solcher nicht-finanziellen Maßzahlen veranlasste das AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (AICPA) im Jahr 1994 dazu, eine Initiative zu lancieren, die dazu aufforderte „factors that create long term value, including non-financial measures“ in Geschäftsberichte mit aufzunehmen (AICPA 1994: 5).
Damit teilt es die Erkenntnisse von BELKAOUI/COUSINEAU (1977: 341), die schon Jahre zuvor schrieben: „nonaccounting information is as useful to investors as other accounting information“.19 Bei der Reputation handelt es sich um eben solch eine ‚non-accounting Information’, ihr Informationswert geht allerdings weit über die Anspruchsgruppe der Investoren hinaus. Wohl auch deshalb finden sich in immer mehr Geschäftsberichten von Aktiengesellschaften neben den finanziellen Kennzahlen auch Angaben zu Aktivitäten in Umwelt- oder Sozialbelangen. Entsprechende Informationen werden auch als ‚Corporate Social Reporting’ bezeichnet (BEBBINGTON ET AL. 2008: 337f).
Diese oftmals freiwilligen Angaben sind aber keinesfalls als Rufmessung zu verstehen. Sie dienen vielmehr dazu, den Ruf des Unternehmens zu entwickeln (BEBBINGTON ET AL. 2008: 341f). Obwohl schon vor Jahren darauf hingewiesen wurde, dass die Reputationsmessung vielerorts noch in den Kinderschuhen steckt (DAVIES/MILES 1998: 24), hat sich bis heute nur wenig an der Situation geändert. So ergab eine internationale Studie aus dem Jahr 2000, dass lediglich 42% der Führungskräfte ein formales Messinstrument für die Reputation etabliert haben. Gleichzeitig bescheinigten aber 94% der Befragten dem Ruf eine hohe Wichtigkeit (KITCHEN/LAURENCE 2003: 108).
Nicht viel besser sind die Resultate einer Umfrage von WIEDMANN/BUXEL unter Großunternehmen in Deutschland. Zwar kommen ‚handfeste’ Instrumente wie die Messung der Kundenzufriedenheit häufig zum Einsatz, Imageanalysen finden hingegen kaum Beachtung. Standardisierte Messansätze, wie sie im MANAGERMAGAZIN veröffentlicht werden, stoßen bei den befragten Unternehmen sogar auf extrem geringe Resonanz (WIEDMANN/BUXEL 2005a: 435). Nicht uneigennützig fordert CAPOZZI deshalb von der PR-Beratungsindustrie dringend einen einheitlich anwendbaren Reputations-Messansatz zu entwickeln, dies würde schließlich auch die Zukunft der PR-Branche selbst sichern (CAPOZZI 2005: 292).
| Erscheint lt. Verlag | 30.5.2010 |
|---|---|
| Zusatzinfo | XXII, 354 S. 18 Abb. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management |
| Schlagworte | Automobilbranche • Industrieökonomik • Kausalanalyse • Partial-Least-Squares • Reputationsmanagement • Werbung |
| ISBN-10 | 3-8349-8398-5 / 3834983985 |
| ISBN-13 | 978-3-8349-8398-5 / 9783834983985 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich