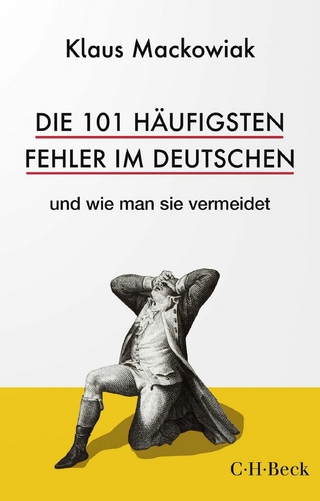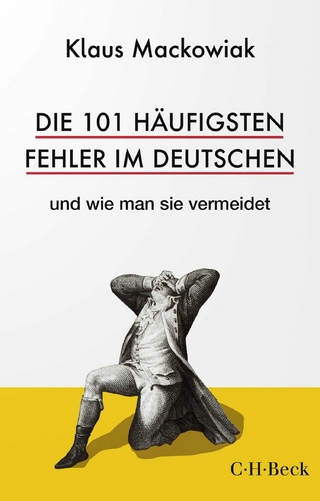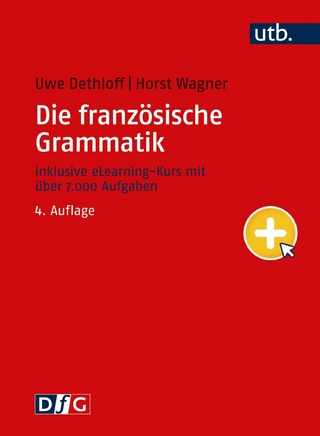Lexikologie / Lexicology. 1. Halbband (eBook)
964 Seiten
De Gruyter (Verlag)
978-3-11-019402-9 (ISBN)
Die Reihe HANDBÜCHER ZUR SPRACH- UND KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT erschließt einen Wissensbereich, der sowohl die allgemeine Linguistik und die speziellen, philologisch orientierten Sprachwissenschaften als auch diejenigen Wissenschaftsgebiete umfasst, die sich in den letzten Jahrzehnten aus der immer umfangreicher werdenden Forschung über die vielfältigen Erscheinungen des kommunikativen Handelns entwickelt haben.
In der klassischen Disziplin der Sprachwissenschaft erscheint eine Zusammenfassung des Wissensstandes notwendig, um der im Wechsel der Theorien rasch voranschreitenden Forschung eine Bezugsbasis zu geben; in den neuen Wissenschaften können die Handbücher dem Forscher Übersicht geben und Orientierung verschaffen.
Um diese Ziele zu erreichen, wird in der Handbuchreihe, was
· die Vollständigkeit in der Darstellung,
· die Explizitheit in der Begründung,
· die Verlässlichkeit in der Dokumentation von Daten und Ergebnissen und
· die Aktualität im Methodischen
angeht, eine Stufe der Verwirklichung angestrebt, die mit den besten Handbuchkonzeptionen anderer Wissenschaftszweige vergleichbar ist. Alle Herausgeber, die der Reihe und diejenigen der einzelnen Bände, wie auch alle Autoren, die in den Handbüchern ein Thema bearbeiten, tragen dazu bei, dieses Ziel zu verwirklichen. Veröffentlichungssprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch.
Wenngleich als Hauptzweck der Handbuchreihe die angemessene Darstellung des derzeitigen Wissensstandes in den durch die jeweiligen Handbuchbände abgedeckten Ausschnitten der Sprach- und Kommunikationswissenschaft zu gelten hat, so wird doch bei der Abgrenzung der wissenschaftlichen Bereiche, die jeweils in einem Handbuchband erschlossen werden sollen, keine starre Systematik vorausgesetzt. Die Reihe ist offen; die geschichtliche Entwicklung kann berücksichtigt werden. Diese Konzeption sowie die Notwendigkeit, dass zur gründlichen Vorbereitung jedes Bandes genügend Zeit zur Verfügung steht, führen dazu, dass die ganze Reihe in loser Erscheinungsfolge ihrer Bände vervollständigt werden kann. Jeder Band ist ein in sich abgeschlossenes Werk.
Die Reihenfolge der Handbuchbände stellt keine Gewichtung der Bereiche dar, sondern hat sich durch die Art der Organisation ergeben: der Herausgeber der Reihe bemüht sich, eine Kollegin oder einen Kollegen für die Herausgabe eines Handbuchbandes zu gewinnen. Hat diese/r zugesagt, so ist sie/er in der Wahl der Mitherausgeber und bei der Einladung der Autoren vollkommen frei. Die Herausgeber eines Bandes planen einen Band inhaltlich unabhängig und werden dabei lediglich an bestimmte Prinzipien für den Aufbau und die Abfassung gebunden; nur wo es um die Abgrenzung zu anderen Bänden geht, ist der Reihenherausgeber inhaltlich beteiligt. Dabei wird davon ausgegangen, dass mit dieser Organisationsform der Hauptzweck dieser Handbuchreihe, nämlich die angemessene Darstellung des derzeitigen Problem- und Wissensstandes in den durch die jeweiligen Handbuchbände abgedeckten Teilbereichen, am besten verwirklicht werden kann.
Vorwort 5
Preface 8
Inhalt/Contents 11
I. Grundlagen und Grundfragen der Lexikologie 23
1. Der Status der Lexikologie als linguistische Disziplin 23
1. Ziele des Artikels 23
2. Terminologische Fragen 23
3. Fragen des Gegenstandbereichs 23
4. Lexikologie als Disziplin der Linguistik 28
5. Beziehungen der Lexikologie zu anderen Disziplinen der Linguistik 29
6. Aufgabenfelder der Lexikologie 29
7. Schlussbetrachtung 34
8. Literatur in Auswahl 34
2. Das Wort als lexikalische Einheit 36
1. Wort als Terminus 36
2. Lexikalität 46
3. Das Lexikonwort/Lexem als Einheit 49
4. Literatur in Auswahl 53
3. Lexik, Lexikon, Wortschatz: Probleme der Abgrenzung 56
1. Terminologisches 56
2. Beschränkungen 57
3. Das Wort als zentrales Lexikonelement 57
4. Der Begriff "sprachliches Zeichen" (linguistic sign) 58
5. Wörter: eine inhomogene Klasse 59
6. Lexikoneinheiten unterhalb und oberhalb der Wortebene 60
7. Lexikon und Grammatik (Syntax) 61
8. L-1 und L-2-Lexikon 63
9. Form- und Bedeutungslexikon 63
10. Häüfige und seltener gebrauchte Lexeme 64
11. Modalitätsspezifische Lexika 64
12. Morphemlexikon - Wortlexikon - Phraseolexikon 65
13. Literatur in Auswahl 66
4. Struktur und Strukturierung in der Lexikologie 67
1. Struktur-Grundlage und Lexikologische Grundhypothese 67
2. Drei Grundstrukturen von Bedeutungs-Analyse: Zerlegung, Extensionalisierung, sinnrelationale Vernetzung 68
3. Sem-Semantik als Beispiel einer Zerlegungs-Semantik 70
4. Die Logische Semantik 72
5. Die Attribut-Semantik 74
6. Fazit 77
7. Literatur in Auswahl 79
5. Der Gang der lexikologischen Forschung I 81
1. Vorbemerkung 81
2. Das Wort als Gegenstand philosophischer Überlegungen in der Antike 81
3. Mittelalterliche Auslegung der Schriften 83
4. Lexikographische Anforderungen an die Wortbetrachtung 83
5. Entwicklung der Wissenschaften und Wortforschung 85
6. Das Wort im philosophischen Denken der Aufklärung 86
7. Die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft 87
8. Literatur in Auswahl 89
6. Der Gang der lexikologischen Forschung II 90
1. Vorbemerkung 90
2. Wortschatzuntersuchungen in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 90
3. Die Ausbildung der Zeichentheorie in F. de Saussures "Cours de linguistique générale" und im Organonmodell Bühlers 94
4. Die strukturelle Sprachwissenschaft und die Herausbildung der Lexikologie 95
5. Lexikologie nach dem II. Weltkrieg 95
6. Literatur in Auswahl 97
II. Reflexion über das Wort 100
7. Zur Etymologie von Benennungen für "Wort" 100
1. 'Lexikologie' 100
2. Benennungen für "Wort" im Griechischen 100
3. Benennungen für "Wort" in den germanischen Sprachen 101
4. Benennungen für "Wort" in den baltischen Sprachen 102
5. Benennungen für "Wort" im Lateinischen und in den romanischen Sprachen 102
6. Benennungen für "Wort" in den slavischen Sprachen 103
7. 'Name' in den indogermanischen Sprachen 104
8. Literatur in Auswahl 104
8. Das Wort im alltäglichen Verständnis 106
1. Das Wort als grundlegende sprachliche Einheit 106
2. Das Wort als Äußerung (Rede/Text) 107
3. Das Wort im Prozess des Äußerns 108
4. Fazit 110
5. Literatur in Auswahl 110
9. Das Wort in der philosophischen Sprachreflexion 111
1. Das Wort als Ausdruck der sozialen Natur des Menschen 111
2. Das Wort als Ausdruck menschlicher Erkenntnis 113
3. Das Wort als Bedingung menschlicher Erkenntnis 116
4. Literatur in Auswahl 121
10. Words from a psychological perspective 123
1. A brief history on the psychology of language 123
2. Language comprehension and production 123
3. About words 124
4. A final word on words 126
5. Literature (a selection) 127
11. Das Wort in der Dichtung 128
1. Eingrenzung 128
2. Berücksichtigte Bedeutungen 128
3. Mittelalter 129
4. Lutherzeit 129
5. Barock 130
6. Aufklärung 130
7. Goethezeit 131
8. Romantik 132
9. Mittleres und späteres 19. Jahrhundert 132
10. Jahrhundertwende 133
11. Vom Expressionismus bis zur Gegenwart 134
12. Literatur in Auswahl 135
12. Das Wort in der sprachkritischen Reflexion 135
Literatur in Auswahl 142
13. Das Wort in der feministischen Sprachreflexion 143
1. Feministische Sprachreflexion und feministische Linguistik 143
2. Bezeichnungen für Männer und Frauen 144
3. Androzentrik 147
4. Deontische Bedeutungskomponenten 147
5. Geschlechtsspezifische Wortbedeutung 148
6. Wortgebrauch von Männern und Frauen 148
7. Literatur in Auswahl 149
III. Das Wort im Kontext verschiedener Sprach-/Grammatiktheorien 151
14. Das Wort in der inhaltbezogenen Grammatik 151
1. "Inhaltbezogen" als Name einer linguistischen Richtung vor allem im deutschsprachigen Raum 151
2. Saussure als direkte Grundlage - Humboldt, Cassirer, Husserl, Hegel als Autoritäten 151
3. Wortinhalte und Wortkörper, kognitive Wichtigkeit des Besitzes von Wortinhalten 153
4. Die Bestimmtheit der Wortinhalte und die Wege, sie aufzuweisen die Rolle der Wortkörper
5. Überstarkes Gesetzlichkeitsdenken - Sprache als zwingende, unhintergehbare Macht 155
6. Forschungspolitische Leistung von Weisgerber - Rezeption leider oft zusätzlich verengend und vergröbernd 156
7. Abwendung von Weisgerber - Historisierung der Kennzeichnung "inhaltbezogen" 156
8. "Inhaltbezogen" als Ziel und grundlegende Forderung - weit über Weisgerber hinaus 156
9. "Wort" gegenüber "Satz" Einheit der Speicherung - Einheit der Produktion
10. Propositionen clauses als Rahmen für das Erfassen der Bedeutungsseiten der Wörter 157
11. Bedeutungen und Wortgestalten, Entstehung aus der Lebenspraxis, häufig unscharfe Abgrenzung 157
12. Wissenschaftliche Zugänglichkeit sehr verschieden - und Erlernbarkeit verschieden 158
13. Ganze Bedeutungsstrukturen als Rahmen für Einzelbedeutungen, die "verbalen Semanteme" 158
14. Genaues Beschreiben der Eigen-Formung jeder Sprache als Weg zum Erfassen der grundlegenden Mehrsprachigkeit auch jedes einzelnen Menschen 159
15. Literatur in Auswahl 159
15. The word in American structuralism 160
1. Structuralism in linguistics 160
2. The word as a linguistic unit 161
3. American structuralists 161
4. Identification and definition of word 162
5. Methodology 163
6. Comparison with generative grammar 165
7. Literature (a selection) 165
16. Das Wort im Europäischen Strukturalismus 166
1. Einführende Bemerkungen 166
2. Zur Problematik des Begriffs "Wort" im Allgemeinen 167
3. Was heißt "Europäischer Strukturalismus"? 170
4. Der Begriff "Wort" und konkurrierende bzw. benachbarte Begriffe in den verschiedenen Schulen des europäischen Strukturalismus 171
5. Zusammenfassung und Ausblick 174
6. Literatur in Auswahl 174
17. Das Wort in der generativen Grammatik I 175
1. Grammatiktypen der Anfangsphase 175
2. Die Rolle des Lexikons 176
3. Die Verwendung des Terminus 'Wort' 177
4. Neue Lexikonkonzepte 177
5. Literatur in Auswahl 178
18. The word in Generative Grammar II 178
1. Beginnings of lexicalism 178
2. Lexical grammars 179
3. Government and Binding Theory 182
4. Summary 183
5. Literature (a selection) 183
19. Das Wort in der Dependenzgrammatik 183
1. Dependenzgrammatische Grundannahmen in Bezug auf den Wortbegriff 183
2. Die Valenzlehre und der Wortbegriff 185
3. Neuere dependenzgrammatische Konzeptionen 187
4. Literatur in Auswahl 188
20. The word in Categorial Grammar 189
1. Fundamentals of Categorial Grammars 189
2. Semantics 190
3. Extensions: rules 191
4. Extensions: features 191
5. Category ambiguity 192
6. Omissions 192
7. Recent developments 193
8. Literature (a selection) 193
21. Das Wort in funktionalgrammatischen Ansätzen 194
1. Arten und Wesen der funktionalen Grammatik 194
2. Das Wort und die sprachlichen Ebenen 196
3. Morphem - Wort - Wortgruppe 197
4. Zum Problem der Wortarten 198
5. Literatur in Auswahl 199
22. The word in Word Grammar 200
1. Word Grammar as a definition of Word 200
2. Word-tokens 200
3. Syntactix lexemes, morphophonological lexemes, and lexical items 203
4. Literature (a selection) 206
23. Das Wort in textgrammatischen Ansätzen 207
1. Wort und Textsyntax 207
2. Der Einfluss von Wörtern auf Kohärenz und semantische Akzeptabilität 208
3. Dynamische Wortsemantik: Wortbedeutung im Text 209
4. Literatur in Auswahl 210
24. Wortbedeutung in Theorien sprachlichen Handelns 211
1. Grundfragen 211
2. Bedeutung als Beitrag eines Wortes zum Handlungspotential eines Satzes 214
3. Sprachliche Handlungen und Teilhandlungen 215
4. Wahrheitsbedingungen und Bedingungen für sprachliche Handlungen 216
5. Die dialogische Basis von Bedingungen für sprachliche Handlungen 217
6. Handlungszusammenhänge und semantische Relationen 218
7. Kommunikative Aufgaben und grammatisch-lexikalische Mittel 219
8. Aspekte der semantischen Beschreibung von lexikalischen Einheiten 220
9. Literatur in Auswahl 220
IV. Die Formseite des Wortes 222
25. Morphologische Eigenschaften von Wörtern 222
1. Lexem und Wortform 222
2. Morphologische Eigenschaften von Lexemen 222
3. Morphologische Eigenschaften von Wortformen 227
4. Literatur in Auswahl 232
26. Phonology of the word 232
1. Introduction: Some examples of word phonology 232
2. Some ideas and proposals originating from classical phonemics 232
3. Some ideas and proposals originating from early generative phonology 234
4. The Word as a separate phonological prosodic category 235
5. Lexical Phonology 236
6. Literature (a selection) 238
27. Graphematische Eigenschaften von Wörtern 239
0. Einleitende Bemerkungen 239
1. Logographische Schriftsysteme 239
2. Nicht-logographische Schriftsysteme 240
3. Die idealisierte Represäntation von Wortformen 245
4. Grenzfälle 246
5. Literatur in Auswahl 249
V. Die Inhaltsseite des Wortes I: Allgemein 250
28. Fundamental Issues in Lexical Semantics 250
1. Introduction 250
2. Lexical Form 250
3. Meaning of a Lexical Form 251
4. Whither Lexical Semantics? 257
5. Literature (a selection) 258
29. Die Behandlung der Wortbedeutung in der Geschichte der Sprachwissenschaft 259
1. Wortarten und Wortbedeutung unter dem Einfluss des Aristoteles 259
2. Die empirische Bedeutungslehre 260
3. Semantik unter dem vorherrschenden Paradigma der Entwicklung 261
4. Die neuere Erforschung der Wortbedeutung 262
5. Literatur in Auswahl 265
VI. Die Inhaltsseite des Wortes II: Lexikalische Dekomposition 267
30. Lexikalische Dekomposition I 267
1. Die strukturalistische Wende in der Lexik 267
2. Der lexematische Ansatz 268
3. Das methodische Instrumentarium 270
4. Die Analyse 273
5. Bilanz 275
6. Literatur in Auswahl 275
31. Lexical Decomposition II 278
1. Introduction 278
2. Speech act verbs 281
3. Social categories: The example of friend 283
4. Natural kinds 285
5. Concluding remarks 289
6. Literature (a selection) 289
VII. Die Inhaltsseite des Wortes III: Konzeptuelle Ansätze 291
32. Conceptual Approaches I 291
1. Introduction 291
2. Summary of the conceptual approach 292
3. Linguistic arguments against a conceptual approach 293
4. Evidence from linguistics and psycholinguistics 293
5. Remaining issues 297
6. Literature (a selection) 298
33. Konzeptuelle Ansätze II 299
1. Konzeptuelle Ansätze und Ebenenproblematik 299
2. Einebenen-Ansätze 301
3. Mehrebenen-Ansätze 302
4. Gemischte Ansätze und Fragen der zukünftigen Forschung 304
5. Literatur in Auswahl 305
34. Conceptual Approaches III 306
1. Characterizing prototype theory 306
2. An illustration 308
3. Queries about prototypicality 310
4. Literature (a selection) 312
35. Konzeptuelle Ansätze IV 313
1. Einleitung 313
2. Sprachphilosophischer Hintergrund 313
3. Stereotypen in der semantischen Theorie und Praxis 314
4. Schluss 317
5. Literatur in Auswahl 318
36. Conceptual approaches V 318
1. Introduction 318
2. Concepts 319
3. Domains 321
4. Related notions 322
5. Metaphor and metonymy 323
6. Literature (a selection) 324
VIII. Die Inhaltsseite des Wortes IV: Die Strukturierung des Inhalts 326
37. Structuring of word meaning I 326
1. Introduction 326
2. Basic distinctions 326
3. Characteristics of semasiological structures 327
4. Characteristics of onomasiological structures 331
5. Extensions and nuances 335
6. Non-denotational meaning 337
7. The development of lexical semantics 338
8. Literature (a selection) 340
38. Structuring of word meaning II 341
1. Introduction 341
2. Polysemy in the linguistic tradition 341
3. Polysemy and homonymy 344
4. Polysemy and monosemy 350
5. Testing polysemy 353
6. Further directions for the study of polysemy 355
7. Literature (a selection) 357
39. Structuring of word meaning III 359
1. Levels of figurativity cognitive strategies
2. Synaesthesia versus metonymy and metaphor 360
3. Similarity and contrast in figurativity 361
4. The concrete as a road into abstract domains 363
5. Literature (a selection) 364
IX. Die Inhaltsseite des Wortes V: Dimensionen der Bedeutung 365
40. Dimensionen der Bedeutung I 365
1. Der Begriff Dimension der Bedeutung 365
2. Die drei Bühlerschen Bedeutungsdimensionen 365
3. Denken, Fühlen, Wollen 366
4. Zur kognitiven Dimension der lexikalischen Bedeutung 367
5. Zur emotiven Dimension der lexikalischen Bedeutung 368
6. Zur volitiven Dimension der lexikalischen Bedeutung 368
7. Attitude, Einstellung, Haltung 370
8. Literatur in Auswahl 371
41. Dimensions of meaning II 372
1. The importance of descriptive meaning 372
2. The delimitation of descriptive meaning 372
3. Varieties of primary content 373
4. Basicness in descriptive meaning 375
5. Transparency and motivation 376
6. Expectedness, diagnosticity and prototypicality 377
7. Foregrounding and backgrounding of descriptive features 377
8. Literature (a selection) 377
42. Dimension der Bedeutung III 378
1. Terminologieprobleme 378
2. Emotionsbegriffe 378
3. Emotionsbedeutung und emotive meaning 379
4. Emotive Wörter 382
5. Konnotation 383
6. LIteratur in Auswahl 383
43. Dimensionen der Bedeutung IV 385
1. Einleitung: Stilsignifikanten und Stilsignifikate 385
2. Stil in Text und Wort 385
3. Stilmerkmale in verschiedenen Wortschätzen 386
4. Personen- und zeitgebundener Stil 388
5. Wortzuordnungen nach Stilran, Stilhöhe und Stilfärbung 389
6. Makrostilistische und mikrostilistische Textmerkmale 390
7. Innertextliche Stilstrukturen 391
8. Literatur in Auswahl 392
X. Die Beziehungen zwischen Form- und Inhaltsseite 393
44. Arbitrarität, Ikonizität und Motivation 393
1. Einleitung 393
2. Saussures Zeichenkonzeption 393
3. Der Beitrag der Semiotik nach Pierce 394
4. Belege der lexikalischen Ikonizität 397
5. Die Rolle der Motivation 399
6. Schluss: Motivation, Ikonizität und Natürlichkeitsparameter 401
7. Literatur in Auswahl 401
45. Das Worten der Welt 402
1. Einführung 402
2. Das "Worten der Welt" bei Leo Weisgerber 402
3. Das sprachliche Relativitätsprinzip 405
4. Die Rezeption des sprachlichen Relativitätsprinzips 408
5. Das sprachliche Relativitätsprinzip in neuer Sicht 410
6. Schluss 411
7. Literatur in Auswahl 411
XI. Besondere Formen lexikalischer Einheiten I: Phraseologismen 414
46. Die Charakteristika phraseologischer Einheiten 414
1. Objektbereich und Grundbegriffe 414
2. Polylexikalität 414
3. Festigkeit 415
3. Pragmatische Ebene 419
4. Gebräuchlichkeit 420
5. Idiomatizität 420
6. Motiviertheit 421
7. Graduierung der Anomalie - Prototypikalität des Idioms? 422
8. Literatur in Auswahl 422
47. Typologien der Phraseologismen 424
1. Dimensionen der Typologisierung 424
2. Morphosyntax 424
3. Semantik 426
4. Morphosyntax + Semantik 427
5. Pragmatik 427
6. Weitere Klassifikationsmöglichkeiten 428
7. Fazit 428
8. Literatur in Auswahl 429
48. Wortkombinationen 430
1. Probleme der Abgrenzung 430
2. Phraseologische Wortpaare ("Zwillingsformeln") als Prototyp 431
3. Phraseologische Verbindungen (feste Kollokationen) 432
4. Phraseologische Termini 433
5. Modellbildungen 433
6. Funktionsverbgefüge 434
7. Phraseologische Vergleiche 435
8. Literatur in Auswahl 436
49. Mehrwortlexeme 437
1. Phraseologismen und Wortbildungen 437
2. Wortbildung 437
3. Literatur in Auswahl 442
50. Pragmatische Phraseologismen 443
1. Gegenstandsbereich und Terminologie 443
2. Funktionen und Typen 445
3. Phraseologie und Pragmatik - ein Ausblick 448
4. Literatur in Auswahl 448
51. Phraseologisch isolierte Wörter und Wortformen 451
1. Definition - Terminologie 451
2. Kriterien der lexikalischen Isoliertheit, Gebundenheit, Unikalität 452
3. Einzelsprachliche Charakteristika/ Universalien 453
4. Einbettung in die Sprachgeschichte 453
5. Unikale Elemente aus kognitiver Perspektive 454
6. Literatur in Auswahl 455
52. Semantik und Herkunftserklärungen von Phraseologismen 455
1. Zur semantischen Aktualität der Herkunftsproblematik 455
2. Herkunft nach phzsikalischen Dimensionen 457
3. Herkunft nach philologischen Aspekten 459
4. Herkunft nach Sachbereichen 460
5. Literatur in Auswahl 462
53. Phraseologismen in kontrastiver Sicht 464
1. Zur Terminologie und Begriffsbestimmung 464
2. Aspekte der vergleichenden Phraseologieforschung 465
3. Aktuelle Probleme der kontrastiven Phraseologieforschung 466
4. Fazit 472
5. Literatur in Auswahl 472
XII. Besondere Formen lexikalischer Einheiten II: Kurzwörter, Abkürzungen und sonstige lexikalische Einheiten mit wortähnlichem Status 474
54. Die Formseite der Abkürzungen und Kurzwörter 474
1. Begriffsklärung: Abkürzung vs. Kurzwort 474
2. Das Basislexem 475
3. Die Formseite der unisegmentalen Kurzwörter 475
4. Die Formseite der partiellen Kurzwörter 476
5. Die multisegmentalen Kurzwörter 477
6. Literatur in Auswahl 478
55. Die Inhaltsseite von Kurzwörtern und Abkürzungen 479
1. Gegenstand und Definitionen 479
2. Referentielle Unterschiede 479
3. Bedeutungsunterschiede 480
4. Unterschiede in der Evokation 481
5. Zur Leistung der Kurzformen 481
6. Literatur in Auswahl 482
56. Lexikalische Einheiten mit wortähnlichem Status 483
1. Mögliche Kriterien eines Wortbegriffs 483
2. Anähnlichungen 483
3. Unähnlichkeiten 484
4. Zurufe 485
6. Literatur in Auswahl 486
XIII. Lexikalische Strukturen auf der Grundlage von Sinnrelationen I: Allgemein, Inklusion und Identität 488
57. Sense relations 488
1. Sense and sense relations 488
2. Syntagmatic and paradigmatic sense relations 489
3. Synonymy 491
4. Antonymy 492
5. Incompatibility 492
6. Hyponymy 493
7. Concluding remarks 493
58. Paradigmatic relations of inclusion and identity I 494
1. Introduction 494
2. Taxonymy 495
3. Folk versus specialist taxonomy 495
4. Principles of folk biological taxonomy 495
5. Development of life-form categories 496
6. The privileged status of generics 497
7. Natural kinds versus artifacts 497
8. Societal scale and folk biological taxonomy 498
9. Intellectualism versus utilitarianism 498
10. Explanations of societal scale differences 500
11. Literature (a selection) 501
59. Paradigmatic relations of inclusion and identity II 502
1. Introduction 502
2. Transitivity 502
3. The semantic diversity of part of 503
4. Part of as a lexical universal 503
5. "Part of" as a semantic prime 504
6. Meronymic polysemy 504
7. Meronymy and language universals 505
8. Meronymy and societal complexity 506
9. Literature (a selection) 506
60. Paradigmatic relations of inclusion and identity III 507
1. Preliminary remarks 507
2. Theoretical preliminaries 508
3. Degrees of synonymity 510
4. Permissible differences between synonyms 513
5. Varieties of Synonymy 515
6. Synonym clusters 517
7. Concluding remarks 518
8. Literature (a selection) 518
XIV. Lexikalische Strukturen auf der Grundlage von Sinnrelationen II: Exklusion und Opposition, Ableitungsbeziehungen 520
61. Paradigmatic relations of exclusion and opposition I 520
1. Introduction 520
2. Uncommitted antonyms (polar antonyms) 520
3. Committed antonyms 521
4. Asymmetrical antonyms 522
5. Gradable complementaries 522
6. Lexicalizing subparts of the scales 523
7. Entailments and implicatures 524
8. Antonymy in verbs and nouns 524
9. Significant contrasts involving multiple scales 524
10. Antonymy in other languages 525
11. Complementarity 525
12. Other categories of opposition 525
13. Creating antonyms morphologically 526
14. Antonymy in psycholinguistics 527
15. Conclusion 527
16. Literature (a selection) 528
62. Paradigmatic relations of exclusion and opposition II 529
1. Introduction 529
2. Formal aspects of reversive oppositions 530
3. Transitivity 531
4. Relations with antonymy 531
5. Restitutivity 531
6. Polarity 531
7. Literature (a selection) 532
63. Paradigmatische Relationen der Exklusion und Opposition III 533
1. Vorbemerkung 533
2. Bedeutungsrelation und Konversivität 533
3. Lexikalisierte Konversivität 534
4. Grammatikalisierte Konversivität 537
5. Konversivität und Sprachgeschichte 538
6. Literatur in Auswahl 539
64. Polarität, Duralität und Markiertheit 540
1. Einführung 540
2. Polarität 540
3. Dualität 543
4. Literatur in Auswahl 546
65. Semantic relations of derivational affixes 547
1. Introduction 547
2. Comparing and contrasting derivational affixes and lexemes 549
3. Paradigmatic relations 549
4. Bound roots 552
5. Syntagmatic relations 553
6. Summary 553
7. Literature (a selection) 553
XV. Lexikalische Strukturen auf der Grundlage von Sinnrelationen III: Beschreibungsansätze 555
66. Beschreibungsansätze für Sinnrelationen I 555
1. Sinnrelationen: Gegenstand, Ziele, Theorien, Methoden, Modelle 555
2. Psycho-, sozio-, ethno-, anthropologische Ansätze 556
3. Strukturalistisch-linguistische Ansätze 558
4. Fort- und Weiterentwicklungen 560
5. Anwendungsfelder 562
6. Literatur in Auswahl 562
67. Descriptive models for sense relations II 564
1. Types of sense relation 564
2. Approaches to the study of sense relations 564
3. Concepts and sense relations 565
4. Paradigmatic sense relations as prototypes 566
5. The role of image-schemas in the description of sense relations 570
6. Literature (a selection) 571
68. Descriptive Models of Sense Relations III 571
1. Formal Semantics 571
2. Lexical Decomposition 573
3. Meaning Postulates 573
4. Sense Relations 574
5. Questions and Problems 575
6. Literature (a selection) 577
XVI. Lexikalische Strukturen aus syntagmatischer Sicht 578
69. Syntagmatische Beziehungen 578
1. Versuch einer Bestandsaufnahme und allgemeinen Bestimmung wesentlicher Arbeitsbegriffe und Untergruppen 578
2. Zu den sememotaktischen und morphosyntaktischen Aspekten des syntagmatischen Potentials verbaler LEtype 582
3. Syntagmatische Beziehungen in Mehrwortkonstruktionen: Funktionsverbgefüge, Substantiv-Verb-Kollokationen 585
4. Literatur in Auswahl 586
70. Syntagmatic processes 587
1. Historical remarks 587
2. Determination of selection 587
3. Argument selection 588
4. Subcategorization and verbal polysemy 589
5. Selective binding 590
6. Solidarity and polysemy 590
7. Literature (a selection) 591
71. Kompositionalität und ihre Grenzen 592
1. Semantische Funktionen 592
2. Syntaktisch-semantische Komposition 593
3. Kompositionalität und Kontextualität 593
4. Grenzen der Kompositionalität 594
5. Kontextabhängige Interpretation 595
6. Wortbildung 596
7. Kompositionalität als Methode 598
8. Literatur in Auswahl 598
XVII. Die Architektur des Wortschatzes I: Die Wortarten 600
72. Das Wortartenproblem in lexikologischer Perspektive 600
1. Einleitende Bemerkungen 600
2. Die Wortarten im Rahmen der früh- und hochmittelalterlichen Glossare 601
3. Die Wortarten im Rahmen der spätmittelalterlichen Vokabularien und der frühneuzeitlichen Wörterbücher 601
4. Die Wortarten im Rahmen der Wörterbücher des Barock 604
5. Die Wortarten im Rahmen der Wörterbücher des 18. Jahrhunderts 605
6. Die Wortarten im Rahmen der Wörterbücher des 19. Jahrhunderts 606
7. Die Wortarten im Rahmen der Wörterbücher des 20. Jahrhunderts 607
8. Schlussbemerkungen 608
9. Literatur in Auswahl 608
73. The word class 'Noun' 610
1. Introduction 610
2. General characteristics 610
3. Subclasses of nouns 612
4. Literature (a selection) 618
74. Die Wortart 'Adjektiv' 620
1. Semantische und syntaktische Eigenschaften von Adjektiven 620
2. Semantik der prädikativen und attributiven Verwendung von Adjektiven 624
3. Restriktive und appositive Interpretation 624
4. Semantik der adjunktiven Verwendung 625
6. Adjektive und alternative sprachliche Ausdrücke 626
7. Literatur in Auswahl 626
75. Die Wortart 'Verb' 627
1. Einleitung 627
2. Der kategoriale Inhalt des Verb 628
3. Konsequenzen der kategorialen Bestimmung des Verbs 633
4. Ausblick: die Doppelstruktur des Verbs 636
5. Literatur in Auswahl 637
76. Zum Pronominalen 638
1. Übersicht 639
2. Linguistische Referenz 639
3. Zur Prowortsemantik 640
4. Offene Fragen 642
5. Semverzeichnis/Kurzdefinition 642
6. Modifikatorenverzeichnis 642
7. Literatur in Auswahl 642
77. The word class 'Article' 643
1. Articles/Determiners 643
2. The functional category D 644
3. The semantics of determiners (articles) 645
4. Literature (a selection) 648
78. The word class 'Numeral' 650
1. Definition 650
2. Cardinals and ordinals 650
3. Nominal and adjectival behaviour of numerals 651
4. Inflected variants of numerals 651
5. Counting v attributive 651
6. Numeral classifiers 651
7. Word order 652
8. Compound numerals 652
9. Other numerical expressions 652
10. Literature (a selection) 652
79. Die Wortart 'Adverb' 653
1. Zur Problematik der Wortart 'Adverb' 653
2. Terminologiegeschichtliches 653
3. Wortartcharakteristika 653
4. Sprachvergleich 655
5. Literatur in Auswahl 655
80. Die Wortart 'Konjunktion' 656
1. Problemgeschichte und Zugangsweisen 656
2. Aus- und Untergliederung: syntaktische Kriterien 657
3. Aus- und Untergliederung: semantische Kriterien 659
4. Diachronische Aspekte und universelle Tendenzen 661
5. Literatur in Auswahl 662
81. Die Wortart 'Prä- und Postposition' 663
Literatur in Auswahl 667
82. Die Wortart 'Partikel' 668
1. Abgrenzung der Wortart 668
2. Partikeln im weiteren Sinne 668
3. Partikeln im engeren Sinne 669
4. Probleme 672
5. Literatur in Auswahl 674
83. Die Wortart 'Interjektionen' 676
1. Interjektionen als umstrittener Gegenstand linguistischer Forschung 676
2. Interjektionen als Lexemklasse 677
3. Sprachlich-formale Eigenschaften von Interjektionen 677
4. Semantik und Pragmatik von Interjektionen 678
5. Literatur in Auswahl 679
84. Wortartwechsel 679
1. Begriff und Implikationen 679
2. Substantivierung 681
3. Adjektivierung 682
4. Verbierung 683
5. Resümee 683
6. Literatur in Auswahl 683
85. The characteristics of word classes from a crosslinguistic perspective 684
1. The problem of universals and typology in word class research 684
2. The history of word class research 685
3. Modern definitions of word classes 686
4. Some model cases of variation in (opinions about) word classification 688
5. Nouns and verbs 688
6. Adjectives 690
7. Prepositions 691
8. Adverbs and other categories 692
9. Lexical subcategories 692
10. Different types of categorization 693
11. Grammaticalization of word classes 693
12. Further research 694
13. Abbreviations 694
14. Literature (a selection) 694
XVIII. Die Architektur des Wortschatzes II. Wortfamilien 697
86. Das Wortfamilienproblem in der Forschungsdiskussion 697
1. Theoretisch-methodologischer Hintergrund 697
2. Barocke Sprachgelehrsamkeit 697
3. Das Konzept der frühen Sprachstufen-Wörterbücher des Deutschen 698
4. Wortfamilienbezogene Initiativen 699
5. Wortfamilien als Verbände von Morphemstrukturen 699
6. Lexikographie versus Lexikologie 700
7. J. Spletts Wortfamilien-Wörterbuch des Althochdeutschen 700
8. Der aktuelle Diskussionsstand 701
9. Literatur in Auswahl 701
87. Typen von Wortfamilien 703
1. Basis der Wortfamilien: relative Motiviertheit 703
2. Synchrone vs. diachrone Wortfamilien 704
3. Teilwortfamilien 704
4. Besonderheiten der Wortfamilien 705
5. Fremde Wortfamilien 709
6. Literatur in Auswahl 710
88. Bedingungen des Aufbaus, Umbaus und Abbaus von Wortfamilien 710
1. Einleitende Bemerkungen 710
2. Die Ausgangslage im Althochdeutschen 711
3. Bedingungen des Aufbaus von Wortfamilien 713
4. Bedingungen des Umbaus von Wortfamilien 715
5. Bedingungen des Abbaus von Wortfamilien 718
6. Ausblick 721
7. Literatur in Auswahl 721
89. The analysis of word families and their motivational relations 722
1. Content 722
2. Motivation 722
3. Close motivation 723
4. Loose motivation 724
5. Aspects of motivation 724
6. Conclusion 725
7. Literature (a selection) 725
90. Die Wortfamilienstrukturen in kontrastiver Sicht 726
1. Bedingungen der kontrastiven Betrachtung 726
2. Anhaltspunkte für ein tertium comparationis aus der Wortbildungsforschung 727
3. Wortfamilien als Ergebnisse divergierender morphologisch-semantischer Prozesse 729
4. Kontraste in den Wortfamilienstrukturen und Sprachverwendung 733
5. Literatur in Auswahl 734
XIX. Die Architektur des Wortschatzes III. Wortfelder 735
91. Anfänge und Ausbau des Wortfeldgedankens 735
1. Anfänge und Darstellung der Wortfeldtheorie 735
2. Vorläufer 739
3. Diskussion um die Wortfeldtheorie 739
4. Unterschiedliche Auffassungen vom Feldbegriff 742
5. Ausbau der Wortfeldtheorie Erste Phase: in der Sprachinhaltsforschung 743
6. Ausbau der Wortfeldtheorie - Zweite Phase: durch die Verbindung mit der strukturellen Semantik 746
7. Literatur in Auswahl 748
92. Ausprägungen der Wortfeldtheorie 750
1. Grundannahmen von Wortfeldauffassungen 750
2. Die Wortfeldtheorie und ihre Verwandten 752
3. Typen von Wortfeldern 752
4. Arten von Wortfeldanalysen 754
5. Rezeption und Wirkung von Grundgedanken der Wortfeldtheorie 755
6. Probleme der Wortfeldtheorie im Spiegel ihrer Kritiker 756
7. Perspektiven der Wortfeldtheorie 757
8. Literatur in Auswahl 757
XX. Die Architektur des Wortschatzes IV: Begriffsbezogene Strukturierungen 760
93. Die onomasiologische Sichtweise auf den Wortschatz 760
1. Vorbemerkung 760
2. Onomasiologie als Begriff und Methode 760
3. Phasen und Formen onomasiologischer Forschung 763
4. Onomasiologische Wörterbücher 768
5. Literatur in Auswahl 769
94. Onomasiologische Fallstudien 774
1. Einführung 774
2. Onomasiologische Wörterbücher 775
3. Onomasiologische Studien mit wortgeographischen Zielsetzungen 776
4. Onomasiologische Studien zur religiösen Sprache 779
5. Onomasiologische Studien zu Vogelbezeichnungen 782
6. Literatur in Auswahl 784
95. Bildfelder in historischer Perspektive 786
1. Geschichte des Bildfeldbegriffs 786
2. Weinrichs Bildfeldtheorie und ihre 'feldtheoretische' Verortung 786
3. Definition 789
4. Probleme des modifizierten Bildfeldbegriffs 790
5. Literatur in Auswahl 792
96. Bildfelder in synchroner Perspektive 793
1. Geschichte des Bildfeldbegriffs 793
2. Definition 794
3. Valenz, Morphosyntax und Wortbildung von Bildfeld-Lexemen 795
4. Semantische Innovation durch Bildfelder 797
5. Pragmatische Aspekte - Bildfelder in Texten und in der verbalen Interaktion 798
6. Studien zu einzelnen Bildfeldern 798
7. Praktische Anwendung von Bildfeldanalysen 800
8. Offene Fragen 801
9. Ausblick 802
10. Literatur in Auswahl 802
XXI. Die Architektur des Wortschatzes V: Funktionale Varietäten 806
97. Registerkonzepte 806
1. Stilschicht als lexikalisches Register 806
2. Stilschichten und Stilfärbungen als Markierungskategorien lexikalischer Einheiten 807
3. Stilschichten im Vergleich 812
4. Ausblick 812
5. Literatur in Auswahl 814
98. Gehobene Stilschichten 816
1. Umgrenzung des Begriffs 816
2. Vertikale und horizontale Differenzierungen 817
3. Kontextuelle Beziehungen 818
4. Literatur in Auswahl 820
99. Low levels of style 821
1. Introduction 821
2. Low style in English 821
3. Style differentiation and the development of modern dictionaries 822
4. Words and style 823
5. Conclusion 824
6. Literature (a selection) 825
XXII. Die Architektur des Wortschatzes VI: Herkunftsschichten 827
100. Effects of language contact on the vocabulary 827
1. Language Contact and Transference 827
2. Causes and Channels 827
3. Process/Product/Typology 828
4. Incorporation into the new system 829
5. Impact/Effects 831
6. Conclusion: Transference, Convergence and Diversity 833
7. Literature (a selection) 834
101. Fallstudie I: Das Hochdeutsche 835
1. Vorbemerkung 835
2. Das Wortschatzprofil der althochdeutschen Epoche (500-1050) 836
3. Das Wortschatzprofil der mittelhochdeutschen Epoche (1050-1350) 836
4. Das Wortschatzprofil des Frühneuhochdeutschen (1450-1650) 837
5. Das Wortschatzprofil der neuhochdeutschen Epoche (1650-1950) 838
6. Das Wortschatzprofil der Gegenwartssprache (1945-2000) 841
7. Literatur in Auswahl 842
102. Fallstudie II: Das Niederdeutsche 844
1. Vorbemerkung 844
2. Lexikalische Entlehnungen in das Niederdeutsche 845
3. Ausstrahlungen des Niederdeutschen auf die Nachbarsprachen 847
4. Charakteristische Wortbildungsmerkmale des Niederdeutschen 848
5. Jüngste lexikalische Entwicklungen im Niederdeutschen 848
6. Literatur in Auswahl 849
103. Case study III: English 850
1. Preliminary considerations 850
2. Chronological sequence and sociohistorical outline of major phases of lexical borrowing 850
3. Quantitative and qualitative aspects of loans in English 853
4. Conclusion 857
104. Case study IV: Icelandic 859
1. The Oldest Strata of Icelandic Vocabulary 859
2. The Vocabulary of Old Icelandic from the Historical Perspective 859
3. Borrowings in Old Icelandic 860
4. Later Borrowings and Icelandic Purism 860
5. Literature (a selection) 861
105. Fallstudie V: Die romanischen Sprachen 862
1. Einleitung 862
2. Frz. blé 'Getreide' 862
3. It. camoscio 'Gemse' 864
4. Ergebnisse 868
5. Literatur in Auswahl 868
106. Fallstudie VI: Die slavischen Sprachen 869
1. Einleitung 869
2. Zur Genese der Bezeichnungen für dörfliche Siedlungen im Russischen (ein Überblick) 871
3. Zu den Grundprinzipien der Untersuchung einzelner Wörter 872
4. Exemplarische Untersuchung des im R. besonders exponierten Lexems derevnja '(kleines) Dorf' 873
5. Literatur in Auswahl 875
XXIII. Die Architektur des Wortschatzes VII: Spezialwortschätze 878
107. Vocabularies for specific purposes 878
1. Special vocabularies and lexicology 878
2. Special versus general vocabulary 879
3. Special vocabularies and other "restricted" vocabularies 880
4. Special vocabulary and terminology 882
5. Future work 887
6. Literature (a selection) 887
108. Bibelsprachliche Wortschätze 888
1. Fragestellung: Bibelsprache im allgemeinen Sprachgebrauch 888
2. Bibelspezifischer und religiöser Wortschatz - Grundproblematik - 889
3. Historischer Überblick über die deutsche Bibelsprache 889
4. Säkularisation des bibelsprachlichen Wortschatzes - Einfluss der deutschen Bibelsprache auf den nicht religiösen Bereich 890
5. Zusammenfassender Überblick 892
6. Literatur in Auswahl 893
109. Einflüsse literarischer Wortschätze auf Allgemeinwortschätze 895
1. Die Forschungssituation 895
2. Methodologische Aspekte 897
3. Ausblick: Exemplarische Fallpräsentation der Vermittlung dichterischer Wortschöpfungen 899
4. Literatur (in Auswahl) 900
110. Generationsspezifische Wortschätze 902
1. Einführung 902
2. Begriffliche Vorklärungen 902
3. Ansätze zu einer Generationsspezifik der Sprache 904
4. Generationsspezifische Wortschätze 906
5. Ausblick 908
6. Literatur in Auswahl 909
111. Berufsbezogene Wortschätze 910
1. Beruf, Stand, Amt 910
2. Berufssprache und berufsbezogener Wortschatz 911
3. Tradition und Innovation 912
4. Neu entstehende und untergehende Berufssprachen 913
5. Horizontalität und Vertikalität der Berufssprachen 916
6. Literatur in Auswahl 918
112. Lebensformbezogene Wortschätze 921
1. Problemstellung 921
2. 'Lebensform' als methodologisches Konzept 921
3. Gliederungs- und Kategorienfragen 922
4. Fachsprachliche Wortschätze 922
5. Berufssprachen 924
6. Randgruppensprachen 926
7. Jugendsprache 926
8. Gesinnungsgruppensprachen 927
9. Perspektiven 928
10. Literatur in Auswahl 928
113. Institutionsspezifische Wortschätze 932
1. Sprache und Institution 932
2. Allgemeine Charakteristika institutionsspezifischer Wortschätze 933
3. Der Wortschatz in einzelnen institutionellen Bereichen 934
4. Literatur in Auswahl 939
114. Wissenschaftsbezogene Wortschätze 941
1. Wissenschaftsbezogene Wortschätze in der Fach- und Wissenschaftssprachforschung und der Terminologielehre 941
2. Zur Systemhaftigkeit wissenschaftsbezogener Wortschätze 941
3. Diachrone und soziale Aspekte wissenschaftsbezogener Wortschätze 945
4. Literatur in Auswahl 946
115. Anwendungsbezogene technische Wortschätze 947
1. Einleitung 947
2. Zwischen Fach- und Alltagssprache 948
3. Exemplarische Technikbereiche 951
4. Literatur in Auswahl 953
116. Wirtschaftsbezogene Wortschätze 954
1. Einleitung 954
2. Semantische Prinzipien 955
3. Charakteristika wirtschaftsspezifischer Lexik 959
4. Kodifikationen 961
5. Zusammenfassung 962
6. Literatur in Auswahl 962
| Erscheint lt. Verlag | 14.7.2008 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and Communication Science (HSK) |
| Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and Communication Science [HSK] | |
| Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and Communication Science [HSK] | |
| ISSN | |
| ISSN | |
| Zusatzinfo | Zahlr. Abb. |
| Verlagsort | Berlin/Boston |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Sprachwissenschaft | |
| Schlagworte | Aufsatzsammlung • Lexikologie |
| ISBN-10 | 3-11-019402-3 / 3110194023 |
| ISBN-13 | 978-3-11-019402-9 / 9783110194029 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 13,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich