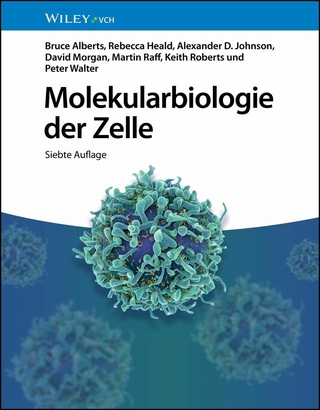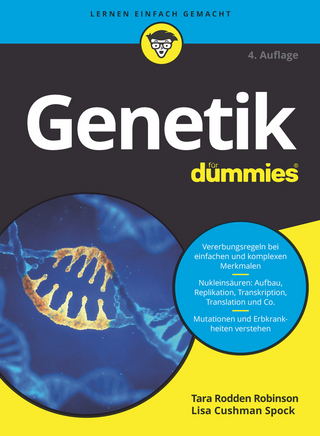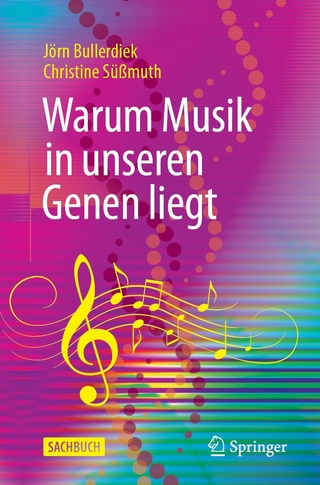Auf dem Weg zur biomächtigen Gesellschaft? (eBook)
XIII, 522 Seiten
VS Verlag für Sozialwissenschaften
978-3-531-91418-3 (ISBN)
Prof. Dr. phil. habil. Achim Bühl lehrt Techniksoziologie mit den Schwerpunkten Technikfolgenabschätzung und Zukunftsforschung an der Hochschule für Technik Berlin.
Prof. Dr. phil. habil. Achim Bühl lehrt Techniksoziologie mit den Schwerpunkten Technikfolgenabschätzung und Zukunftsforschung an der Hochschule für Technik Berlin.
Inhaltsverzeichnis 6
Vorwort 15
Einleitung 17
Von der Eugenik zur Gattaca-Gesellschaft? 28
1 Grundlagen der Eugenik 28
2 Historie der Eugenik 30
2.1 Eugenik in den USA 31
2.2 Eugenik in der Schweiz 35
2.3 Eugenik in Skandinavien 37
2.4 Eugenik in Deutschland 39
2.5 Moderne Formen der Eugenik 56
3 Die Gattaca-Gesellschaft 74
4 Genetischer Rassismus versus „Genoismus“ 77
5 Die biomächtige Gesellschaft 83
6 Resümee 95
Die Janusköpfigkeit der Pränataldiagnostik 96
1 Zwiespältigkeit der diagnostischen Möglichkeiten 96
2 Arten von Pränataldiagnostik 98
3 Beweggründe für die Inanspruchnahme der PND 112
4 Chancen und Risiken der Pränataldiagnostik 113
5 Resümee 134
Aspekte der Präimplantationsdiagnostik 136
1 Die Debatte um die PID 136
2 Die Entwicklung der Präimplantationsdiagnostik 141
2.1 Medizinische Grundlagen 141
2.2 Klinische Entwicklungen 147
3 Die Regulierung der Präimplantationsdiagnostik 154
3.1 Internationale Herangehensweisen 154
3.2 Die deutsche Situation 162
4 Argumentationslinien der deutschen Debatte um die PID 166
5 Kontextsensitive Ethik 186
5.1 Das transdisziplinäre Modell 187
5.2 Anwendung kontextsensitiver Ethik im Bereich der Reprogenetik 191
6 Ansichten zur PID 193
6.1 Ergebnisse der qualitativen Phase 193
6.2 Ergebnisse der standardisierten Befragungen 201
7 Sollte die PID in Deutschland zugelassen werden? 225
7.1 Handlungsbedingungen 225
7.2 Bewertung der Handlungen 232
7.3 Folgenabschätzung 233
7.4 Debattenanalyse 235
8 Fazit 237
Probleme der Stammzellforschung 240
1 Die Zelle, die Stammzelle 242
2 Definitionen 243
2.1 Entwicklung 244
2.2 Adulte und embryonale Stammzellen 245
2.3 Reproduktives und therapeutisches Klonieren 246
2.4 Totipotenz, Pluripotenz, Multipotenz 247
2.5 Stammzellmarker 249
3 Epigenetik 251
4 Ziele der Stammzellforschung 253
4.1 Grundlagenforschung 253
4.2 Medizinische Anwendungen 254
5 Rechtliche Rahmenbedingungen 255
5.1 Grundgesetz, Embryonenschutzgesetz, Stammzellgesetz 256
5.2 Kritik 258
5.3 Rechtliche Probleme für den Forschungsalltag 261
6 Ethische Probleme 265
7 Alternativen zu hES-Zellen? 268
8 Schlussfolgerungen 269
Reproduktives Klonen in „real life“ und in der Science Fiction 272
1 Begriffsklärung des reproduktiven Klonens 272
2 Die technologische Seite des reproduktiven Klonens 273
2.1 Embryosplitting 274
2.2 Zell- bzw. Zellkerntransfer 274
2.3 Mitochondriale DNA 276
2.4 Effizienz des reproduktiven Klonens 276
2.5 Epigenetik und Klonen 279
2.6 Schäden durch das Klonen 282
2.7 Zusammenfassung der technischen Seite 283
3 Die Historie des reproduktiven Klonens 284
4 Anwendungen des reproduktiven Klonens bei Tieren 288
5 Anwendungen des reproduktiven Klonens beim Menschen 297
5.1 Anwendungsfeld Reproduktionsmedizin 297
5.2 Anwendungsfeld Medizin 304
5.3 Science-Fiction-Szenarien 305
6 Rechtliche Seite des reproduktiven Klonens bei Tieren 313
7 Rechtliche Seite des reproduktiven Klonens beim Menschen 315
8 Die ethische Diskussion des reproduktiven Klonens bei Tieren 317
9 Die ethische Diskussion des reproduktiven Klonens beim Menschen 318
9.1 Individuelle Schäden für das geklonte Individuum 320
9.2 Gesellschaftliche Schäden durch das Klonen von Menschen 327
10 Resümee 330
Probleme der Gendiagnostik 331
1 Genetische Grundlagen der Entwicklung 332
2 Die genetische Grundlage monogener und komplexer Krankheiten 338
3 Wissenschaftliche Grundlagen von Gentests 340
4 Gentests und genetische Beratung 344
5 Pränatale Diagnostik 346
6 Soziale Auswirkungen pränataler Diagnostik 353
7 Gendiagnostikgesetz 359
8 Ausblick 367
Risikoanalyse Grüne Gentechnik 369
1 Die technologische Seite des Risikos 369
1.1 Das deterministische Paradigma 372
1.2 Epigenetik als systembiologisches Paradigma 375
1.3 Epigenetisches Paradigma und Risikobewertung 377
1.4 Pflanzenphysiologische Aspekte 378
1.5 Größe und Entschlüsselung des Pflanzengenoms 379
1.6 Konkretion der technologischen Seite des Risikos 380
2 Die gesundheitliche Seite des Risikos 387
2.1 Horizontaler Gentransfer 388
2.2 Allergien 389
2.3 Symptome im Tierexperiment 393
2.4 Zusammenfassung der gesundheitlichen Seite des Risikos 394
3 Die ökologische Seite des Risikos 396
3.1 Die Biodiversität 396
3.2 Das Hybridisierungspotential 399
3.3 Die Resistenzgefahr 400
3.4 Die Bienenproblematik 401
3.5 Zusammenfassung der ökologischen Seite des Risikos 404
4 Die soziale Seite des Risikos 405
4.1 Dritte Welt Länder 405
4.2 Verstärkung von Monokulturen 412
4.3 Die Problematik der Koexistenz 414
4.4 Zusammenfassung der sozialen Seite des Risikos 418
5 Ist Grüne Gentechnik Züchtung? 420
6 Ausgewählte Unfälle der Grünen Gentechnik 421
6.1 Der Reis-Skandal 421
6.2 Der Raps-Skandal 423
6.3 Der Mais-Skandal 423
6.4 Die Gen-Erbse 425
6.5 Verunreinigungen durch Grüne Gentechnik 426
6.6 Zusammenfassung bezüglich der Unfälle 427
7 Alternativen zur Gentechnik 428
7.1 Nachhaltige Landwirtschaft 428
7.2 Analyse der Pflanzenkommunikation 430
7.3 Stärkung des pflanzlichen Immunsystems 430
7.4 Aktivierung natürlicher Biofeinde 431
7.5 Entwicklung einer Push-Pull-Methode 431
7.6 Arten- und Sortenmischung 431
7.7 Biotechnologische Züchtung per Gendiagnose 432
7.8 Zusammenfassung bzgl. der Alternativen zur Grünen Gentechnik 435
8 Resümee: Gesamteinschätzung des Risikos 436
Das genetische Personenkennzeichen auf dem Vormarsch 442
1 Die „Entschlüsselung“ des menschlichen Genoms 442
2 Sprechende und nicht-sprechende Teile der Erbsubstanz 443
3 Der „genetische Fingerabdruck“ 444
4 DNA-Identifizierung nach deutschem Strafprozessrecht 446
5 Risiken in der Praxis 448
6 Allmachtsphantasien von einer „kriminalitätsfreien Gesellschaft“ 450
7 Die internationale Dimension 452
8 Heimliche Vaterschaftstests 454
9 DNA-T als Mittel der Zuwanderungskontrolle 456
10 Fazit 458
Gentechnik und die neue Qualität der Biowaffen 460
1 Gentechnische Veränderung klassischer Biowaffen-Erreger 461
1.1 Bakterien mit unüblichen Krankheitssymptomen 462
1.2 Unsichtbares Anthrax („Tarnkappen-Mikroben“) 462
1.3 Behandlungsresistente Pestbakterien 463
1.4 Schritte bei der Entwicklung eines Biowaffen-Potentials 463
1.5 Genetische Sonnenschutzfaktoren 464
2 Neuartige infektiöse Agenzien 465
2.1 Experimente mit dem Mauspockenvirus 465
2.2 Experimente mit dem Denguefieber 466
2.3 Erforschung von Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren 466
2.4 Analyse des Eindringens in menschliche Zellen 467
3 Synthese gefährlicher Erreger 467
3.1 Das Poliovirus aus der Retorte 468
3.2 Wege zum künstlichen Pockenvirus 468
3.3 Spanische Grippe gentechnisch wiederbelebt 470
4 Vollkommen neue Waffenarten 474
4.1 Nahrungsmittel als Waffen („Food Weapons“) 474
4.2 Sterilisation als Waffe 477
4.3 Terminator-Technologie 477
4.4 Insektenbomber 478
4.5 Aktuelle Projekte in den USA 478
5 Ethnisch spezifische biologische Waffen 480
5.1 Genetische Sequenzen und biologische Effekte 481
5.2 Ethnisch spezifische genetische Marker 482
6 Empfehlungen 490
6.1 Einstellung von Projekten 491
6.2 Grenzziehung und Transparenz 491
6.3 Einschränkung ganzer Forschungsrichtungen 492
7 Zusammenfassung 492
Resümee 494
Literaturverzeichnis 504
Sach- und Personenregister 517
Reproduktives Klonen in „real life" und in der Science Fiction (S. 273-274)
Achim Bühl
Wir wollen uns in diesem Beitrag mit dem reproduktiven Klonen sowohl bei Tieren als auch bei Menschen beschäftigen. Im Vordergrund steht dabei die ethische Debatte, d. h. die Analyse der jeweiligen Argumente, die für oder gegen das reproduktive Klonen sprechen. Wir werden dabei sehen, dass sowohl die Protagonisten als auch die Antagonisten des reproduktiven Klonens argumentativ dem Paradigma des genetischen Determinismus folgen, insofern sie den Menschen auf die Summe seiner Gene reduzieren. In den letzten Jahren sind Klone1 zu einem der beliebtesten Motive in Science- Fiction-Filmen und SF-Romanen geworden. Unsere Vorstellung vom Klonen ist nicht zuletzt durch die filmische Unterhaltungskultur geprägt, welche tiefenpsychologische Ängste des Menschen dystopisch in Szene setzt. Eine Analyse von Science-Fiction-Filmen kann daher helfen potentielle Gefahren des Klonens zu eruieren sowie zu einem tieferen Verständnis unserer medial geprägten „Technikbilder" beitragen.
1 Begriffsklärung des reproduktiven Klonens
Der Begriff Klonen bezeichnet in der Reproduktionsmedizin und der Biotechnologie „die künstliche Erzeugung eines vollständigen Organismus oder wesentlicher Teile davon, ausgehend von genetischer Information, die einem bereits bestehenden Organismus entnommen wurde."2 Die genetisch betrachtet identische Kopie des Organismus wird als Klon bezeichnet, der gewissermaßen das künstliche Pendant eines eineiigen Zwillings darstellt.
Die natürlichen Vorgänge der Befruchtung bzw. der geschlechtlichen Fortpflanzung entfallen beim Klonieren. Im Unterschied zum therapeutischen Klonen3 wird beim reproduktiven Klonen „der Embryo in eine Leihmutter eingepflanzt und die natürliche Entwicklung zum vollständigen Organismus abgewartet." Reproduktives Klonen liegt somit dann vor, „wenn die Klontechnologie mit dem Ziel eingesetzt wird, ein Kind zu zeugen.
Von therapeutischem Klonen wird gesprochen, wenn aus dem geklonten Embryo eine embryonale Stammzelllinie gezüchtet werden soll." Die semantische Aufteilung zwischen dem reproduktiven und dem therapeutischen Klonen ist insofern zu problematisieren, „als sich lediglich Handlungsabsicht und spätere Verwendung des geklonten Embryos unterscheiden." Der Terminus therapeutisches Klonen wird von Kritikern als irreführend bezeichnet, da es sich aktuell noch um Grundlagenforschung handelt und Therapien - wenn überhaupt - erst perspektivisch in Sicht sind.
2 Die technologische Seite des reproduktiven Klonens
Unterschieden wird zwischen zwei verschiedenen Klontechniken, dem Klonen durch Embryosplitting sowie dem Klonen durch Zell- bzw. Zellkerntransfer. Als einfachste Form des Klonierens wird in der Literatur auch die Herstellung von Kopien einzelner Gene oder Genabschnitte genannt, d. h. die Produktion von DNA-Kopien auf molekularbiologischer Basis. Wir wollen den Vorgang des Klonierens jedoch nicht als bloßes genetisches Duplizieren verstanden wissen - „ein in den molekularbiologischen Laboratorien dieser Welt alltäglich hunderttausendfach exerziertes Verfahren"8 - sondern bewusst auf die Reproduktion vollständiger Organismen beschränken.
2.1 Embryosplitting
Beim Klonen durch Embryosplitting werden totipotente Zellen im frühen Embryonalstadium oder zu einem späteren Zeitpunkt durch ein mikrochirurgisches Teilungsverfahren abgetrennt. Die Vorteile dieses Verfahrens bestehen in der relativ leichten Handhabung sowie der hohen Erfolgsrate. Die Nachteile liegen darin, dass die genetischen Anlagen des Embryos vorher nicht bekannt sind, „sie sind eine Mischung der elterlichen Anlagen. Außerdem ist die natürliche Altersgrenze der geeigneten Embryozellen schnell erreicht."9 Es ist davon auszugehen, „dass sich beim Menschen bis zum 8-Zell-Stadium jede entnommene Zelle selbständig zu einem Embryo entwickeln kann."
| Erscheint lt. Verlag | 21.2.2009 |
|---|---|
| Zusatzinfo | XIII, 522 S. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Naturwissenschaften ► Biologie ► Genetik / Molekularbiologie |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie | |
| Schlagworte | Bioethik • Epi-Genetik • Gesellschaft • Humangenetik • Lebenswissenschaften • Systembiologie • Tausch |
| ISBN-10 | 3-531-91418-9 / 3531914189 |
| ISBN-13 | 978-3-531-91418-3 / 9783531914183 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich