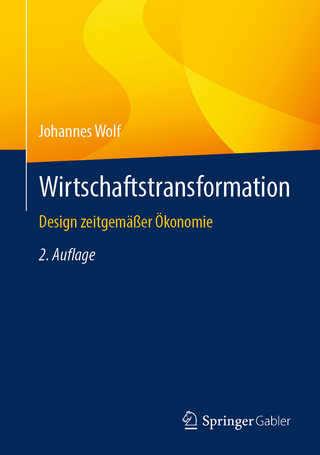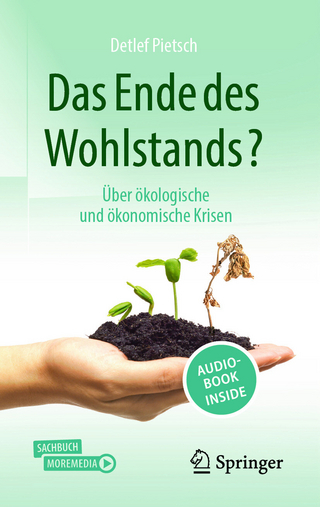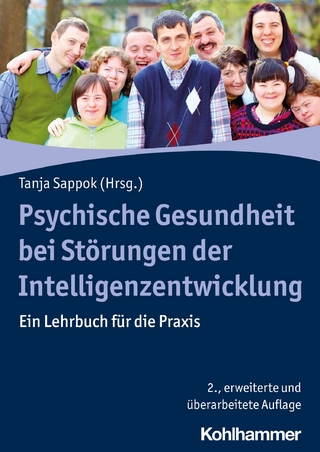Wohin driftet die Arbeitswelt? (eBook)
280 Seiten
VS Verlag für Sozialwissenschaften
978-3-531-90939-4 (ISBN)
Dr. Eva Senghaas-Knobloch ist Professorin für Arbeitswissenschaft mit dem Schwerpunkt sozialwissenschaftliche Humanisierungsforschung im Fachbereich Human- und Gesund-heitswissenschaften an der Universität Bremen und im interdisziplinären Forschungszentrum Nachhaltigkeit (artec).
Dr. Eva Senghaas-Knobloch ist Professorin für Arbeitswissenschaft mit dem Schwerpunkt sozialwissenschaftliche Humanisierungsforschung im Fachbereich Human- und Gesund-heitswissenschaften an der Universität Bremen und im interdisziplinären Forschungszentrum Nachhaltigkeit (artec).
Inhalt 7
Zur Einführung 9
Teil I Wohin driftet die postfordistische Arbeitswelt? 13
Eine veränderte Welt der Erwerbsarbeit – Entwicklungen, Zumutungen, Aufgaben 15
1. Arbeit und Würde 15
2. Gesellschaftliche Entwicklungen, die in die Welt der Erwerbsarbeit reichen 18
3. Trends in der Welt der Erwerbsarbeit 27
4. Zwischenresümee: Gegensätzliche Tendenzen und zunehmende Vielfalt im Erwerbsarbeitsleben 43
5. Neue Anforderungen an die Einzelnen in der Welt der Erwerbsarbeit 45
6. Wohin driftet die Welt der Erwerbsarbeit? 55
Literatur 58
Teil II Subjektivität und betriebliche Arbeitskulturen 68
Subjektivität und Sozialität in ihrer Bedeutung für eine menschengerechte Gestaltung von Arbeit und Technik 69
1. Subjektivität 71
2. Sozialität 82
3. Bedeutung von Subjektivität und Sozialität für die Humanisierungspolitik 94
Literatur 96
Autonomie und Authentizität im postfordistischen Erwerbsarbeitsleben 101
1. Wie passen Zielsetzungen von Individuen und Organisationen zusammen? 101
2. Einpassung durch Hierarchie 103
3. Einpassung durch organisationsinterne Vermarktlichung 109
4. Berufliche Arbeitsrolle als Schutzmantel für Subjektivität 115
Ausblick 122
Literatur 123
Widerständigkeit von Arbeitskulturen – am Beispiel der Einführung von Gruppenarbeit für Meister in der industriellen Produktion 131
1. Bedürfnisse nach Anerkennung und Würde und ihrer Bedeutung für Arbeitskulturen 134
2. Strategien der Abwehr gegen arbeitskulturelle Veränderungen. Ein Beispiel bei der Einführung von Gruppenarbeit 137
3. Arbeitskulturen in intendierten Veränderungsprozessen 145
Literatur 148
Anhang 151
Fairness und Fürsorglichkeit – Praxis und Wünsche an die Qualität sozialer Beziehungen in Familie und Betrieb 153
1. Familie und Betrieb – zwei soziale Orte, zwei Praxiserfahrungen 153
2. Was heißt guter Umgang miteinander in Familie und Betrieb? 158
3. Gerechtigkeit als Fairness und Fürsorglichkeit 167
Literatur 171
Teil III Fürsorgliche Praxis in einer Tätigkeitsgesellschaft 175
Fürsorgliche Praxis und die Debatte um einen erweiterten Arbeitsbegriff 177
1. Zur Trennung von Berufswelt und Familienwelt 179
2. Merkantilisierung der Arbeitskraft und das Schicksal fürsorglicher Praxis 183
3. Dienstleistungsgesellschaft und ihr spezifisches Vereinbarkeitsdilemma – ein Ausblick 189
Literatur 193
Grenzverwischungen in der postfordistischen Arbeitswelt als Herausforderung für das feministische politische Projekt 199
1. Phänomene postfordistischer Entstandardisierung und Grenzverwischungen 203
2. Konzeptionen zur gesellschaftlichen Neubewertung von Tätigkeiten 209
3. Die Bedeutung von Erwerbsarbeit im feministischen Projekt 215
4. Handeln im öffentlichen Raum und das politische Projekt feministischen Denkens 222
Literatur 229
Teil IV Zur Methodik empirischer Arbeitsforschung 236
Die analytische und die kommunikative Aufgabe der arbeitsbezogenen Sozialforschung 237
1. Theorieinteresse und Gestaltungsauftrag 237
2. Forschungspraxis und Kommunikatives Handeln 242
3. Arbeitsforschung als Unterstützung von professioneller Selbstbesinnung und als interdisziplinärer Dialog im öffentlichen Diskurs 248
4. Sozialforschung als Unterstützung organisationsinterner Verständigungsprozesse 262
5. Ausblick: Sozialforschung angesichts neuer Rationalisierungs- und Beteiligungskonzepte 273
Literatur 275
Quellenverzeichnis 279
Eine veränderte Welt der Erwerbsarbeit – Entwicklungen, Zumutungen, Aufgaben (S. 15)
1. Arbeit und Würde
Die Überzeugung, „dass die Arbeit eine fundamentale Dimension der Existenz des Menschen auf Erden darstellt" (Laborem Exercenc, 1981, S. 9), teilt die katholische Kirche seit der päpstlichen Enzyklika „Rerum Novarum" von 1891 mit der Arbeiterbewegung, die sich im Kampf um Würde und Recht der Lohnarbeitenden konstituierte. Im Protestantismus – ob lutherischer oder reformierter Prägung – wird der Arbeit im menschlichen Dasein eine grundlegende Bedeutung zuerkannt.
Welche Tätigkeiten allerdings als Arbeit bezeichnet werden, und die Gegenstände, Formen und Wertschätzung der Arbeit, ihre Regulierung und die Orte, an denen sie verrichtet wird, veränderten sich im Zuge der epochalen Entwicklungsprozesse, in denen sich wirtschaftliche und politische Gemeinwesen herausbildeten. Seit der Epoche der industriellen und bürgerlichen Revolutionen in Westeuropa ist die menschliche Arbeit in den Mittelpunkt gesellschaftspolitischer Aufmerksamkeit gerückt. Besonderes Interesse genießt dabei das Zusammenspiel organisierter lebendiger Arbeit und in Technik vergegenständlichter Arbeit in gesellschaftlichen Austauschverhältnissen.
Es ist die in den gesellschaftlichen Austausch einbezogene Arbeit, die Erwerbsarbeit, die seit der bahnbrechenden Entdeckung von Adam Smith, dass Wohlstand durch Arbeitsteilung und Technik vermehrt wird, die alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Erst in jüngster Zeit gibt es eine Wiederbelebung von Debatten darüber, in welcher Weise auch die Tätigkeiten, die nicht in den gesellschaftlichen Austausch einbezogen sind (freiwillige Tätigkeiten, Ehrenämter, (Für-) Sorge um Angehörige) Anerkennung und Wertschätzung erfahren können.
Diese Debatte ist um so wichtiger, als die klassische industriegesellschaftliche Ökonomie die Wertschätzung und die Minderachtung bestimmter Tätigkeiten, besonders der Tätigkeiten fürsorglicher Praxis, bis heute stark geprägt hat. Mit dem Begriff der produktiven Arbeit ging die besondere Wertschätzung solcher Arbeit einher, die sich in Gegenständen manifestiert, für die auf dem Markt ein Tauschwert erzielt wird.
Sowohl die Entgegenständlichung vieler Erwerbstätigkeiten in den reifen Industriegesellschaften als auch Dienstleistungen im Kontext sehr vielfältiger informeller Wirtschaftstätigkeiten in der übrigen Welt machen eine solche Wertschätzung obsolet. Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) in Genf, die 1919 im Zuge der Friedensverhandlungen nach dem ersten Weltkrieg gegründet worden ist, um weitere Kriege durch die Förderung sozialer Gerechtigkeit zu vermeiden, hat angesichts dieser weltweiten Lage im Arbeitsleben zur Jahrhundertwende das politische Leitziel der menschenwürdigen Arbeit (decent work) entwickelt.
Dieses Leitbild beruht auf der Auffassung, dass Menschen quer durch alle Kulturen und Entwicklungsniveaus eine faire Chance suchen, um durch eigene Anstrengungen ein gedeihliches Leben zu führen (International Labour Office 2001, S. 6)2. Menschenwürdige Arbeit ist in diesem Verständnis mit einer gewissen wirtschaftlichen Unabhängigkeit durch eigene Anstrengungen, mit sozialem Schutz zur Risikoabsicherung, mit gleichberechtigter Mitgliedschaft in der Gemeinschaft sowie mit Selbstbestätigung durch Anerkennung verbunden.
In welcher Weise Arbeit tatsächlich diese Ansprüche erfüllen kann, hängt von den Institutionen, Regeln und Gebräuchen in den verschiedenen Ländern ab. Die folgende Erzählung des Afrikanisten Elwert kann hilfreich sein, einige Denkgewohnheiten der eigenen Kultur zumindest in Frage zu stellen:
„Als ich im Februar 1999 in dem Ayizo-Dorf Ayou Bekannte begrüßte, fragten sie mich nach meiner Arbeit. Erstaunt fasste einer nach: ‚Was, bist du immer noch in demselben Beruf wie vor 20 Jahren?’ Sofort begannen die Umstehenden über meinen Kopf hinweg zu diskutieren.
| Erscheint lt. Verlag | 13.5.2008 |
|---|---|
| Zusatzinfo | 280 S. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie | |
| Schlagworte | Arbeit • Arbeitsalltag • Arbeitsforschung • Erwerbsarbeit • Geschlechterverhältnisse • Politik • Soziologie • Struktur • Zeitdiagnose |
| ISBN-10 | 3-531-90939-8 / 3531909398 |
| ISBN-13 | 978-3-531-90939-4 / 9783531909394 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich