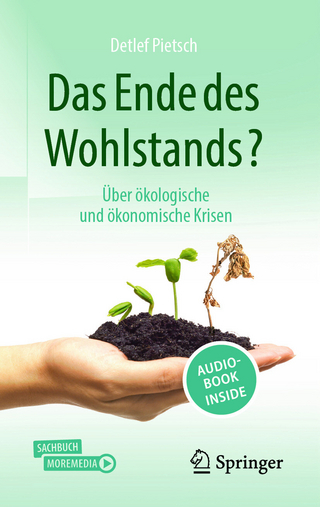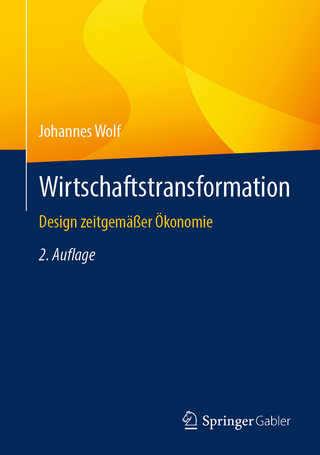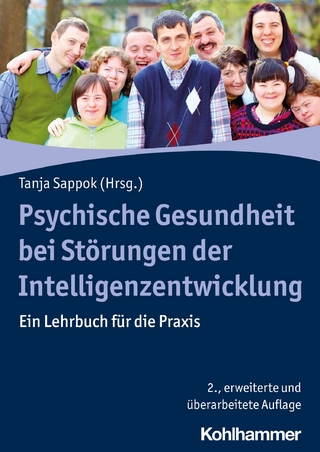Die Ausweitung der Bekenntniskultur - neue Formen der Selbstthematisierung? (eBook)
VI, 362 Seiten
VS Verlag für Sozialwissenschaften
978-3-531-90288-3 (ISBN)
Dr. Günter Burkart ist Professor für Soziologie an der Universität Lüneburg.
Dr. Günter Burkart ist Professor für Soziologie an der Universität Lüneburg.
Inhalt 5
Einleitung. Selbstreflexion und Bekenntniskultur 8
1. Eine neue Bekenntniskultur? 8
2. Individualisierung und Selbstthematisierung 9
3. Eine neue Kultur der Selbstthematisierung 12
4. Theoretische Ankerpunkte 16
5. Selbsterkenntnis, Geständnis und Bekenntnis 20
6. Strukturelle Hintergründe und historische Markierungspunkte 22
7. Funktionen der Selbstthematisierung und ihre Bedeutung für Liebe und Partnerschaft 27
8. Veralltaglichung und Demokratisierung. Autobiografie für jedermann und die neuen Medien 29
9. Arbeit und Selbstverwirklichung 32
Literatur 36
Selbstthematisierung. Von der ( Er-) Findung des Selbst und der Suche nach Aufmerksamkeit 42
Einleitung 42
1. Individualisierung und die Geschichte der Selbstthematisierung: Von der Entdeckung über die Leugnung bis zur Vervielfältigung des Selbst 45
2. Selbstthematisierung in der visuellen Kultur 58
3. Selbstthematisierung im Kampf um Aufmerksamkeit 63
Literatur 68
Vom Beichtstuhl zum Chatroom. Strukturwandlungen institutioneller Selbstthematisierung 74
Einleitung 74
1. Entwicklungen moderner Institutionen der Selbstthematisierung 76
2. Selbstthematisierung im Chat 86
3. Schluss 98
Literatur 100
'Magic Mirrors'. Zur extensiven Ausleuchtung des Subjekts 106
Einleitung 106
1. Marktgerechter Selbstbezug und gesteigerte SelbstkontroIIe als Vergesellschaftungsmodus 109
2. Das Subjekt und sein Begehren - ein Ensemble unbewusster Strukturen und Machtwirkungen 111
3. Ökonomien der Manifestation des Subjekts und des Selbstmanagements 116
4. Imaginäre und phantasmatische Mechanismen der Subjektbildung und Selbstmanifestation 121
Literatur 124
Serielle Einzigartigkeit und Eigensinn 128
1. Schattenseiten der Individualisierung 128
2. Das Konzept des 'romantischen Individualismus' 130
3. Gegentendenzen zur Dominanz des romantischen Individualismus 133
4. Serielle Einzigartigkeit 135
5. Die 'Dialektik' von Individualisierung und Standardisierung 137
6. Ressourcen des Eigensinns 140
7. Resümee 144
Literatur 144
Transformationen des Selbst im spätmodernen Raum. Relational, vereinzelt oder hyperreal? 146
Einleitung 146
1. Raum und Selbst. Theoretische Vorüberlegungen 148
2. Das relational Selbst im elektronischen Raum 152
3. Das Selbst am Nicht-Ort 157
4. Fazit. Das Selbst im spätmodernen Raum 162
Literatur 168
Massenmedien im und als Spiegel der Person 172
1. Theorie des Spiegelselbst und moderne Identitätsproblematik 172
2. Massenmedien als generalisierte Andere 177
3. Massenmedien als Spiegel der Person 179
4. Medien in Personenspiegeln 181
Literatur 183
Dissensfiktionen bei Paaren 186
1. Dissensfiktionen und ihr Stellenwert in der Dialektik von Bezogenheit und Individuation in Paarbeziehungen. Einleitung in die Fragestellung 186
2. Liebe und Partnerschaft als zwei miteinander verbundene Modi des Zusammenlebens als Paar 187
3. Der Begriff der „Konsensfiktion" bei Alois Hahn 188
4. Exkurs: Der Status des 'Als Ob' im menschlichen Handeln. Zur theoretischen Begründung des Begriffs ' Fiktion' 192
5. Dissensfiktionen in Paarbeziehungen 195
7. Dissens- und Konsensfiktionen und ihre Rolle bei den Modi des Paarlebens von Liebe und Partnerschaft 200
Literatur 205
Das erzählte Ich in der Liebe. Biografische Selbstthematisierung und Generationswandel in einem modernen Kulturmuster 208
1. Einleitung 208
2. Der soziale Konnex zwischen romantischer Liebe und Individualisierung 210
3. Argumente für eine Generationsanalyse zum Wandel der Liebe 213
4. Sample und methodisches Vorgehen 216
5. Synopse historischer Rahmenbedingungen beim 'erzählten Ich in der Liebe' 217
6. Fallvignetten aus drei Generationen 219
7. Diskussion. Generationsdynamik im Kulturmuster 'romantische Liebe' 228
8. Schlussbemerkung 230
Literatur 231
Die Veralltaglichung der Patchwork-Identität. Veränderungen normativer Konstruktionen in Ratgebern für autobiografisches Schreiben 236
Einleitung 236
1. Autobiografie als voraussetzungsvolle Form der Selbstthematisierung 237
2. Verdachtsmomente für einen Normenwandel 242
3. Autobiografie-Ratgeber als Forderer und Indikatoren des Normenwandels 249
Literatur 257
Die Herstellung von Biografie(n). Lebensgeschichtliche Selbstpräsentationen und ihre produktive Wirkung 262
Einleitung 262
1. „Doing biography" als Dienstleistung 266
2. „Doing biography" als wissenschaftliche Aktivität 270
3. Herstellung von 'Biografie' durch die Biografieforschung - fünf Aspekte 271
4. Das narrative Interview als „Biografiegenerator" 275
5. Fazit 281
Literatur 282
Eine Romantische Arbeitsethik? Die neuen Ideale in der Arbeitswelt 286
1. Einleitung 286
2. Die Protestantische Arbeitsethik 290
3. Kultureller und struktureller Wandel der Arbeitswelt 295
4. Trägergruppen 299
5. Erfolg durch Selbstverwirklichung 304
6. Schluss 309
Literatur 310
Gibt es Virtuosen der Selbstthematisierung? 314
1. Einleitung 314
2. Typenportraits. Pragmatiker und Virtuosen der Selbstthematisierung 319
3. Spannungsverhältnisse 327
4. Techniken der Selbstthematisierung. Diskurs und Praxis 331
Literatur 336
Wohl dem der eine Narbe hat. Identifikationen und ihre soziale Konstruktion 340
1. „ Jemeinigkeit" 340
2. Identifikation und Identität 344
3. Identifikation durch die Stimme und das Antlitz: Ulrich und seine Familia 347
4. Identifikation im Dunklen: Ruodberts Schnaufen 349
5. Identifikation durch die Narbe: Ulrich und seine Frau Wendilgarth 350
6. Narbenlose Identifikation: Martin Guerre 350
7. Identifikation durch Werke: Tuotilo und Sintram 351
8. Die Narbe des Odysseus 352
9. Identifikationsdispositive 354
10. Die Identifikation in der Sphare des Göttlichen 357
Literatur 360
Zu den Autorinnen imd Autoren 362
Einleitung. Selbstreflexion und Bekenntniskultur (S. 7)
Gunter Burkart
1. Eine neue Bekenntniskultur?
Im Januar 2006 wurde in der ARD ein ausführliches Interview mit der Archäologin Susanne Osthoff gesendet, die vorher im Irak entführt worden war. Nach ihrer Freilassung, deren Umstände von den Behörden geheim gehalten wurden, war in den Medien viel spekuliert worden und sie zum Teil heftig kritisiert. Reinhold Beckmann, der Interviewer, versuchte die Geschichte zu durchleuchten.
Dabei legte er großen Eifer an den Tag, Frau Osthoff persönliche Bekenntnisse abzuringen: zu ihrem Glauben, ihren familiären und persönlichen Beziehungen, ihren Gefühlen gegenüber den Entführern, ihrer kulturellen Identität, ihrer Dankbarkeit für Deutschland.
„Sind Sie dankbar, Frau Osthoff?, fragte Beckmann immer wieder, während er ihr Feuer gab - eine (angesichts der heute fast skandalösen Praxis, im Fernsehen zu rauchen) seltsam antiquierte Höflichkeitsgeste, die in scharfem Kontrast zur unhöflichen Insistenz des bohrenden Fragens stand. Aber trotz dieser intensiven Befragung gelang es dem Moderator nur selten, Bekenntnisse zutage zu fördern.
Auffällig am Interview mit Susanne Osthoff war gerade, dass sie darauf bestand, nicht über ihre privaten Angelegenheiten sprechen zu wollen. Diese Bekenntnis-Verweigerung wirkte fast noch skandalöser als die Missachtung des Rauchverbots - gemessen an der Alltäglichkeit und Selbstverständlichkeit, mit der heute Menschen jeglicher Art öffentlich zu ihren persönlichen Lebensumständen befragt werden und meist auch bereitwillig antworten.
Sie geben Auskunft über sich und ihr Innenleben, weil sie gelernt haben, sich selbst zum Thema zu machen. Selbstaufmerksamkeit und Selbstbeobachtung der Individuen scheinen zugenommen zu haben und damit auch die biografische Reflexivität. Insbesondere die inzwischen weiter ausgefacherte Tsychoszene hat Diskurse der Selbstreflexion und der Selbstverwirklichung hervorgebracht und intensiviert, wie es sie in diesem Ausmaß wohl noch nie gab.
Diese Diskurse - so die weitere Vermutung - sind tief in den Alltag eingedrungen, jedenfalls in den Bildungsschichten, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung stetig gewachsen ist. Eine Gesprächskultur der Selbstthematisierung ist entstanden, die vielfach die Form von Bekenntnis und Geständnis, von sanktionsfreier Selbstenthüllung, annimmt.
Viele Tabus sind inzwischen zurückgedrängt oder gebrochen, es darf über private und intime, das Selbst betreffende Dinge gesprochen werden, wie es früher in diesem Ausmaß nicht möglich war. Dazu kommen neue mediale Formen der Selbstdarstellung und des Identitätsmanagements. Immer wichtiger wird darüber hinaus eine kompetente Balancierung zwischen Selbsterkenntnis und Selbstdarstellung, zunehmend auch im beruflichen Bereich, wo Selbstreflexion und Selbstcoaching zu neuen Zauberformeln der Managerweiterbildung geworden zu sein scheinen.
Damit ist eine zeitdiagnostische These umrissen, die sich auf ein ganzes Bündel von Vermutungen stützt, die genauerer Prufung bedürfen. Die Autorinnen und Autoren des vorliegenden Bandes bemühen sich an ausgewählten Aspekten und unterschiedlichen Themen um einen Beitrag zur Klärung dieser komplexen These.
Diese Einleitung versucht einen Rahmen abzustecken, in dem die einzelnen Beiträge verortet werden können. Zunächst wird Selbstreflexion/ Selbstthematisierung als eine von drei Dimensionen von Individualisierung konzipiert. Nach einem ersten Überblick zur neuen Kultur der Selbstthematisierung und einer kurzen Diskussion theoretischer Grundlagen und begrifflicher Probleme werden die historischen Hintergründe dieser Entwicklung skizziert.
Die Frage nach einer möglichen Reflexionselite wird kontrastiert mit der These der Verallgemeinerung und Demokratisierung: ehemals exklusive Formen der Selbstthematisierung werden nun zunehmend für alle zugänglich. Gerade in den neuen Medien, so scheint es, sind solche Demokratisierungstendenzen zu finden.
| Erscheint lt. Verlag | 7.12.2007 |
|---|---|
| Zusatzinfo | VI, 362 S. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie | |
| Schlagworte | Fernsehen • Gesellschaft • Identität • Kultur • Massenmedien • Media research • Soziologie |
| ISBN-10 | 3-531-90288-1 / 3531902881 |
| ISBN-13 | 978-3-531-90288-3 / 9783531902883 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 20,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich