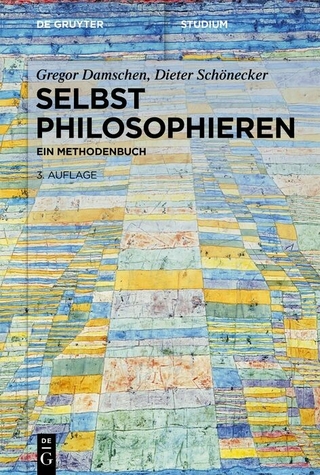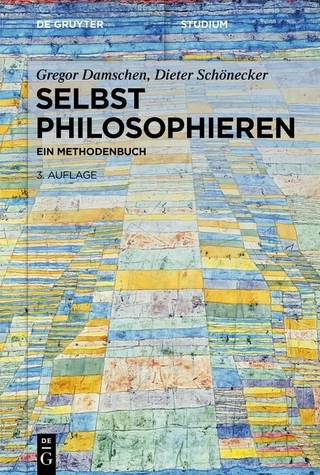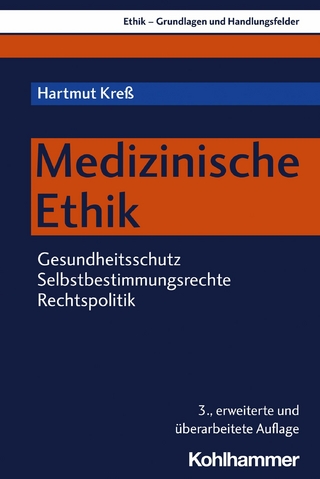Walter Reese-Schäfer, Universität Halle-Wittenberg, ist Verfasser der bei Campus erschienenen Einführungen Richard Rorty (1991) und Jürgen Habermas (2001). Außerdem sind von ihm erschienen Grenzgötter der Moral. Der neuere europäisch-amerikanische Diskurs zur politischen Ethik (1997) sowie Politische Theorie heute. Neue Tendenzen und Entwicklungen ( 2000).
Walter Reese-Schäfer, Universität Halle-Wittenberg, ist Verfasser der bei Campus erschienenen Einführungen Richard Rorty (1991) und Jürgen Habermas (2001). Außerdem sind von ihm erschienen Grenzgötter der Moral. Der neuere europäisch-amerikanische Diskurs zur politischen Ethik (1997) sowie Politische Theorie heute. Neue Tendenzen und Entwicklungen ( 2000).
Inhalt 6
Einleitung 8
1 Kritik des ungebundenen Selbst: Michael Sandel 16
2 Kritik des atomistischen Individualismus: Charles Taylor 26
2.1 Atomismus und Gemeinschaft 26
2.2 Die Civil Society 36
2.3 Kritik der negativen Freiheit 39
3 Ästhet, Manager und Therapeut als Charaktermasken: Alasdair MacIntyre 48
4 Sozialdemokratische rAristotelismus: Martha Nussbaum 66
5 Sphären der Gerechtigkeit: Michael Walzer 79
5.1 Die Methoden des kommunitarischen Denkens 79
5.2 Die Kunst der Trennungen 92
6 Bowling Alone: Robert Putnam 104
7 Die Überwindung des Kulturrelativismus: Amitai Etzioni 112
8 Zusammenfassung: Drei Phasen kommunitarischen Denkens 135
8.1 Die erste Phase kommunitarischen Denkens: Liberalismuskritik 135
8.2 Die zweite Phase: Politischer Aktivismus 139
8.3 Die dritte Phase: Reakademisierung und kommunitarischer Liberalismus 141
Literatur 147
Kurzbiographien 155
|15|1 Kritik des ungebundenen Selbst: Michael Sandel
Michael Sandel hat für das kommunitarische Denken eine wichtige bahnbrechende Funktion gehabt. Seine beiden Hauptsorgen sind: Die Bürger verlieren die Kontrolle über die wichtigsten Faktoren, die ihr Leben bestimmen. Das moralische Gewebe der Gemeinschaften, die die Bürger von der Familie über die Nachbarschaft bis hin zur politischen Selbstorganisation umgeben haben, ist in Auflösung begriffen. Seine Diagnose lautet also: Demokratieverlust und Gemeinschaftsverlust. Daraus resultieren die Unzufriedenheiten und Ängste der gegenwärtigen Zeitsituation. Dem möchte er eine Philosophie des öffentlichen Lebens entgegensetzen (vgl. Sandel 1996).
Entstanden ist das neuere kommunitarische Denken in den USA nicht aus der Praxis, sondern aus einer anfangs sehr akademischen Kritik am individualistischen Liberalismus. Der Begriff »kommunitarisch« bekam in Michael Sandels Buch Liberalism and the Limits of Justice (1982) erstmals eine tragende Rolle. Mit diesem Buch hat die systematische kommunitarische Kritik an der liberalen Vorstellung begonnen, dass Gerechtigkeit Fairness gegenüber den Anspruchsrechten der |16|Individuen sei. Andere Kritiken, wie die von Charles Taylor, sind zwar älteren Datums, haben den Kommunitarismusbegriff aber nicht in dieser schulbildenden Weise verwendet.
Sandel argumentiert gegen John Rawls’ Schrift Eine Theorie der Gerechtigkeit (1979), die weltweit sehr schnell als ein Hauptwerk der politischen Philosophie unseres Jahrhunderts anerkannt worden war. Rawls hatte mit nachhaltiger Wirkung einen Kerngedanken Immanuel Kants in die angelsächsische Diskussion eingeführt: Eine politische Ethik dürfe nicht ein bestimmtes Konzept des Glücks und des guten Lebens zu ihrem Grundprinzip nehmen, weil solche Konzepte völlig unterschiedlich, zufällig zustande gekommen und nicht intersubjektiv verbindlich begründbar seien. Selbst wenn alle für sich den Wunsch hätten, glücklich zu sein (was in der wirklichen Welt nicht unbedingt zutrifft), wären die Vorstellungen vom Glück doch zu unterschiedlich. Vielmehr komme es darauf an, den Bürgern zu ermöglichen, ihre eigenen Zielvorstellungen zu verfolgen, solange sich dies mit der Freiheit eines jeden verträgt. In Kants Schrift Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis [1793] heißt es:
»Niemand kann mich zwingen auf seine Art (wie er sich das Wohlsein anderer Menschen denkt) glücklich zu sein, sondern ein jeder darf seine Glückseligkeit auf dem Wege suchen, welcher ihm selbst gut dünkt, wenn er nur der Freiheit Anderer, einem ähnlichen Zwecke nachzustreben, die mit der Freiheit von jedermann nach einem möglichen allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann (d.i. diesem Rechte des Andern) nicht Abbruch tut.« (Kant 1968, 290)
Was jeder Einzelne sich unter seinem Glück vorstellen soll, darf nicht dekretiert werden. Zu regeln bleibt allein die möglichst gerechte Koordination der unterschiedlichen Lebenskonzepte.
Das Gerechte soll bei Rawls deshalb einen absoluten Vorrang vor dem guten Leben haben. Kein individuelles Recht darf dem Allgemeinwohl geopfert werden. Dies steht im Gegensatz |17|zu der Maxime des klassischen Utilitarismus: Ziel sei das größte Glück der größten Zahl. Dagegen sagt Rawls: »Die Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen, so wie die Wahrheit in Gedankensystemen.« (Rawls 1979, 19) Daraus folgt, dass eine Gesellschaft, die das Glück einiger zugunsten des Wohlergehens der Allgemeinheit opfern wollte, ungerecht wäre. Gerechtigkeit ist nicht einfach ein Ziel unter anderen – etwa neben Wohlstand, Glückseligkeit usw. »Sie stellt vielmehr den Rahmen zur Verfügung, der das Spiel der konkurrierenden Werte und Ziele reguliert.« (Sandel 1984b, 21) Bei Kant basiert das moralische Gesetz auf dem Willen des autonomen Subjekts.
Um die kommunitarische Kritik an Rawls deutlich herauszuarbeiten, ist ein Blick auf einige wichtige Gedanken seiner Lehre notwendig. Er beginnt mit der Konstruktion eines Urzustandes (original position), einer vereinfachten Situation, an der wir unsere politischen und moralischen Überlegungen einem Gerechtigkeitstest unterwerfen können. In diesem Urzustand sind im Prinzip alle gleich und treffen sämtliche Entscheidungen hinter einem Schleier des Nichtwissens über mögliche individuelle Besonderheiten, aus denen Vor- oder Nachteile entstehen könnten. Das heißt, es gibt keine Beschränkung bezüglich des allgemeinen Wissens über Gesetzmäßigkeiten und Theorien. Niemand jedoch weiß, ob er oder sie selbst zu den Armen oder Reichen, den Frauen oder den Männern, zu den Privilegierten oder zu den Benachteiligten gehören wird, niemand kennt seine besondere Situation und ihre besondere Gruppenzugehörigkeit und kann deshalb bei keiner Entscheidung Individual- oder Gruppeninteressen kennen. Keiner weiß z. B., wenn es in dieser fiktiven Diskussion um die Rechte von Behinderten geht, ob er nicht vielleicht selbst behindert sein wird. Die Prinzipien, die wir in einer solchen Situation vernünftigerweise wählen würden, sind nach Rawls die Prinzipien der Gerechtigkeit.
Das Bild des fiktiven Selbst, das in dieser Situation agiert, ist |18|allerdings ein ganz besonderes Bild. Genau an diesem Punkt setzt die kommunitarische Kritik Michael Sandels ein. Zwar wird nicht vorausgesetzt, welche konkrete Person wir sein werden. Voraussetzung ist aber »ein bestimmtes Bild der Person, der Art, wie wir sein müssen, wenn wir Wesen sind, für die Gerechtigkeit die erste Tugend ist. Dies ist das Bild des ungebundenen Selbst, eines Selbst, das vorrangig und unabhängig gegenüber Absichten und Zielen ist.« (Sandel 1984b, 86) Dieses ungebundene oder freischwebende Selbst (the unencumbered self) ist Hauptgegenstand der Kritik. Denn wenn eine derartige Konzeption des Selbst unserem heutigen Selbstverständnis zugrunde liegt, hat das »Konsequenzen für die Art von Gemeinschaft, zu der wir fähig sind« (ebd.). Wir können dann nämlich im Grunde nur freiwillig entstandenen Gemeinschaften beitreten, aber keine weitergehende Verpflichtung für solche Gemeinschaften entwickeln, in die wir hineingeboren sind, wie z. B. die Familie oder die Nation. Diesen Punkt betrachtet Michael Sandel durchaus als eine recht ambivalente Angelegenheit. Die Idee des ungebundenen Selbst ist ja zunächst einmal eine Befreiung von den Diktaten der Natur und den Zwängen sozialer Rollen. Man kann sich durch eigene Entscheidung von seiner Familie, seiner Heimat, seinem Land lösen. Dadurch wird das Subjekt erst souverän. Darin liegt die starke philosophische und politische Attraktivität des Autonomiedenkens. Im Lichte solchen Denkens erscheinen alle traditionellen Bindungen als voraufklärerisch. Zweifellos ist diese liberale Vorstellung in westlichen Gesellschaften ziemlich populär. Sandel hält sie aber für philosophisch falsch und für politisch gefährlich, weil sie ihre eigenen Grundlagen verkennt und durch diese systematische Verkennung gefährdet.
Das Problem wird deutlich, wenn wir die Gerechtigkeitskonzeption von John Rawls noch etwas genauer betrachten. Nach seiner Lehre erscheinen im Urzustand zwei Prinzipien als gerecht, die allen weiteren Überlegungen zugrunde liegen. Das |19|erste fordert gleiche Grundrechte für alle, das zweite erlaubt soziale und ökonomische Ungleichheiten nur dann, wenn diese den am wenigsten begünstigten Mitgliedern der Gesellschaft zugute kommen. Rawls’ eigene erste und vorläufige Formulierung dieser Prinzipien soll hier kurz zitiert werden.
»1. Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist.
2. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, daß (a) vernünftigerweise zu erwarten ist, daß sie zu jedermanns Vorteil dienen, und (b) sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offen stehen.« (Rawls 1979, 81)
Dieses zweite Prinzip, das so genannte Differenzprinzip, ist eine besonders interessante Konstruktion. Es geht zwar von einer grundsätzlichen Gleichheit aller aus, lässt Ungleichheiten aber zu, wenn z. B. durch die dadurch entstehende Konkurrenz die Wirtschaftsdynamik gefördert wird und damit letztlich das Wohl aller, auch das der unteren sozialen Schichten. Rawls vermeidet mit diesem Prinzip das Problem einer auf einem bestimmten Niveau stagnierenden Gesellschaft, wie es meist mit radikalen Gleichheitsforderungen verbunden ist. Aber genau an diesem Differenzprinzip macht Michael Sandel seine Kritik nun fest, handelt es sich doch um ein Teilungsprinzip. Das höhere Einkommen der oberen sozialen Schichten ist nur dann gerechtfertigt, wenn auch die unteren einen Vorteil dadurch haben, den sie andernfalls nicht hätten. Im...
| Erscheint lt. Verlag | 17.9.2001 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Campus Einführungen |
| Campus Einführungen | |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Allgemeines / Lexika |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Civil Society • John • Martha • Michael • Nussbaum • Nussbaum,Martha • Philosophie • Politische Philosophie • Rawls • Rawls,John • Walzer • Walzer,Michael |
| ISBN-10 | 3-593-40019-7 / 3593400197 |
| ISBN-13 | 978-3-593-40019-8 / 9783593400198 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
Größe: 280 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich