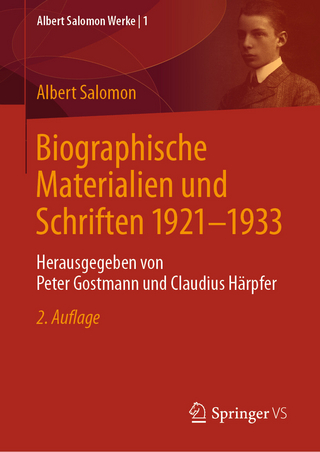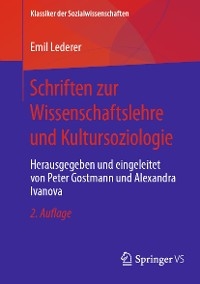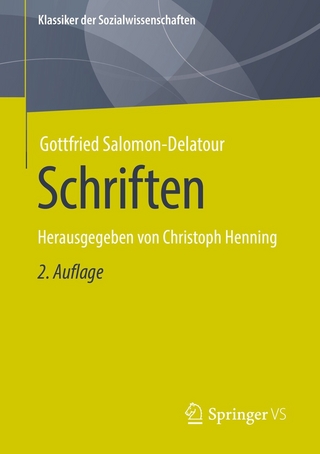Matthias Junge, Dr. phil. habil., geboren 1960, ist Oberassistent am Lehrstuhl 'Allgemeine Soziologie' der TU Chemnitz.
Matthias Junge, Dr. phil. habil., geboren 1960, ist Oberassistent am Lehrstuhl "Allgemeine Soziologie" der TU Chemnitz.
Inhalt 6
1 Einleitung 8
2 Das Phänomen Individualisierung 22
2.1 Problembereiche und Dimensionen von Individualisierung 22
2.2 Eine kurze Geschichte des Individuums und der Individualisierung 30
3 Die Diagnose der Individualisierung 44
3.1 Sozialstrukturelle Individualisierung 44
3.2 Lebenslauf, private Lebensführung und Identität 64
3.3 Solidarität und Individualisierung 81
3.4 Der Wandel des Politischen 97
4 Diskussion 114
Literatur 124
Kurzbiographien 136
Glossar 140
2.1 Problembereiche und Dimensionen von Individualisierung
Wie kann das Phänomen der Individualisierung nun strukturiert dargestellt werden? Eine Möglichkeit besteht darin, seine Auswirkungen in einzelnen gesellschaftlichen Problembereichen als Gliederungsprinzip zu verwenden. Jenseits der historischen Verortung, die das nachfolgende Kapitel leisten wird, ist eine Konzentration auf thematische Felder der Diskussion angebracht.
Daneben ist aber noch eine weitere Unterscheidung nötig. Monika Wohlrab-Sahr (1997) hat vorgeschlagen, Dimensionen des Individualisierungsprozesses voneinander zu trennen und zwischen Individualisierung als strukturellem und als kulturellem Phänomen zu differenzieren. Im Rahmen einer Diskussion des strukturellen Phänomens werden Veränderungen in den objektiven sozialstrukturellen Gegebenheiten gekennzeichnet, beispielsweise die nachlassende Bedeutung von Klassen und eine zunehmende Arbeitsmarktindividualisierung. Von diesem Zugang ist die Diskussion um das kulturelle Phänomen zu unterscheiden. Darin bezeichnet |22|Individualisierung eine Form der Zuschreibung, das heißt die alltagsweltliche Annahme, dass das Individuum für das, was geschieht, verantwortlich ist. Die Individuen beschreiben sich immer mehr als die entscheidende Quelle ihrer persönlichen wie auch der gesellschaftlichen Veränderungen.
Die Darstellung der bereichsspezifischen Individualisierungsbegriffe wird entlang dieser beiden Dimensionen erfolgen. Die sozialstrukturelle Dimension versteht Individualisierung als Resultat gesellschaftlicher Differenzierungs- und Modernisierungsprozesse. Mit dieser Perspektive rücken die Ursachen von Individualisierung in den Mittelpunkt. Anders die kulturelle Sichtweise. In ihr geht es vor allem darum, zu beschreiben, wie wir heute die Bedeutung des Individuums in der Gesellschaft sehen. Rekonstruiert wird die kulturelle Form der Selbstbeschreibung des Individuums.
Den »Fahrplan« dieser Einführung und die ausgewählten Problembereiche der Darstellung bildet das Schema der Tabelle 1 auf der folgenden Seite ab.
Die Gliederung folgt zuerst einer Unterteilung der einleitend eingeführten allgemeinen Definition von Individualisierung in einzelnen gesellschaftlichen Problembereichen. Für diese Einführung wurden vier Felder ausgewählt, in denen Individualisierung eine besondere Rolle spielt. Diese sind: Die Phänomene sozialstruktureller Individualisierung, der Zusammenhang von Lebenslauf, privater Lebensführung und Identität, das Problem der Solidarität unter den Bedingungen von Individualisierung sowie das Thema des Wandels des Politischen.
In diesen vier Bereichen werden Individualisierungsprozesse |23|gut sichtbar und lassen sich mit alltäglichen Erfahrungen verknüpfen. Überdies werden in diesen Feldern besonders häufig wissenschaftliche und öffentliche Debatten um die (normative und empirische) Bewertung der Individualisierung geführt. Anhand der vier genannten Bereiche des gesellschaftlichen Lebens – in denen die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen besonders deutlich ausgeprägt ist – lässt sich zeigen, dass Individualisierung sowohl neue Gestaltungsspielräume als auch neue Abhängigkeiten erzeugt.
Tabelle 1: Problembereiche und Dimensionen der Individualisierung
Die sozialstrukturelle Individualisierung zeigt sich am Beispiel des Übergangs von einer Ungleichheitsstruktur, die über Klassenzugehörigkeit angemessen beschrieben werden konnte, zu einer Form sozialer Ungleichheit, die mit den Begriffen des Lebensstils und des Milieus adäquater zu erfassen ist. In diesem Bereich gilt die Vergesellschaftung durch |24|Arbeit als der zentrale Motor von Individualisierungsprozessen. Diese Vermutung wird mit der These verbunden, dass zugleich ein Wandel kategorialer Muster der kulturellen Selbstbeschreibung stattfindet. Das ist bedeutsam, weil sie die Orientierungsraster des Individuums in grundlegender Weise verändert. Denn sich in Klassen zu verorten hat andere Handlungskonsequenzen als sich einer Schicht, einem Stand oder einem Milieu zuzuordnen.
Eine von diesen Veränderungsprozessen betroffene gesellschaftliche Großorganisation sind die Gewerkschaften. Lange Zeit waren sie eine wirkungsvolle Vertretung von Arbeitnehmerinteressen mit einem großen Mitgliederstamm. In ihnen konnte sich ein traditionelles Arbeiterbewusstsein artikulieren, welches sich in Auseinandersetzung mit der Klassenlage bildete. Die allgemeine gesellschaftliche Wohlstandssteigerung seit den 60er Jahren führte jedoch dazu, dass auch die Arbeiterschaft in den Genuss steigender gesellschaftlicher Produktivität einbezogen und damit das Bewusstsein geschwächt wurde, zur Arbeiterklasse zu gehören. Diese Veränderung ging an den Gewerkschaften nicht spurlos vorbei. Die sinkende Bedeutung eines Arbeiter- oder Klassenbewusstseins schlägt sich seit 1991 in sinkenden Mitgliederzahlen und einem rückläufigen gewerkschaftlichen Organisationsgrad nieder. Gab es 1991 noch insgesamt über 13,7 Millionen Gewerkschaftsmitglieder, so waren es 1998 nur noch etwas mehr als 10 Millionen. Im selben Maße ging auch der gewerkschaftliche Organisationsgrad von 41,5 Prozent 1991 auf 32,2 Prozent 1998 zurück (Wiesenthal 2001, S. 344).
Das Individuum findet und entfaltet seine Identität unter anderem entlang der Ordnung des Lebenslaufs und dessen |25|Interpretation als Biographie sowie seiner privaten Lebensführung. Wird das Individuum in Begriffen des Lebenslaufs beschrieben, so wird die strukturelle Dimension der Ordnung des Lebens in den Vordergrund gerückt. Sie wird vor allem durch sozialstaatliche und institutionelle Regelungen der Abfolge von Lebensereignissen und Lebensphasen – die gewohnte Dreiteilung des Lebenslaufs in Vorbereitungsphase, Erwerbsphase und (Alters-)Ruhephase – strukturiert. Auf der anderen Seite erfasst man das Individuum als kulturelle Erscheinung, wenn man den Lebenslauf als Biographie versteht, das heißt als eine deutende Rekonstruktion des Geschehens im Lebensverlauf aus der Perspektive des Individuums. Dann geht es um die Frage der Einordnung von Entscheidungen und Entwicklungen in eine geordnete Abfolge, die als ein kohärentes biographisches Ganzes interpretiert werden kann.
So ist etwa für Studenten das Studium einerseits eine Etappe im Lebensverlauf. Das ist aber eine nur äußerliche Beschreibung, sie sagt nichts über die Perspektive des Individuums auf sein Studieren. Diese Perspektive ist jedoch nötig, wenn man verstehen will, welchen Sinn ein Individuum dem Studium beimisst. Wie passt das Studium zur Person, welchen Stellenwert hat das Studium für die Biographie, warum wurde ein bestimmtes Studienfach gewählt, wie prägte das Studium das weitere Leben? Solche Fragen erschließen den Lebenslauf aus der Innenperspektive der Individuen und suchen die Deutung eines Lebens als einer Einheit zu rekonstruieren.
Eine besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die private Lebensführung. Mit ihr bezeichnet man vor allem die Wahl einer Lebensform. Sie stellt einen wichtigen |26|Ausdruck der Persönlichkeit dar. Im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung ist sie immer mehr eine individuelle Entscheidung jenseits von Konventionen geworden. Dazu hat auch beigetragen, dass die Vielfalt von Formen der Lebensführung zugenommen hat. Heute gehören unter anderem die bürgerliche Kleinfamilie, nichteheliche Lebensgemeinschaften, das Leben als Single und gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften in den Kanon der Formen privater Lebensführung. In diesem Teilbereich haben sich Veränderungen ergeben, die besonders geeignet sind, um Umfang und gesellschaftliche Reichweite von Individualisierungsprozessen zu problematisieren.
Individualisierung bedeutet aber auch, dass eigene Ziele und Wünsche für das Handeln bedeutsamer werden. Wie verträgt sich dies mit der Forderung nach Gemeinsinn und Solidarität der Individuen untereinander? Der dritte Bereich ist dieser Frage gewidmet. Denn es wird immer wieder der Verdacht geäußert, dass Individualisierung mit Atomisierung und damit Entsolidarisierung verbunden ist. Ob dem so ist, ist eine offene Frage. Ihre Beantwortung wird dadurch erschwert, dass im Individualisierungsprozess auch neue Formen der Vergemeinschaftung und damit neue Formen der Solidarität entstehen.
Der Zusammenhang von Solidarität und Individualisierung kann exemplarisch am Thema des freiwilligen sozialen Engagements verdeutlicht werden. Freiwilliges Engagement kann als eine Art Kitt im sozialen Zusammenleben angesehen werden.Wie steht es um diesen Kitt? Nimmt das Engagement ab? Ist möglicherweise die soziale Solidarität gefährdet, weil die Bereitschaft zum Engagement für andere sinkt? Diesen Fragen kann anhand...
| Erscheint lt. Verlag | 17.6.2002 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Campus Einführungen |
| Campus Einführungen | |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie ► Allgemeines / Lexika | |
| Schlagworte | Beck • Beck, Ulrich • Durkheim • Durkheim, Emile • Emile • Georg • Gesellschaft • Identität • Max • Modernisierung • Simmel • Simmel, Georg • Soziologie • Ulrich • Weber • Weber, Max |
| ISBN-10 | 3-593-40031-6 / 3593400316 |
| ISBN-13 | 978-3-593-40031-0 / 9783593400310 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
Größe: 786 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich