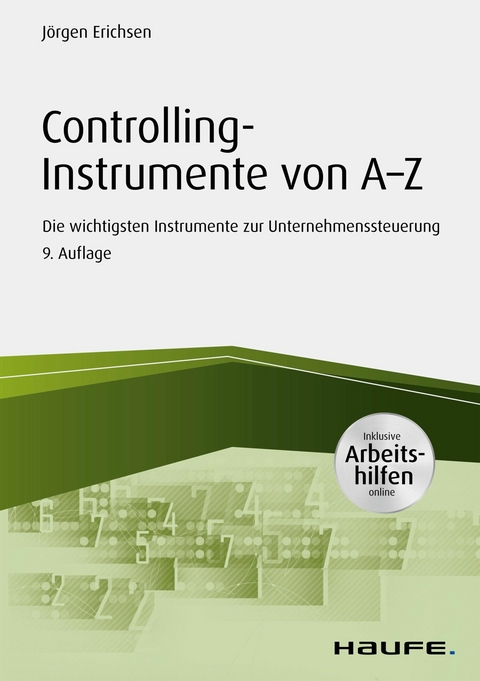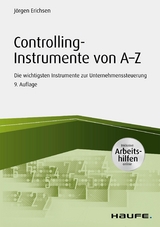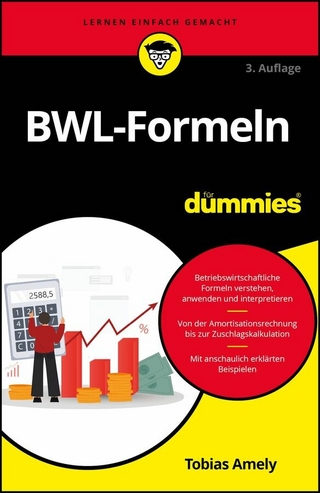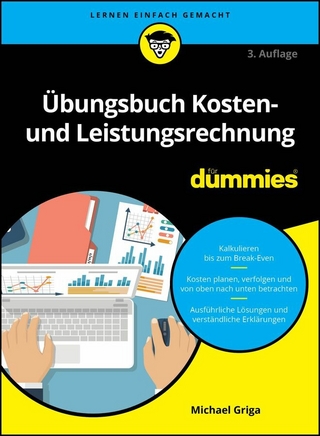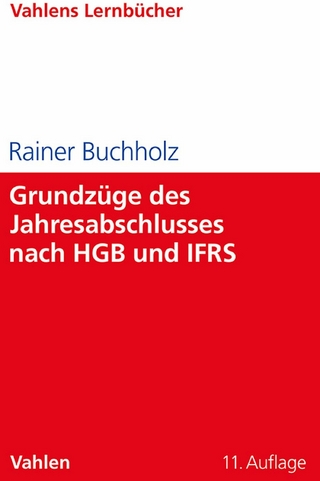Controlling-Instrumente von A - Z (eBook)
482 Seiten
Haufe Verlag
978-3-648-13692-8 (ISBN)
Diplom-Betriebswirt Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater und berät vor allem kleine und mittelständische Betriebe. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Controller, Leiter Finanzen und Projektmanager in der Forschung und Entwicklung in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Als Autor schreibt er Fachbeiträge und Bucher u.a. zu den Themen Controlling, Kostenrechnung, Betriebswirtschaft und Wissensmanagement. Als Referent und Trainer arbeitet er z.B. für die Industrie- und Handelskammern, den Bundesverband der Bilanzbuchhalter und Controller sowie für die duale Hochschule Baden-Württemberg.
Jörgen Erichsen Diplom-Betriebswirt Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater und berät vor allem kleine und mittelständische Betriebe. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Controller, Leiter Finanzen und Projektmanager in der Forschung und Entwicklung in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Als Autor schreibt er Fachbeiträge und Bucher u.a. zu den Themen Controlling, Kostenrechnung, Betriebswirtschaft und Wissensmanagement. Als Referent und Trainer arbeitet er z.B. für die Industrie- und Handelskammern, den Bundesverband der Bilanzbuchhalter und Controller sowie für die duale Hochschule Baden-Württemberg.
Inhaltsverzeichnis
A Operative Instrumente
1 ABC-Analyse
1.1 Was ist eine ABC-Analyse?
1.2 Mögliche Anwendungsbereiche
1.3 So wird die ABC-Analyse durchgeführt
1.4 Maßnahmen abhängig von den Klassen auswählen
1.5 Zeitmanagement und Organisation mit der ABC-Analyse verbessern
2 Auftragsgrößenanalyse
2.1 Was ist die Auftragsgrößenanalyse?
2.2 Ermittlung der Auftragsgrößenstruktur
2.3 Bearbeitungszeiten und -kosten je Auftrag ermitteln
2.4 Ermitteln und Festlegen des Handlungsbedarfs
2.5 Potenzialanalyse von Kleinkunden
2.6 Maßnahmenauswahl zur Verbesserung der Auftragsgrößenstruktur
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Geschäftsbeziehungen mit kleinen Stammkunden
3 Berichtswesen und Kennzahlen
3.1 Berichte
3.2 Kennzahlen
3.3 Wichtige Kennzahlen
4 Break-even-Analyse
4.1 Was ist eine Break-even-Analyse?
4.2 So berechnet man den Break-even-Punkt
5 Deckungsbeitragsrechnung
5.1 Was ist eine Deckungsbeitragsrechnung?
5.2 Einstufige Deckungsbeitragsrechnung
5.3 Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung
5.4 Kundendeckungsbeitragsrechnung
5.5 Preisuntergrenzen berechnen
6 Engpassanalyse
6.1 Was ist eine Engpassanalyse?
6.2 Ermittlung des optimalen Produktionsprogramms
7 Investitionsrechnungsverfahren
7.1 Was ist die Investitionsrechnung?
7.2 Statische Investitionsrechnungsverfahren
7.3 Dynamische Investitionsrechnungsverfahren
8 Liquiditätsplanung
8.1 Was ist eine Liquiditätsplanung?
8.2 Kurzfristige Liquiditätsplanung
8.3 Langfristige Liquiditätsplanung
8.4 Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung
9 Nutzenprovision
9.1 Was ist eine Nutzenprovision?
9.2 Vor- und Nachteile der Nutzenprovision
9.3 So funktioniert die Nutzenprovision
10 Operative Planung
10.1 Was ist eine operative Planung?
10.2 Umsatzplanung
10.3 Plan-Ist-Vergleich
11 Projektcontrolling
11.1 Was sind Projekte?
11.2 Diese Aufgaben hat das Projektcontrolling
11.3 Projektcontrolling in den Projektphasen
12 Rabattanalyse
12.1 Was ist eine Rabattanalyse?
12.2 Rabatte müssen in der Kalkulation berücksichtigt werden
12.3 Die Gewährung zusätzlicher Rabatte
13 Verkaufsgebietsanalyse
13.1 Was ist eine Verkaufsgebietsanalyse?
13.2 Wie läuft eine Verkaufsgebietsanalyse ab?
14 XYZ-Analyse
14.1 Was ist die XYZ-Analyse?
14.2 Wie wird die XYZ-Analyse durchgeführt?
14.3 Ergänzungsmöglichkeiten mit anderen Controlling-Instrumenten
B Strategische Instrumente
15 Balanced Scorecard
15.1 Was ist eine Balanced Scorecard?
15.2 Die Dimensionen der Balanced Scorecard
15.3 Die Balanced Scorecard einführen - grundsätzliches Vorgehen
16 Benchmarking
16.1 Was ist Benchmarking?
16.2 Internes und externes Benchmarking
16.3 Möglicher Ablauf eines externen Benchmarking-Projekts
17 Eigen- oder Fremdbezug?
17.1 Aufgaben an Dienstleister auslagern
17.2 Vor- und Nachteile des Fremdbezugs
17.3 Vorgehensweise bei der Entscheidungsfindung
18 Konkurrenzanalyse
18.1 Was ist eine Konkurrenzanalyse?
18.2 In acht Arbeitsschritten zur Umsetzung
19 Lebenszykluskostenrechnung
19.1 Was ist eine Lebenszykluskostenrechnung?
19.2 Die Lebensphasen von Produkten
19.3 Die Lebenszyklen eines Produkts
19.4 Vorteile und Nachteile einer Lebenszykluskostenrechnung
19.5 Einführung der Lebenszykluskostenrechnung
20 Portfolio-Analyse
20.1 Was ist eine Portfolio-Analyse?
20.2 Mögliche Einsatzfelder der Portfolio-Analyse
20.3 Vorgehensweise am Beispiel der Marktanteils-Marktwachstums-Matrix
20.4 Nachteile der Portfolio Analyse und mögliche Kritikpunkte
21 Potenzialanalyse
21.1 Was ist eine Potenzialanalyse?
21.2 Möglicher Ablauf einer Potenzialanalyse
21.3 Nicht genutzte Potenziale erschließen
22 Prozesskostenrechnung
22.1 Was ist eine Prozesskostenrechnung?
22.2 So funktioniert die Prozesskostenrechnung
22.3 Die Grenzen der Prozesskostenrechnung
23 Risikocontrolling
23.1 Was ist Risikocontrolling?
23.2 Welches Bedrohungspotenzial ist vorhanden?
23.3 Risikomanagement und -controlling
23.4 Risikocontrolling
24 Strategische Lückenanalyse
24.1 Was ist eine strategische Lückenanalyse?
24.
1 ABC-Analyse
1.1 Was ist eine ABC-Analyse?
Die ABC-Analyse ist ein klassisches betriebswirtschaftliches Instrument und Analyseverfahren. Mit ihm können Sie bei zahlreichen Themen und Aufgaben Schwerpunkte im Unternehmen setzen und Prioritäten bilden. Bei der ABC-Analyse vergleichen Sie stets Mengen mit Werten. Die Praxis zeigt immer wieder, dass eine relativ kleine Menge einer Gesamtmasse einen relativ großen Wert ausmacht. Aus Unternehmenssicht lohnt es sich, sich besonders mit den wenigen Mengen zu befassen, bei denen eine große Ergebniswirkung zu erwarten ist. Dabei gilt, dass nur etwa 5 bis 10 Prozent einer Grundmenge rund 70 bis 80 Prozent des Werts bzw. Volumens in Euro ausmachen. Weitere 20 bis 30 Prozent der Grundgesamtheit machen etwa ebenfalls 20 bis 30 Prozent des Werts aus. Die restlichen 70 bis 80 Prozent der Menge machen lediglich 5 bis 10 Prozent des Werts aus.
Bei der ABC-Analyse teilen Sie die Menge von Objekten in die Klassen A, B und C auf. Bei A-Objekten handelt es sich um Positionen mit großer Bedeutung, bei B-Objekten um Positionen mit mittlerer Bedeutung und C-Objekten um solche mit geringer Bedeutung handelt. Es lohnt sich aus Unternehmenssicht, sich auf jene wenigen Objekte zu konzentrieren, mit denen sich große Werte bewegen lassen, z. B. wenn es um Kostensenkungen oder Verhandlungen mit Lieferanten um Materialpreise geht.
Die ABC-Analyse kommt zwar ursprünglich aus dem Bereich Materialwirtschaft. Inzwischen wird sie aber auch darüber hinaus eingesetzt, weil die Praxis zeigt, dass sich die grundlegenden Erkenntnisse nahezu auf alle betrieblichen Bereiche übertragen lassen.
Abb. 1: Typische Verteilung von Mengen- und Wertanteilen
1.2 Mögliche Anwendungsbereiche
Die ABC-Analyse lässt sich in vielen Bereichen einsetzen, etwa bei:
- Material/Rohstoffe
- Kostenarten
- Kunden
- Produkte/Artikel/Leistungen/Aufträge
- Arbeitszeiten/Zeitmanagement
- Risikoanalyse und -bewertung
Ziel der ABC-Analyse ist es immer, eine große Grundgesamtheit, z. B. mehrere tausend Artikel, Materialien oder Kunden, handhabbar zu machen und schnell eine große Ergebniswirkung zu erreichen, indem Schwerpunkte und Prioritäten gesetzt werden.
Vorteile der ABC-Analyse
Eine ABC-Analyse durchzuführen, bietet einem Unternehmen insbesondere folgende Vorteile:
- Schnelle und einfache Durchführung, geringer Arbeitsaufwand.
- Konzentration der Ressourcen auf wesentliche Punkte, einfaches Setzen von Prioritäten.
- Schnelle Erfolge, weil man sich auf die wirklich wichtigen und zentralen Punkte konzentrieren kann.
- Auch visuelle oder grafische Darstellung möglich.
Nachteile der ABC-Analyse
Den Vorteilen stehen einige Nachteile gegenüber:
- Nur eine Analyse der Istsituation möglich
- Eher grobe Einteilung in nur drei Klassen, speziell in der mittleren Klasse muss häufig nach Einzelfällen entschieden werden
- Keine Berücksichtigung qualitativer Faktoren oder unternehmenspolitischer Aspekte, z. B. Zahlungs- oder Reklamationsverhalten von Kunden.
1.3 So wird die ABC-Analyse durchgeführt
Die ABC-Analyse lässt sich meist einfach und schnell in nur wenigen Arbeitsschritten durchführen. Die Vorgehensweise wird im Folgenden für den Materialbereich exemplarisch beschrieben. Ebenso können aber auch z. B. Kunden, Kosten, Zeiten oder Artikel mit der ABC-Analyse untersucht werden.
- Zunächst muss eine Liste sämtlicher Materialien, Rohstoffe und Verbrauchsgüter einschließlich der Werte, die im Unternehmen benötigt und verbraucht werden, erstellt werden, z. B. Blech 1 = 40 Stück je 30 EUR, Blech 2 = 50 Stück je 20 EUR, Blech 3 = 100 Stück je 40 EUR, Druckertinte = 100 Stück je 10 EUR, Batterien AAA = 10 000 Stück je 0,5 EUR usw. Dies ist i. d. R. problemlos mittels EDV möglich. Wollen Sie nur den Materialbereich untersuchen, müssen Sie gegebenenfalls Verbrauchs- und Büromaterialien ausschließen. Um Zufallsschwankungen zu vermeiden, ist es sinnvoll, mit Jahres-, nicht mit Monatswerten zu arbeiten.
- Dann werden die Materialien nach ihrem Wertanteil sortiert, wobei das Material mit dem höchsten Wert oben in der Liste steht, das Material mit dem niedrigsten Wert unten.
- Anschließend berechnen Sie die Prozentanteile der Werte am Gesamtwert und addieren diese Werte.
- Um die Klassifizierung vorzunehmen, ziehen Sie jetzt bei 70 bis 80 Prozent Wertanteil und bei 80 bis 90 Prozent Wertanteil zwei (gedankliche) Linien. Alle Materialien oberhalb der ersten Linie sind A-Materialien, alle Werte unterhalb der zweiten Linie C-Materialien. Die Werte zwischen den Linien sind B-Materialien.
Abb. 2: Beispiel für eine ABC-Analyse
1.4 Maßnahmen abhängig von den Klassen auswählen
Bei Objekten, die der Klasse A zugeordnet wurden, lohnt es sich immer, sich intensiv um Optimierung zu kümmern. Hier tragen bereits kleine Erfolge überproportional zur Ergebnisverbesserung bei. Bei kleinen Positionen der Kategorie C hingegen »verpuffen« Maßnahmen oft fast wirkungslos. Sie lohnen sich daher nur, wenn Sie freie Kapazitäten haben, die Sie an anderer Stelle im Moment nicht sinnvoll einsetzen können. Wenn überhaupt, sollten Sie hier mit Vereinfachungen und Standardkonzepten arbeiten. Individuelle Anpassungen und Arbeiten sollten nicht geleistet werden.
Beispiel: ABC-Analyse
Ein Unternehmen möchte Maßnahmen zur Kostensenkung umsetzen. Mithilfe der ABC-Analyse wird festgestellt, dass die Materialien A, B, C, D und E rund 40 Prozent der Gesamtkosten, etwa 2 Mio. EUR, ausmachen. Die Kosten für die rund 500 Artikel beim Büromaterial betragen nur 10.000 EUR. Können z. B. bei den Materialien die Einkaufspreise um 2 Prozent gesenkt werden, verbessert sich das Betriebsergebnis bei sonst unveränderten Bedingungen um immerhin 40.000 EUR. Anders beim Büromaterial. Selbst wenn es gelingt, hier Einsparungen von 5 Prozent durchzusetzen, beläuft sich die Einsparung auf lediglich 500 EUR.
Maßnahmenbeispiele für A-Objekte
Die Maßnahmenbeispiele gelten gleichermaßen für Materialien, Kostenarten, Produkte, Kunden oder Personal, müssen aber gegebenenfalls fallweise leicht verändert werden:
- Detaillierte und genaue Markt- und Preisanalysen
- Ausführliche Angebotsvergleiche
- Anbieterauswahl durch umfassende Vergleiche oder Lieferanten-Audits
- Konsequente Vertrags-, Konditionen- und Preisverhandlungen
- Produktionssynchrone Anlieferung von Materialien (just in time, just in sequence), nur geringe Lagermengen sowie möglichst kleine Sicherheitsbestände
- Genaue Bestandskontrollen und Aufspüren von Ursachen von Mehrverbräuchen bzw. Ausschuss
- Persönliche Ansprache und Besuche von Lieferanten und Kunden durch Führungskräfte des eigenen Betriebs
- Intensive Personalauswahl bei Führungs- und Schlüsselkräften
- Forcierung des Verkaufs von Produkten mit hohen Deckungsbeiträgen
- Forcierung der Werbung für Produkte mit hohen Deckungsbeiträgen
- Zahlung höherer Provisionen für Produkte mit hohem Deckungsbeitrag
- Aufwertung guter Produkte durch Zusatzleitungen
- Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen, um Produkt- oder Kunden-Deckungsbeiträge zu erhöhen, z. B. Materialkosten
- Regelmäßige Abweichungsanalysen und gegebenenfalls kurzfristige Umsetzung von Steuerungsmaßnahmen
Maßnahmenbeispiele für C-Objekte
Es gilt grundsätzlich das Gleiche wie bei den A-Objekten:
- Sammelbestellungen von C-Materialen aufgeben, um höhere Rabatte erzielen zu können
- Grundsätzlich Aufbau von Lagern, da die Kosten relativ gering sind
- Umsetzungen von Vereinfachungen bei der Bestandsführung und -kontrolle
- Steuerungsmaßnahmen nur bei größeren und länger anhaltenden Abweichungen
- Weniger intensive Personalauswahl bei weniger wichtigen Mitarbeitern
- Berechnung von Mindermengenzuschlägen oder Mindestverkaufsmengen
- Weiterbelastung bestimmter Kostenpositionen an Kunden, z. B. Frachten, Verpackungen, Bearbeitung
- Keine intensiven Verhandlungen mit Lieferern
- Keine individuelle Kundenansprache, sondern Massenwerbung
- Sicherung des Zahlungseingangs, z. B. durch Vorkasse, Barzahlung, Einzugsermächtigungen
- Auslistung weniger erfolgreicher Produkte und Kunden (oder zumindest...
| Erscheint lt. Verlag | 2.11.2020 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Haufe Praxisratgeber | Haufe Praxisratgeber |
| Verlagsort | Freiburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
| Schlagworte | Betriebs-Praxis • Controlling • Controllinginstrumente • Controllingtools • Controllingwerkzeuge • eBook • E-Book • e-pdf • epdf • E-Pub • EPUB • Liquidität • Rechnungswesen • Rentabilität • Unternehmen • Unternehmenssteuerung • Wirtschaftlichkeit |
| ISBN-10 | 3-648-13692-5 / 3648136925 |
| ISBN-13 | 978-3-648-13692-8 / 9783648136928 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 19,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich