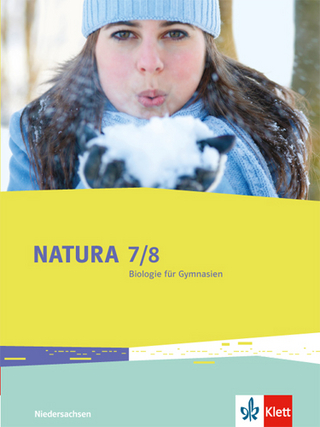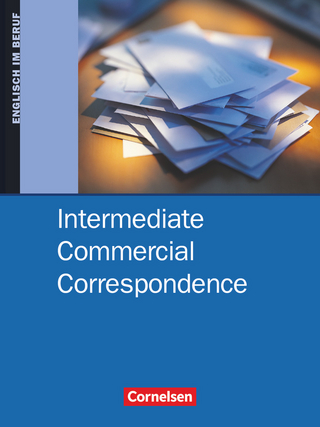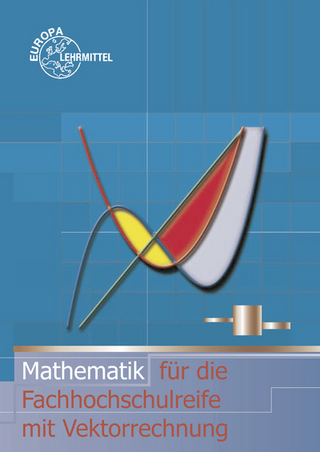Schönheit als Praxis
Campus (Verlag)
978-3-593-39212-7 (ISBN)
Frauen und Männer arbeiten auf unterschiedliche Weise an der Attraktivität ihrer Körper. Ebenso unterscheiden sich die Schönheitshandlungen privilegierter und unterprivilegierter Menschen voneinander. Dieses Buch bietet erstmals eine systematische Analyse klassen- und geschlechts-spezifischer Schönheitspraktiken und verknüpft sie mit der Frage nach sozialer Macht. Anhand von Interviews werden das Spektrum und der Stellenwert von Körperpflege und -manipulation in den verschiedenen Gruppen beleuchtet. In Schönheitsdiskursen und -praktiken, so die Erkenntnis, zeigt sich sowohl das Machtgefälle zwischen den Geschlechtern als auch die Unterlegenheit bildungsferner Milieus. Deutlich wird, dass die klassenspezifischen Unterschiede vielfach größer sind als die Differenzen zwischen den Geschlechtern.
SCHÖNHEIT ALS PRAXISFrauen und Männer arbeiten auf unterschiedliche Weise an der Attraktivität ihrer Körper. Ebenso unterscheiden sich die Schönheitshandlungen privilegierter und unterprivilegierter Menschen voneinander. Dieses Buch bietet erstmals eine systematische Analyse klassen- und geschlechts-spezifischer Schönheitspraktiken und verknüpft sie mit der Frage nach sozialer Macht. Anhand von Interviews werden das Spektrum und der Stellenwert von Körperpflege und -manipulation in den verschiedenen Gruppen beleuchtet. In Schönheitsdiskursen und -praktiken, so die Erkenntnis, zeigt sich sowohl das Machtgefälle zwischen den Geschlechtern als auch die Unterlegenheit bildungsferner Milieus. Deutlich wird, dass die klassenspezifischen Unterschiede vielfach größer sind als die Differenzen zwischen den Geschlechtern.
Otto Penz ist Adjunct Associate Professor am Department of Sociology der Universität Calgary und Lehrbeauftragter an der Wirtschaftsuniversität Wien und Universität Wien sowie an der Universität für angewandte Kunst Wien.
Inhalt
Vorwort
1. Schönheit im 21. Jahrhundert: Entwicklungstendenzen und strukturelle Logik
2. Zur Theorie zeitgenössischer Schönheitspraxis
3. Das Feld der Schönheitspraxis: Vier Berichte
4. Methodische Anmerkungen
5. Sechs Schönheitsklassen
5.1 Natürlichkeit und Individualität - Frauen der oberen Klasse David Loibl
5.2 Attraktivität als verallgemeinerter Normalzustand - Männer der oberen Klasse Philip Thom
5.3 Schönheit zum Wohlfühlen - Frauen der mittleren Klasse Augusta Dachs
5.4 Unauffällige sportliche Schönheit - Männer der mittleren Klasse Christian Hirst
5.5 Schönheit durch intensive Pflege - Frauen der unteren Klasse Barbara Rothmüller
5.6 Kampf gegen Schweiß und Körpergeruch - Männer der unteren Klasse Barbara Rothmüller
6. Schönheitspraktiken im Vergleich
6.1 Geschlechtervergleiche
6.1.1 Die Schönheitspraxis der oberen Klasse David Loibl/Philip Thom
6.1.2 Die Schönheitspraxis der mittleren Klasse Augusta Dachs/Christian Hirst
6.1.3 Die Schönheitspraxis der unteren Klasse Barbara Rothmüller
6.2 Klassenvergleiche
6.2.1 Die männlichen Schönheitspraktiken im Vergleich Christian Hirst/Barbara Rothmüller/Philip Thom
6.2.2 Die weiblichen Schönheitspraktiken im Vergleich Augusta Dachs/David Loibl/Barbara Rothmüller
7. Schönheit und Macht: ein Resümee
Literatur
Was Menschen attraktiv macht
"Ein kluges Buch ... Otto Penz hat eine klassische Studie vorgelegt - stringent und präzise formuliert und trotzdem spannend." (Deutschlandradio, 21.06.2010)
Körper machen Leute
"In seiner empirischen Studie findet der Soziologe Otto Penz Bourdieus Konzept der symbolischen Gewalt besonders anschaulich bestätigt ... Das Schönheitsspiel ist ein Mikrokosmos der allgemeinen sozialen Verhältnisse." (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.07.2010)
Penz und seinen MitautorInnen gelang ein Buch, das Aufschluss über klassen- und geschlechtsspezifische Schönheitshandlungen gibt. Nicht zuletzt die differenzierte Betrachtungsweise und die Verknüpfung von Schönheit und Machtverhältnissen machen "Schönheit als Praxis" zu einem interessanten, klugen und daher lesenswerten Buch. (Zt. für Sexualforschung, 01.11.2011)
Das vorliegende Buch untersucht die Schönheitspraktiken von Frauen und Männern in westlichen spätmodernen Gesellschaften. Dabei werden Schönheitshandlungen in einem weiten Sinn betrachtet: Das Spektrum reicht von der alltäglichen Körperhygiene und regelmäßigen Handlungen, wie Gesichtsrasur und Körperhaarentfernung, bis hin zu außergewöhnlichen Maßnahmen, wie etwa Tätowierungen oder chirurgische Eingriffe. Selbstevident erscheint in diesem Zusammenhang lediglich, dass die Ästhetisierung der Körper noch nie da gewesene Ausmaße erreicht hat und beide Geschlechter sowie alle Klassen der Gesellschaft an diesem Verschönerungsboom beteiligt sind. Darüber hinaus gibt es wenig gesichertes Wissen über die Gründe für persönliche Vorlieben und Abneigungen auf dem Gebiet der Schönheit oder über persönliche Handlungslogiken, aber vor allem fehlt es an wissenschaftlichen Befunden, die zur Systematisierung des Schönheitshandelns beitragen würden, indem sie soziologische Regelmäßigkeiten, etwa milieu- oder klassenspezifische Interessenlagen und Wahrnehmungsweisen, erklären. Während mit enormem Forschungsaufwand der Frage nachgegangen wird, welche Gesichtszüge als schön empfunden werden, gilt der systematischen Analyse der Verschönerungspraxen wenig Aufmerksamkeit, ganz zu schweigen davon, dass die Kontextualisierung dieser Handlungen zumeist im Argen liegt (weil stillschweigend von Nachahmungsprozessen der Schönheitsakteure ausgegangen wird, anstatt die geschlechts- und klassenspezifische Herausbildung der Wahrnehmungsschemata von Schönheit ins Auge zu fassen). Die vorliegende Publikation empirischer Forschungsresultate versucht zur Beseitigung dieses doch erheblichen sozialwissenschaftlichen Defizits beizutragen. Das Werk Pierre Bourdieus stand für die grundsätzliche Ausrichtung der Forschungsarbeit Pate. Den Ausgangspunkt dieser Schönheitsstudie stellten Seminare zur Theorie Bourdieus dar, die ich seit Herbst 2006 am Institut für Soziologie der Universität Wien leite. Eine der Hauptintentionen dieser Lehrveranstaltungen bestand darin, es nicht bei der Vermittlung und kritischen Überprüfung theoretischer Konstrukte bewenden zu lassen, sondern praktischen Nutzen daraus zu ziehen - ganz im Sinne Bourdieus, dass Theorien nicht vorrangig zu theoretischen Diskussionen anregen sollen, sondern zur praktischen Umsetzung. Dementsprechend erstreckten sich die Inhalte der Seminare von der Erörterung theoretischer Denkwerkzeuge auf methodologische und methodische Fragen und führten hin zur empirischen Beobachtung eines Ausschnitts der gesellschaftlichen Lebenspraxis (in Form von Interviews) durch die Studierenden. Das Thema Schönheitshandeln bot sich in diesem Kontext aus mehreren Gründen als Untersuchungsgegenstand der Bourdieu'schen Analyse an: Erstens stellt die körperliche Attraktivität einen überaus wichtigen symbolischen Wert dar, wie aus der Hochkonjunktur der Schönheitsindustrie, aber auch aus den medialen Diskursen zum Schönheitskult ersichtlich wird. Insgesamt bildet das Körperschöne ein mächtiges Symbolsystem, an dem sich die in Bourdieus Theorie zentrale Überlegung der Veranschaulichung sozialer Positionen und Klassenlagen - die Korrespondenz von sozialer Position und symbolischer Äußerung - sowie die Distinktionsbemühungen der Menschen gut studieren lassen. Eher belanglos erscheint in diesem Zusammenhang, wie die Schönheit (im Sinne einer allgemeinen Idealvorstellung) objektiv aussehen mag, vielmehr galt es Aufschluss darüber zu erhalten, welche Maßstäbe subjektiv herangezogen werden, das heißt welchen praktischen Sinn die Menschen für die Inszenierung des eigenen Erscheinungsbildes entwickeln. Zweitens handelt es sich bei den Schönheitspraktiken im wahrsten Sinne des Wortes um körperliche Vorgänge, die an dem rühren, was für gewöhnlich als natürliche Eigenschaft der Personen betrachtet wird. Wir sprechen hier zum einen von Einverleibungsprozessen gesellschaftlicher (Schönheits-)Erwartungen, die die Persönlichkeitsstruktur, den Habitus, auf nachhaltige, weil körperliche Weise prägen, und zum anderen von besonders nahegehenden Kränkungen aufgrund körperlicher Mängel, die als beschämend empfunden werden. Anhand der Schönheitspraxis lassen sich Bourdieus Gedanken zur Inkorporierung objektiver gesellschaftlicher Strukturen empirisch überprüfen, und es lässt sich die Frage verfolgen, wie sich soziale Lagen und Selbstwahrnehmungen somatisieren. Darüber hinaus findet die Arbeit am eigenen Körper auf mehreren sozialen Feldern statt, etwa im Fitnessbereich, aber auch auf dem Gebiet der Ernährung, sodass das Schönheitshandeln eine Art Querschnittsmaterie bildet, die sich ausgezeichnet dazu eignet, die systematischen Verknüpfungen von Handlungen auf unterschiedlichen Gebieten zu einem Lebensstil (dessen generatives Prinzip der Habitus darstellt) zu studieren. Drittens existieren wohl zahlreiche Untersuchungen, die auf enorme geschlechtsspezifische Unterschiede in der Schönheitspraxis hinweisen - auf die Tatsache, dass Frauen wesentlich stärker als Männer dem Diktat der Schönheit ausgesetzt sind -, allerdings insinuiert ein Gutteil dieser Studien, dass dabei die vertikale klassenspezifische Segregation der Geschlechter eine untergeordnete, wenn nicht zu vernachlässigende Rolle spielt. In der vorliegenden Publikation wird demgegenüber von der Annahme ausgegangen, dass das Schönheitshandeln im Kontext beider Strukturen, also als intersektionales Phänomen, zu betrachten ist: Die Handlungen werden einerseits von den Auffassungen über Männlichkeit und Weiblichkeit geprägt, und andererseits davon, was standesgemäß, der sozialen Position entsprechend, richtig erscheint. Zu dieser Kontextualisierung der Schönheitspraxis liegen in Bourdieus Die feinen Unterschiede empirische Ergebnisse vor, die Orientierungsmarken für die gegenständliche Analyse bildeten. Viertens wird Bourdieus Konzeption der symbolischen Gewalt auf dem Gebiet der Schönheit höchst anschaulich. Bourdieus Theorie betont, dass alle sozialen Felder beziehungsweise der gesellschaftliche Raum insgesamt durch Herrschaft strukturiert werden. Auf dem Spiel steht dabei im vorliegenden Fall die Definitionsmacht auf dem Gebiet der Schönheit, oder anders ausgedrückt geht es darum, Partikularinteressen (etwa männliche Sehgewohnheiten) so durchzusetzen, dass sie allgemeine Anerkennung genießen und selbstverständlich erscheinen. In dieser Hinsicht unterliegen im Schönheitsspiel die Frauen regelmäßig der Macht des männlichen Blicks, während die Klassenlagen von Männern und Frauen eine weitere, zweite Form der Ungleichheit bedingen, nämlich zwischen Oben (dem Ort des "guten Geschmacks") und Unten im Verhältnis der eigenen GeschlechtsgenossInnen. Die Studie greift also Bourdieus Gedankengang auf, dass sich in Symbolsystemen allemal Herrschaft manifestiert, und macht das Verhältnis von Schönheit und Macht zu einem zentralen Topos der wissenschaftlichen Analyse - zu einem Thema, durch das sich die vorliegende empirische Arbeit von den meisten anderen Publikationen über Schönheit und Attraktivität unterscheidet.
| Erscheint lt. Verlag | 12.4.2010 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Politik der Geschlechterverhältnisse ; 42 |
| Verlagsort | Weinheim |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 142 x 214 mm |
| Gewicht | 275 g |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Soziologie ► Gender Studies |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie ► Spezielle Soziologien | |
| Schlagworte | Geschlecht • Geschlechterforschung • Hardcover, Softcover / Soziologie/Frauenforschung, Geschlechterforschung • Klasse • Körper • Körperpflege • Schönheit • Schönheitspraktiken |
| ISBN-10 | 3-593-39212-7 / 3593392127 |
| ISBN-13 | 978-3-593-39212-7 / 9783593392127 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich