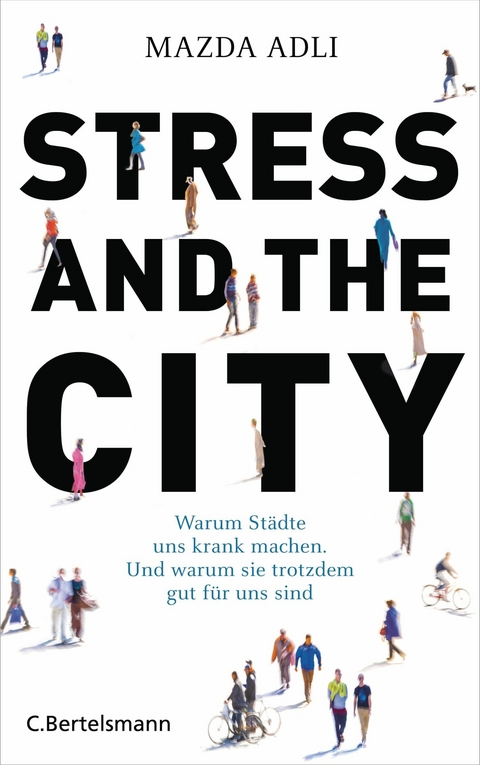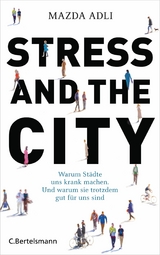Stress and the City (eBook)
384 Seiten
C. Bertelsmann Verlag
978-3-641-16933-6 (ISBN)
Machen Städte krank? Schadet Stadtleben unserer Psyche? Macht nur Landleben glücklich? Provokante Fragen mit brisantem Hintergrund. Denn 2050 werden rund siebzig Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Immer mehr Millionenstädte verändern das Gesicht der Erde. Sie sind die Zentren unserer Gesellschaften. Die Menschen profitieren von der Vielfalt, den kulturellen Ressourcen und den Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung. Gleichzeitig prägen Dichte, Lärm, Hektik, Gewalt und Anonymität den urbanen Alltag. Der Arzt und Psychiater Mazda Adli fragt, wie unser Gehirn auf die permanenten Reize in der Stadt reagiert und ob uns sozialer Stadtstress krank machen kann. Urbanisierung, so sein Fazit, wird sich für unsere Gesundheit als mindestens so relevant erweisen wie der Klimawandel. Gesunde Städte zu formen wird deshalb eine immer dringendere sozial- und gesundheitspolitische Notwendigkeit. Adli plädiert für eine Neurourbanistik, einen interdisziplinären Ansatz für Wissenschaft, Kultur und Politik, um neue Visionen für unsere Städte zu entwerfen. Er sagt: Städte sind gut für uns - wir müssen nur lernen, sie zu lebenswerten Orten zu machen.
Mazda Adli ist Psychiater und Psychotherapeut. Er ist Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin und Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen an der Charité. Im Zentrum seiner wissenschaftlichen Arbeit stehen die Stress- und Depressionsforschung. Nach dem Medizinstudium war er Assistenzarzt an der Klinik für Psychiatrie der Freien Universität Berlin und anschließend Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité am Campus Mitte. 2009 war Adli als Executive Director einer der Initiatoren des World Health Summit. 2010 habilitierte er sich an der Charité. Sein neuestes Projekt ist das Interdisziplinäre Forum Neurourbanistik, das er gemeinsam mit der Alfred Herrhausen Gesellschaft sowie Neurowissenschaftlern, Architekten und Stadtforschern gegründet hat.
2.
Keiner will ihn, alle haben ihn.
Was ist eigentlich Stress?
Daß ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen rasen läutend durch meine Stube. Automobile gehen über mich hin. Eine Tür fällt zu. Irgendwo klirrt eine Scheibe herunter, ich höre ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlich dumpfer, eingeschlossener Lärm von der anderen Seite, innen im Hause. Jemand steigt die Treppe. Kommt, kommt unaufhörlich. Ist da, ist lange da, geht vorbei. Und wieder die Straße. Ein Mädchen kreischt: Ah, tais-toi, je ne veux plus. Die Elektrische rennt ganz erregt heran, darüber fort, fort über alles. Jemand ruft. Leute laufen, überholen sich.
Das sind Eindrücke aus dem Paris des Fin de Siècle. Sie stammen aus den Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, dem berühmten Tagebuchroman von Rainer Maria Rilke. Darin lässt Rilke seine Figur Malte immer wieder von Paris erzählen, der Stadt, in der Malte lebt. Paris war an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hinter London und New York die drittgrößte Metropole der Welt. Als Rilke seinen Roman schrieb, war die Industrialisierung bereits weit fortgeschritten, die Großstädte wuchsen rasant, und sie technisierten sich. Der Verkehr nahm zu, die ersten elektrisch betriebenen Straßenbahnen ersetzten die Pferdeomnibusse, Ampeln wurden aufgestellt. Für Ruhe und müßiges Innehalten blieb kein Platz: »Man kann kaum die Fassade der Kathedrale von Paris betrachten ohne Gefahr, von einem der vielen Wagen, die so schnell wie möglich über den freien Plan dort hinein müssen, überfahren zu werden.« Die Kluft zwischen Arm und Reich in der Stadt vergrößerte sich, es herrschten unwürdige Zustände, es gab Armut und Dreck. Malte beschreibt die Stadt als einen Ort des Überlebenskampfes. Warum die Menschen hierherkamen, er verstand es eigentlich nicht: »So, also hierher kommen die Leute, um zu lieben, ich würde eher meinen, es stürbe sich hier.« Die Szene zeigt eindrücklich: Für Malte Laurids Brigge war Paris mit Lärm, Unruhe, Anspannung, Unsicherheit, in unserem heutigen Sprachgebrauch: mit Stress, verbunden.
Ich habe es selbst erlebt, als ich im Herbst 1992 nach Wien zog. Die erste Zeit dort war für mich eine Phase großer Anspannung. Es war ein kalter, nasser Herbst, und Wien zeigte sich von einer sehr tristen Seite. Manche Städte sind bekannt dafür, im Winter besonders unfreundlich zu sein. Wien gehört dazu. »Eine wie alte leblose Stadt, ein wie großer, von ganz Europa und von der ganzen Welt allein- und liegengelassener Friedhof ist Wien«, schreibt Thomas Bernhard in seiner Erzählung Das Verbrechen eines Innsbrucker Kaufmannssohns und evoziert damit die oft zitierte Morbidität der österreichischen Hauptstadt. Manch wolkenbedeckter Wintertag lässt die baumlosen Straßen mit ihren hohen Fassaden schier in einem schmutziggrauen Häusermeer versinken.
Dazu kam: Das Wien der 90er-Jahre wirkte auf mich wie eine deutsche Stadt aus den 60er-Jahren. Fürchterlich unmodern, von der übrigen Welt isoliert und vergilbt. Für jeden amtlichen Vorgang musste man erst in einer der vielen Trafiken (wie in Österreich Kioske und kleinere Verkaufsstellen genannt werden) Bundesstempelmarken lösen. Die großen Straßen, die alten Gebäude – die Stadt ließ zwar ihre einstige Pracht erahnen, war aber gleichzeitig abgewrackt und verstaubt. Ich wohnte in einer kleinen Einzimmerwohnung im 16. Wiener Gemeindebezirk, die Toilette befand sich auf dem Gang, die sich die Bewohner der Nachbarwohnung und ich teilen mussten. Mir gegenüber wohnte eine mannslustige Alkoholikerin, vor der mich meine Vermieter gleich warnten. Manchmal hörte ich sie auch laut die ganze Nacht mit imaginierten Gesprächspartnern diskutieren. Beim Versuch, in den kälter werdenden Herbsttagen den Ölofen in meiner Wohnung in Gang zu setzen, verwandelte sich das Ding innerhalb weniger Minuten in eine Art glühenden Schmelzofen. Als die Feuerwehrleute eintrafen, war die Wohnung auf beinahe 50 Grad aufgeheizt. Sie löschten den Ofen, klebten ein Sicherheitssiegel drauf, und ich durfte ihn nicht mehr benutzen, bis ein Fachmann ihn geprüft und wieder freigegeben hatte. Das zog sich hin, und ich erlebte die kältesten zwei Wochen meines Lebens. Um nicht zu frieren, ging ich ins Theater. Das hat damals meine große Theaterliebe entfacht. Das Bild der grauen, verrußten Stadt wich dem angenehm staubigen Geruch des Theaterparketts.
So fing ich an, die Stadt für mich zu erobern, ihren Charme zu entdecken und mich auf ihren Lebensrhythmus einzustellen. Nach einigen Wochen gab ich die kleine Wohnung auf und zog in eine Wohngemeinschaft. Doch die erste Zeit in Wien blieb in keiner guten Erinnerung. Es war purer Stress. Ich fühlte mich einsam und der Stadt ausgeliefert.
Guter Stress, schlechter Stress
Ein Beispiel aus der Literaturgeschichte, ein Beispiel aus eigener Erfahrung – der Großstadtstress, der hier beschrieben wurde, entspricht unserer landläufigen Vorstellung von Stress. Der Begriff ist negativ besetzt: Alles ist zu eng, zu laut, zu schnell, zu anonym, und es gibt zu wenig Kontrolle über die eigene Situation. Doch Stress hat immer auch eine andere Seite. Interessanterweise ist der Begriff in der englischen Sprache nicht so eindeutig negativ belegt wie in der deutschen. Wir verbinden mit Stress vor allem körperliche oder seelische Belastung, Unsicherheit und Angst. Auf Englisch kann das Wort auch für Erregung, Anregung oder Betonung stehen. Die physiologischen Definitionen sind ebenfalls eher neutral. Der aus Wien stammende Hans Selye hat das Phänomen 1936 an der Universität von Montreal beschrieben. 1950 verwendete er erstmals den Begriff »Stress« dafür.1 Die Definitionen der Psychologen beziehen sich auf die Reaktion des Organismus auf eine Anforderung – völlig unabhängig davon, ob wir diese als gut oder als schlecht bewerten. Wenn wir an »Stadtstress« denken, ist es hilfreich, sich dieser doppelten Bedeutung bewusst zu sein. Stadtleben kann belasten, es kann aber auch anregen, stimulieren und wach machen und dadurch unsere individuelle Entwicklung befördern.
Die Qualität von Stress und damit seine Auswirkung auf unsere Gesundheit hängen stark von der subjektiven Beurteilung des Einzelnen ab. Der amerikanische Psychologe Richard Lazarus hat darauf das nach ihm benannte Stressmodell aufgebaut.2 Steht man einer Situation gegenüber, von der man glaubt, sie aus eigener Kraft bewältigen zu können, so stimuliert der Stress die Energiereserven und die geistige Leistungsfähigkeit. In so einem Fall kann man sich darauf verlassen, dass man sich nach erfolgreicher Bewältigung der Aufgabe wieder erholen und die Reserven auffüllen kann.
Ein einfaches – und harmloses – Beispiel ist die Teilnahme an einem Wissensspiel, ein Quiz oder irgendein Wettbewerb, bei dem die Mitspieler mit einer Mischung aus Wissen und Kombinationsgabe etwas möglichst schnell erraten müssen. Vielleicht verspüren die Teilnehmer dabei Aufregung und Anspannung, vielleicht auch Unsicherheit über den Ausgang des Spiels. Aber in erster Linie werden sie positiv stimuliert. Eine solche Herausforderung macht den meisten sogar Spaß. Der Stress wird als notwendig, ja sogar als angenehm empfunden. In einer »ernsteren« Situationen befindet sich der Konzertpianist, der vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt steht, oder der Wissenschaftler, der seine Forschungsergebnisse in einem Vortrag erstmals den Fachkollegen vorstellen muss. Die meisten empfinden in solchen Momenten den Stress ebenfalls als stimulierend. Die Aufregung beflügelt und kitzelt eine Höchstleistung heraus, die unter »normalen« Bedingungen kaum zu erbringen wäre.
Einige von uns entwickeln aber in solchen Situationen ein Gefühl der Angst – gerade dann, wenn die eigenen Fähigkeiten zu sehr in Zweifel gezogen werden. Es kommt zu Lampenfieber. Das ist eine Form von sozialer Angst, also Angst vor Bewertung, Bloßstellung und Blamage. Lampenfieber in seiner harmlosen Ausprägung kennen die meisten Menschen, die vor Publikum auftreten sollen, sei es mit einem musikalischen Vortrag, einer Rede oder einem Kunststück. In ihrer übersteigerten Ausprägung kann soziale Angst die Betroffenen allerdings massiv behindern. Die Hände zittern, die Knie werden weich, der Mund wird trocken, und das Gehirn reagiert mit einem Blackout – man verliert den Faden. Rund 50 Prozent der Musiker, so schätzen Studien, leiden unter mehr oder weniger belastendem Lampenfieber. Die Pianistin Martha Argerich, der Tenor Enrico Caruso oder der Stargeiger Nigel Kennedy – sie alle litten oder leiden unter krankhafter Auftrittsangst. Solch eine soziale Angst kann übrigens recht gut durch den Einsatz von verhaltenstherapeutischen Strategien behandelt werden. Man arbeitet dann an der subjektiven Bewertung von belastenden Situationen, die von den Betroffenen meist als viel zu ungünstig eingeschätzt werden, was am Ende zu einer Fehleinschätzung bezüglich deren Bedrohlichkeit führt. Das Ziel ist eine realistischere und günstigere Beurteilung der eigenen Fähigkeiten. Auch Muskelentspannungs- und Atemtechniken helfen dabei.
Wie eine Situation bewertet wird, ob sie herausfordert und die Kräfte mobilisiert oder ob sie ängstigt und mutlos macht, hängt sehr stark von der eigenen Persönlichkeit ab. Gelassene und selbstbewusste Persönlichkeiten sind meist eher optimistisch und machen ihr Selbstwertgefühl nicht vom Bestehen einer Aufgabe abhängig. Es gibt sogar Menschen, die eine richtige »Sehnsucht« danach entwickeln, im Mittelpunkt zu stehen und ein bewunderndes Publikum um sich herum zu haben. Man spricht dann von histrionischen...
| Erscheint lt. Verlag | 9.5.2017 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | eBooks • Gesunde Städte • Großstadtleben und Psyche • Millionenstädte • Städteplanung • Stadtkrankheiten • Stressforschung |
| ISBN-10 | 3-641-16933-X / 364116933X |
| ISBN-13 | 978-3-641-16933-6 / 9783641169336 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich