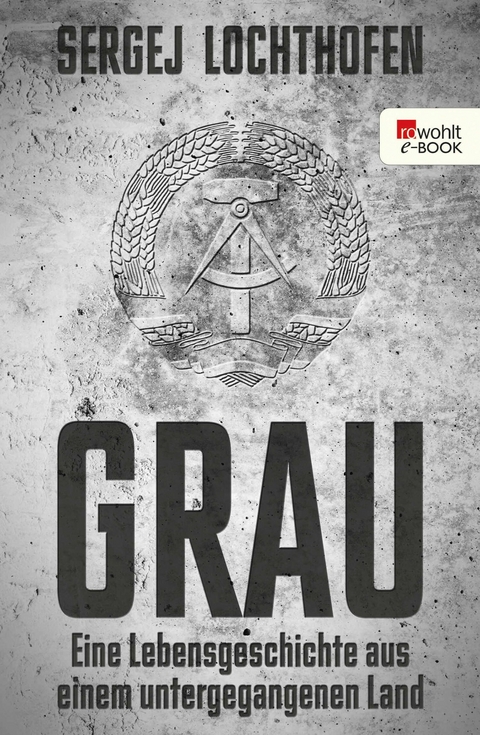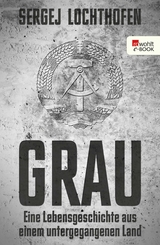Grau (eBook)
496 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-03821-9 (ISBN)
Sergej Lochthofen ist Journalist. Geboren 1953 in Workuta (Russland), kam er als Fünfjähriger mit den Eltern in die DDR, wo er eine russische Schule besuchte; er studierte Kunst auf der Krim und Journalistik in Leipzig. Von 1990 bis Ende 2009 verantwortete er die Zeitung Thüringer Allgemeine. das Medium-Magazin wählte ihn zum regionalen «Chefredakteur des Jahres»; Fernsehzuschauer kennen ihn als Stimme des Ostens im ARD-Presseclub oder in der Phoenix-Runde.
Sergej Lochthofen ist Journalist. Geboren 1953 in Workuta (Russland), kam er als Fünfjähriger mit den Eltern in die DDR, wo er eine russische Schule besuchte; er studierte Kunst auf der Krim und Journalistik in Leipzig. Von 1990 bis Ende 2009 verantwortete er die Zeitung Thüringer Allgemeine. das Medium-Magazin wählte ihn zum regionalen «Chefredakteur des Jahres»; Fernsehzuschauer kennen ihn als Stimme des Ostens im ARD-Presseclub oder in der Phoenix-Runde.
Alles schien verloren.
Ich begann, leise zu weinen.
Am liebsten hätte ich die Blechbüchse in den Fluss geworfen. Stattdessen schöpfte ich weiter. Doch das Wasser im Boot nahm nicht ab. Schmatzte um meine Schuhe. Stieg höher. Und höher.
Die beiden großen Jungs schwiegen.
Das einzige Paddel, das wir hatten, war gerade unter das Eis gerutscht. Mein Bruder schrie «Pass auf», aber da war es Slawka bereits entglitten. Bedrängt von einer dicken Scholle trieb das Boot langsam Richtung Wehr, und was dann passieren würde, verstand sogar ich, mit meinen kaum fünf Jahren. Als Erster löste sich Pawel aus der Starre. Er schob Slawka den Spaten zu, holte unter dem Sitz die Axt hervor und zog sich auf dem Bauch liegend über die Spitze des Bootes weit hinaus.
«Slawka, du ruderst mit dem Spaten, ich versuche, das Eis aufzuhacken. Und du, flenn nicht!», schnauzte er mich an. «Schöpf! Schöpf! Oder wir saufen ab!»
Ich hörte die dumpfen Schläge, sah die Splitter wie kalte Funken in alle Richtungen fliegen. Immer und immer wieder schlug Pawel auf das Eis ein. Doch die mächtige Scholle wollte ihre Beute nicht hergeben.
Dabei hatte unser Abenteuer so wunderbar begonnen.
«Los, komm!»
Pawel steckte seinen Kopf für einen Augenblick durch die geöffnete Küchentür und verschwand wieder. Die Mutter war mit Kara beschäftigt. Sie fischte einen Suppenknochen aus dem Topf und legte ihn in die Hundeschüssel. Die schwarze Schäferhündin ließ die Augen nicht von ihr. Beide waren so konzentriert, dass sie vom Bruder nichts mitbekommen hatten. Kara drehte sich nicht mal um, als ich meine Buntstifte auf den Tisch warf, vom Stuhl sprang und rausrannte. An der Stimme, an seiner ganzen Haltung hatte ich sofort gemerkt, dass draußen etwas Spannendes wartete. Und wenn einen der ältere Bruder aufforderte, ihm zu folgen, gab es nur eins: nichts wie hinterher.
Ich riss meinen schwarzen Winterpelz vom Haken, schob die Mütze in die Stirn und eilte in den Vorbau. Dorthin, wo das Motorrad stand, das gestapelte Ofenholz und das Regal mit den Vorratskisten. Im «Tambor» herrschte fast das ganze Jahr über leichter Frost. Ich sah, wie Pawel die Axt unter seinen Mantel schob und sich den Spaten schnappte. Den hatte der Vater in seiner Werkstatt selbst gemacht, er war etwas Besonderes. Russische Spaten waren klobiger und viel schwerer, auch nicht so handlich. Der Bruder legte den Finger an die Lippen.
Das Wetter war mistig. Kein Schnee, aber auch kein Regen. Unser zweiter Hund Tarzan, eine stattliche Laika-Mischung, schaute uns von der Kohlenkiste aus aufmerksam zu, gab aber keinen Laut von sich. Er kannte nur einen Chef über sich, das war der Vater. Der Rest ging ihn nichts an. Wir rannten um die Pfützen springend zum Fluss hinunter.
Die Workuta staute sich an dieser Stelle und war breit wie ein richtiger Strom. Der «Rudnik», die Siedlung, an deren Rande wir wohnten, lag in einer Krümmung des Flusses. Auf der einen Seite begrenzt durch das Wasser, auf der anderen durch den Stacheldraht des Lagerzauns, hinter dem Tag und Nacht die immer hungrigen Wachhunde bellten. Etwas weiter stromaufwärts, dort, wo die Werkstätten, die Schule und das Magazin lagen, sah man den schwarzen Kegel der Abraumhalde des Schachts. Die eigentliche Stadt Workuta duckte sich auf der anderen Seite des hohen Ufers und war nicht zu sehen. Im Sommer konnte man sie über eine Pontonbrücke erreichen, im Winter über das Eis, auf dem dann sogar Laster fuhren. Nur im Frühjahr und im Herbst während des Eisgangs wurde das Wechseln auf die andere Seite zum Wagnis. Die zwischen den Eisschollen lavierenden Boote waren stets hoffnungslos überladen, und der Fährmann, ein Georgier, der auf den schönen Namen Motoradse hörte, war meistens betrunken.
Vom abfallenden Sandufer erkannte ich es sofort.
Es war der Traum eines jeden Jungen hier. Am Fluss lag ein Boot. Ein richtiges Holzboot. Davor brannte ein Feuer. Pawels Freund Slawka tanzte wie ein Schamane darum herum.
Der Winter war auf dem Rückzug, die Eisdecke vor wenigen Tagen aufgebrochen. In der Mitte des Flusses konnte man schon eine breite Rinne des schwarzen Wassers erkennen. Aber ans Ufer schob sich bedrohlich knirschend ein dicker Brei aus großen und kleinen Eisschollen heran. Blieb stehen, sammelte Kraft und kroch weiter. Ich schaute Pascha, wie mein Bruder auf dem Hof genannte wurde, bewundernd an.
«Das Boot gehört Slawkas Nachbarn. Der weiß nicht, dass wir es geliehen haben. Wenn er dahinterkommt, schlägt er uns tot», erklärte er mir. «Der Pott leckt ein bisschen, aber wir kriegen das schon hin. Slawka hat Teer bei der Bahnwerkstatt aufgetrieben, einen ganzen Eimer. Wir schmieren es in die Ritzen, dann stechen wir in See. Stromaufwärts, auch wenn es nicht leicht wird. Das Boot muss zurück.»
Es war wohl die längste Rede, die mir mein Bruder je gehalten hatte. Ich war erschüttert. Bei sechs Jahren Altersunterschied nahm er mich so gut wie nicht wahr.
Auf dem Feuer blubberte Teer, eine träge schwarze Masse in einer zerbeulten Drei-Kilo-Gurkenbüchse.
«Ich glaub, die Suppe ist fertig», sagte Slawka statt einer Begrüßung. Dabei schaute er auf mich herab, als wollte er sagen: Was will der hier? Ist höchstens eine Belastung. Mein Bruder fing den Blick auf:
«Wenn Haie kommen, schmeißen wir ihn über Bord.»
Die großen Jungs lachten und machten sich daran, das Boot umzudrehen. Ich half nach Kräften. Endlich lag das schwere Ding mit dem Boden nach oben. Slawka begann, mit einer Pappe, einen Spachtel hatte er nicht beschaffen können, Teer in die Fugen zwischen die Planken zu schmieren. Das Holz war durch und durch nass, die Schmiere klebte schlecht, aber das schien die Kapitäne nicht zu stören. Mich schon gar nicht.
Aus dem Gespräch der beiden hatte ich verstanden, dass, sobald der Teer fest war, die Expedition starten würde. Ziel war das offene Wasser. Dann sollte es vorbei am achten Schacht und der unheimlichen Siedlung «Schanghai», die aus einem Sammelsurium von Balken und Brettern bestand, flussaufwärts zum heimatlichen Anlegesteg gehen, woher das Boot stammte. Überhaupt in die Nähe von «Schanghai» zu kommen, hatte mir die Mutter strengstens verboten. Es hieß, es seien ehemalige «Lagerniki», die dort hausten. Entlassene Häftlinge, die nicht mehr in ihre Heimat zurückkonnten, auf die keiner wartete. Viele waren nach den Jahrzehnten hinter Stacheldraht nicht mehr fähig, ein normales Leben zu führen. Krank, oft genug zu Krüppeln geschlagen, blieben sie in der Nähe ihrer Pein, zu schwach, sich dem Bann des Grauens zu entziehen. Einige waren auch zu alt, um irgendwo auf dem «Festland», wie die Welt unten im Süden hieß, einen neuen Anfang zu versuchen. Arbeit fanden sie keine, so vegetierten sie am Rande der Lagerzone, froh, dass sie von der Staatsmacht übersehen wurden. Natürlich hieß es auf dem Hof, in «Schanghai» würden Kinder verschwinden. Ich hatte einmal eine Frau von dort an der Halde gesehen. In Lumpen gehüllt, die mit lauter Stricken und Fäden zusammengehalten wurden, suchte sie im Abraum nach Kohle. Als sie die Mutter und mich sah, wir waren auf dem Weg ins «Magazin», um Brot, Hirse und Milch zu holen, falls es etwas davon gab, kroch sie scheu wie ein Tier die Halde hinauf. Bald konnte man sie zwischen den Gesteinsbrocken nicht mehr erkennen. Sie hatte sicher Angst, wir könnten sie verraten.
Dass die Route des Boots weit über meinen üblichen Horizont hinausführen sollte, beunruhigte mich wenig. Mein Bruder war ja dabei. Was mich weit mehr beschäftigte, war die Frage, ob wir es überhaupt bis zum offenen Wasser schaffen würden. Das andere Ufer schien unendlich weit. Dazwischen schob sich der Eisbrei. Natürlich sagte ich davon nichts, schließlich wollte ich nicht als Feigling dastehen.
Pawel breitete die Expeditionsausrüstung aus: Strick, Enterhaken, wie ihn die Flößer benutzten, ein Holzpaddel, Spaten, die Axt und zwei leere Konservendosen.
«Und wo ist das zweite Paddel?», war ich so unvorsichtig zu fragen. Sofort verfinsterten sich die Mienen der Kapitäne.
«Sei froh, dass wir eins haben. Und wenn du noch mehr dummes Zeug redest, bleibst du gleich da.»
Ich nahm mir vor, den Mund zu halten, obwohl ich gerne noch etwas gefragt hätte. Denn auch das einzige Paddel gehörte nicht uns. Ich wusste, woher es stammte. Von der Beton-Frau, die auf einem Sockel an der Anlegestelle des «Ilijitsch» stand. «Ilijitsch» war der einzige Dampfer, der die Workuta befuhr, er trug den Vatersnamen von Lenin. Das Kunstwerk stellte eine dralle Sportlerin mit Paddel in der Hand dar, das Ideal der sozialistischen Frau, arbeitsam, gesund, optimistisch. Workuta war zwar eine der größten Lagerregionen des Landes, geschaffen, Menschen und Natur zu vernichten, aber ganz ohne Kultur ging es auch hier nicht. Doch irgendjemand musste das missverstanden haben, ihr Busen und ihr Hintern waren frech mit Tinte beschmiert. Das gesellschaftliche Bewusstsein hinkte dem gesellschaftlichen Sein noch weit hinterher.
Jedenfalls hatten sich die beiden Jungs das hellblaue Ruder bei ihr ausgeliehen. Wenn Motoradse das wüsste, hätte er sie ordentlich verbläut. Doch das war jetzt unwichtig. Kaum war der Teer verschmiert, schoben Pawel und Slawka das Boot ins Wasser. Ich musste mich auf das Brett am Heck setzen und Alarm rufen, sollte ein großer Stein den Weg versperren. Das war nicht der Fall. Wir warteten noch eine Weile, bis der Eisbrei am Ufer aufriss, dann ging es mit einem kräftigen Stoß hinaus. Das Wasser war schwarz, unheimlich und anziehend zugleich. Sosehr ich mich darüber freute, bei diesem Abenteuer der Großen dabei zu sein, so sehr sehnte ich mich schon jetzt nach der warmen Küche, nach...
| Erscheint lt. Verlag | 26.9.2014 |
|---|---|
| Zusatzinfo | Zahlr. s/w Abb. |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Zeitgeschichte ab 1945 |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Schlagworte | 9. November 1989 • autobiografische Berichte • Besatzung • Besetzung • Biografie • DDR • Deutsche Geschichte • Deutschland • Donezk • Erich Honecker • Geschichte 1945 bis heute • GULAG • Journalismus • Krim • Kulturelle Integration • Leonid Breschnew • Lorenz Lochthofen • Memoiren • Michail Gorbatschow • Persönliche Erinnerungen • Russland • Sowjetunion • Stalinismus • Thüringen • Transkulturelle Identität • Wende • Zeitgeschichte • Zeitung |
| ISBN-10 | 3-644-03821-X / 364403821X |
| ISBN-13 | 978-3-644-03821-9 / 9783644038219 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich