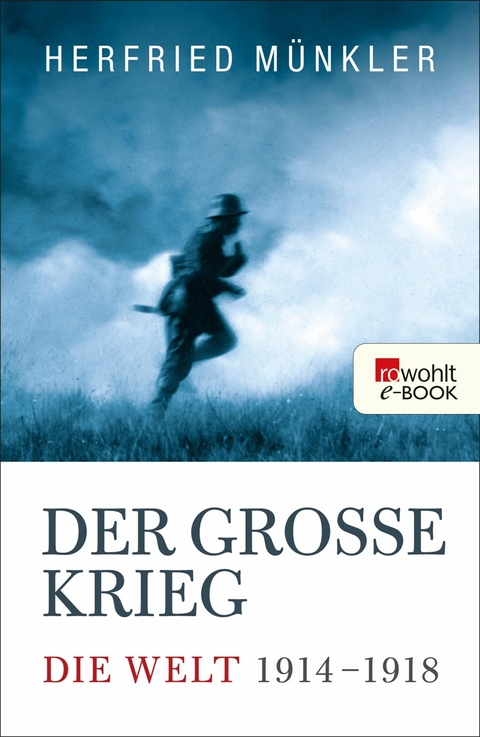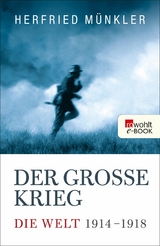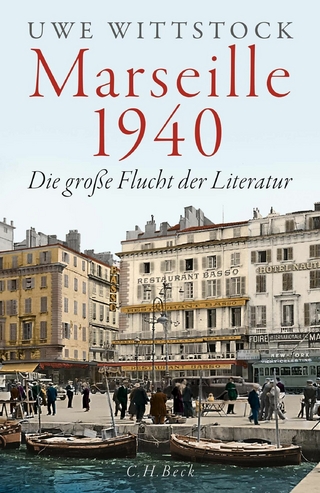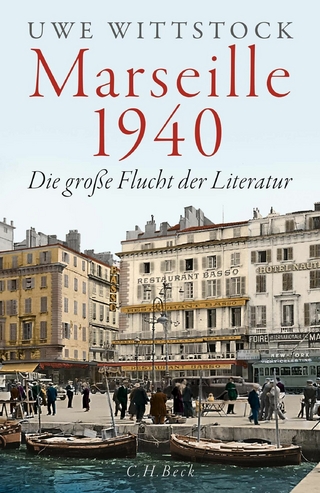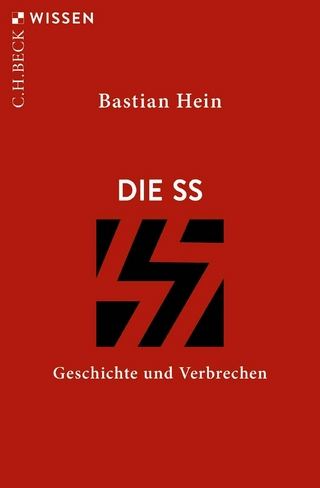Der Große Krieg (eBook)
928 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-11601-6 (ISBN)
Herfried Münkler, geboren 1951, ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität. Viele seiner Bücher gelten als Standardwerke, etwa «Die Deutschen und ihre Mythen» (2009), das mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde, sowie «Der Große Krieg» (2013), «Die neuen Deutschen» (2016), «Der Dreißigjährige Krieg» (2017) oder «Marx, Wagner, Nietzsche» (2021), die alle monatelang auf der «Spiegel»-Bestsellerliste standen. Zuletzt erschien «Welt in Aufruhr. Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert», ebenfalls ein «Spiegel»-Bestseller. Herfried Münkler wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Wissenschaftspreis der Aby-Warburg-Stiftung und dem Carl Friedrich von Siemens Fellowship.
Herfried Münkler, geboren 1951, ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität. Viele seiner Bücher gelten als Standardwerke, etwa «Die Deutschen und ihre Mythen» (2009), das mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde, sowie «Der Große Krieg» (2013), «Die neuen Deutschen» (2016), «Der Dreißigjährige Krieg» (2017) oder «Marx, Wagner, Nietzsche» (2021), die alle monatelang auf der «Spiegel»-Bestsellerliste standen. Zuletzt erschien «Welt in Aufruhr. Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert», ebenfalls ein «Spiegel»-Bestseller. Herfried Münkler wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Wissenschaftspreis der Aby-Warburg-Stiftung und dem Carl Friedrich von Siemens Fellowship.
Einleitung
Der Große Krieg von 1914 bis 1918 war nicht nur die «Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts», wie ihn der amerikanische Diplomat und Historiker George F. Kennan bezeichnet hat, sondern auch das Laboratorium, in dem fast alles entwickelt worden ist, was in den Konflikten der folgenden Jahrzehnte eine Rolle spielen sollte: vom strategischen Luftkrieg, der nicht zwischen Kombattanten und Nonkombattanten unterschied, bis zur Vertreibung und Ermordung ganzer Bevölkerungsgruppen, von der Idee eines Kreuzzugs zur Durchsetzung demokratischer Ideale, mit der die US-Regierung ihr Eingreifen in den europäischen Krieg rechtfertigte, bis zu einer Politik der revolutionären Infektion, bei der sich die Kriegsparteien ethnoseparatistischer, aber auch religiöser Strömungen bedienten, um Unruhe und Streit in das Lager der Gegenseite zu tragen. Der Erste Weltkrieg war der Brutkasten, in dem fast all jene Technologien, Strategien und Ideologien entwickelt wurden, die sich seitdem im Arsenal politischer Akteure befinden. Schon deswegen lohnt sich eine sorgfältige Beschäftigung mit diesem Krieg.
In Deutschland ist der Erste Weltkrieg über lange Zeit nur als Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg angesehen worden. Da dieser den Vorgängerkrieg an Zerstörung, Leid und Grausamkeit noch einmal deutlich übertroffen hat, ist das Interesse am Großen Krieg, wie er in England und Frankreich bis heute heißt, hierzulande zuletzt eher begrenzt gewesen. Er wurde nur noch als Ausgangspunkt einer Erzählung von deutscher Hybris und deutscher Schuld betrachtet, womit er der politiktheoretischen Analyse weitgehend entzogen war. Viele der Herausforderungen, die vor und nach 1914 das Handeln der Politiker und die Erwartungshaltung der Bürger geprägt haben, sind jedoch zwischenzeitlich zurückgekehrt und bestimmen auf die eine oder andere Weise erneut die europäische wie die globale Politik. Der Krieg von 1914 bis 1918 ist dadurch als Feld politischen Lernens wieder interessant geworden. Gerade weil er inzwischen in einem buchstäblichen Sinn Geschichte ist, lassen sich an ihm Konfliktabläufe untersuchen und die Folgen gefährlicher Bündniskonstellationen analysieren. Auf das damalige paradigmatische Reiz-Reaktions-Schema und den Zwang, sich rasch auf neue Situationen einzustellen, wird immer dann verwiesen, wenn sich weltpolitische oder regionale Konflikte wieder einmal gefährlich zuspitzen.
Bei einem weitgehend auf die deutsche Geschichte fixierten Blick mag es nachvollziehbar sein, den Ersten eng mit dem Zweiten Weltkrieg zu verbinden, bis hin zu deren analytischer Verschmelzung zu einem einzigen, nur durch einen längeren Waffenstillstand unterbrochenen Konflikt; manche Historiker haben die Zeitspanne von 1914 bis 1945 gar als einen neuen «Dreißigjährigen Krieg» bezeichnet. Aber schon für Europa vermag diese Engführung von Erstem und Zweitem Weltkrieg kaum zu überzeugen. Sie ist zu sehr auf die Bändigung des großen Störenfrieds der europäischen Politik fokussiert, auf das wilhelminische Reich als die unruhige Macht in der Mitte des Kontinents. Zweifellos war Deutschland im Sommer 1914 einer der maßgeblichen Akteure, die für den Kriegsausbruch verantwortlich waren – aber es trug diese Verantwortung keineswegs allein. Und dass die politischen Probleme, die in den Krieg von 1914 bis 1918 hineingeführt hatten, mit dem Jahr 1945 und der Teilung Deutschlands sowie der Auslöschung Preußens nicht erledigt waren, zeigte sich spätestens nach dem Ende des Kalten Kriegs: Als die Ordnung von Jalta und Potsdam zerfiel, brachen auf dem Balkan lange vergessen geglaubte Konflikte wieder auf. Damit konnte «1945» nicht länger als die Antwort auf die Frage von «1914» angesehen werden. Anstatt den Ersten Weltkrieg wesentlich vom Zweiten her zu betrachten, muss man ihn wieder als ein für sich allein stehendes, komplexes Ereignis behandeln. Ohnehin hat dieser Krieg, wenn man ihn als «Weltkrieg» betrachtet, sehr viel mehr Probleme hinterlassen als die instabile Ordnung Mittel- und Osteuropas. Immerhin ist auch im pazifischen Raum der Zweite Weltkrieg durch kriegerische Handlungen im Jahre 1914 vorbereitet worden: Zwar war etwa die japanische Eroberung einer deutschen Kolonie auf chinesischem Boden ein eher marginales Kriegsereignis und hatte für den Fortgang des Konflikts in Europa so gut wie keine Bedeutung; zusammen mit der Besetzung kleinerer Inselgruppen, die vordem zum deutschen Kolonialreich gehört hatten, verschob sie jedoch das ostasiatische Machtgefüge und führte so zu neuen und weitergehenden Begehrlichkeiten. Auch die Erschütterung der Kolonialverhältnisse in Afrika und Indien infolge des Ersten Weltkriegs war zunächst kaum bemerkbar, zeitigte dann aber doch immer größere Folgen. Das wahrscheinlich größte Problem, das dieser Krieg hinterlassen hat, ist der postimperiale Raum des Nahen und Mittleren Ostens, wo sich nach der Zerschlagung des Osmanischen Reichs Briten und Franzosen zeitweilig die «Beute» teilten, aber nicht in der Lage waren, eine stabile Ordnung mit entwicklungsfähigen Gesellschaften zu etablieren. Mit großer Wahrscheinlichkeit wäre Greater Middle East, wie die Region in der geopolitischen Terminologie der USA heute heißt, auch ohne den Großen Krieg zu einer Konfliktregion geworden (und der Balkan wie der Kaukasus wären es geblieben), aber die dramatischen Beschleunigungseffekte, die der Krieg mit sich gebracht hat, haben die politischen Bearbeitungsmöglichkeiten erheblich eingeschränkt.
Offenbar hat jede Zeit ihren eigenen Blick auf den Krieg von 1914 bis 1918, jede Zeit stellt die für sie dringlichen Fragen an ihn, setzt bei der Beschreibung seines Verlaufs unterschiedliche Schwerpunkte und bezieht ihn auf diese Weise auf ihr Selbstverständnis. Das gilt insbesondere für die Zwischenkriegsära sowie die Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs, als man den Krieg von 1914 bis 1918 als eine unmittelbare Herausforderung begriff und die Deutschen sich anheischig machten, dessen Ergebnisse zu korrigieren. Es zeigte sich aber auch im ersten großen Historikerstreit der Bundesrepublik, in dem es um die Frage ging, ob das Deutsche Reich systematisch auf den Krieg hingearbeitet habe, wie der Hamburger Historiker Fritz Fischer und seine Schüler behaupteten, oder ob politische Fehler und Ungeschick sowie ein verfassungstechnisch nicht unter Kontrolle gebrachtes Militär den Konflikt zum großen Krieg eskalieren ließen, wie Fischers Freiburger Widerpart Gerhard Ritter dagegenhielt. Diese Debatte liegt jetzt ein halbes Jahrhundert zurück, und sie war die letzte größere Auseinandersetzung über den Ersten Weltkrieg, die für die politische Kultur der Bundesrepublik Bedeutung erlangt hat. Spätere Debatten, wie etwa die über den Primat der inneren oder der äußeren Politik, also die Frage, wie die gesellschaftlichen Konstellationen in Deutschland den Weg in den Krieg beeinflussten, oder die über den Erschöpfungsgrad des deutschen Heeres im Herbst 1918, sind auf die Fachwissenschaft beschränkt geblieben. Der Krieg von 1914 bis 1918 hatte zwischenzeitlich seine Brisanz verloren, er war historisch geworden.
Die Historisierung von Ereignissen und Entwicklungen ist freilich die Voraussetzung dafür, dass sie zu einem Objekt politiktheoretischer Analysen werden können. Umso mehr erstaunt es, dass in Deutschland seitdem keine Gesamtdarstellung des Ersten Weltkriegs entstanden ist. Das letzte große Buch dieser Art ist Peter Graf Kielmanseggs Werk Deutschland und der Erste Weltkrieg aus dem Jahre 1968. Danach sind hierzulande eigentlich nur noch Arbeiten zu Einzelaspekten des Weltkriegs erschienen: Man beschäftigte sich mit seiner Entstehungsgeschichte oder mit seinem Ende und dessen Nachspiel, analysierte die Auswirkungen des Krieges auf die Gesellschaft und die Ordnung der Geschlechter, auf Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstruktionen, auf Kunst und Literatur sowie den Schwund des Fortschrittsbewusstseins, der im Gefolge des Krieges in den meisten europäischen Ländern erfolgt ist. Das eigentliche Kriegsgeschehen sparte man dabei in der Regel aus, und wenn man sich ihm doch einmal zuwandte, dann vor allem im Hinblick auf seine Opfer. Diese Perspektive dominierte die historische und politiktheoretische Auseinandersetzung mit dem Krieg – den vielen Opfern wurden einige Verantwortliche gegenübergestellt, die als «Täter» fungierten. Nur lassen sich Täter und Opfer keineswegs immer klar voneinander trennen. Um die komplexen Interaktionszusammenhänge eines Krieges zu erfassen, bedarf es daher einer Gesamtdarstellung, die sich dem Krieg in seiner vollen Dauer sowie seinen unterschiedlichen Facetten widmet. Damit ist nicht gesagt, dass es Gesamtdarstellungen stets gelingt, die vielgestaltigen Wechselwirkungen eines Krieges zu erfassen und angemessen zu beschreiben, aber sie bilden zumindest die einzige Herangehensweise, die diesen Anspruch zu erheben vermag.
Die politische wie wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Weltkrieg war in Deutschland lange Zeit durch die Kriegsschuldfrage geprägt, wenngleich in unterschiedlicher Ausformung: In den zwei Jahrzehnten nach 1919 bemühten sich die deutsche Öffentlichkeit und Politik, den Artikel 231 des Versailler Vertrags zurückzuweisen, der die Alleinschuld des Deutschen Reichs feststellte; in den Jahrzehnten nach der Fischer-Kontroverse hingegen wurde diese Schuld allgemein akzeptiert – auch in der Bundesrepublik und nicht nur in der DDR, wo dem Deutschen Reich immer eine erhebliche Mitschuld am Krieg zugewiesen worden ist, freilich mit dem Hinweis verbunden, dass nicht nur das Deutsche Reich eine imperialistische Politik betrieben habe. Insofern waren die Thesen Fritz Fischers, die den Deutschen die Hauptschuld...
| Erscheint lt. Verlag | 6.12.2013 |
|---|---|
| Zusatzinfo | Zahlr. s/w Abb. |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Neuzeit bis 1918 |
| Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► 1918 bis 1945 | |
| Schlagworte | 14-Punkte-Plan • Compiegne • Dolchstoßlegende • Erster Weltkrieg • Gallipoli • Gaskrieg • Grabenkrieg • Heimatfront • Hindenburg • Ludendorff • Marne-Schlacht • Ostfront • Sarajewo • Schlieffen-Plan • Somme-Schlacht • Stellungskrieg • Triple-Entente • U-Boot-Krieg • Urkatastrophe • Verdun • Versailler Vertrag • Westfront |
| ISBN-10 | 3-644-11601-6 / 3644116016 |
| ISBN-13 | 978-3-644-11601-6 / 9783644116016 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 16,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich