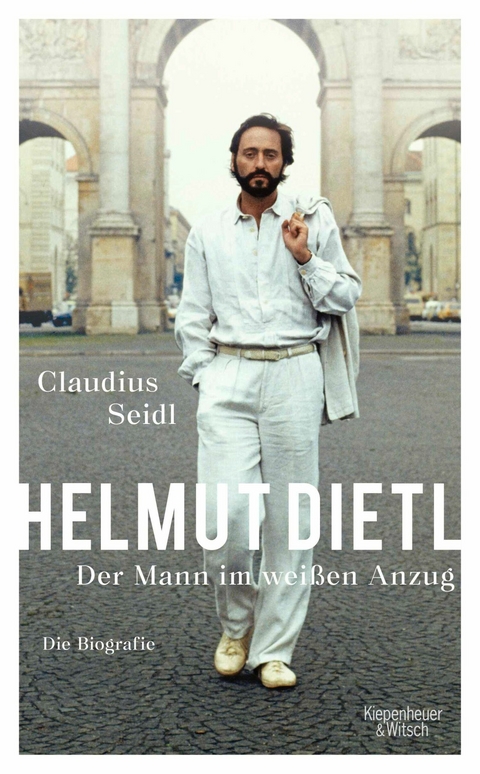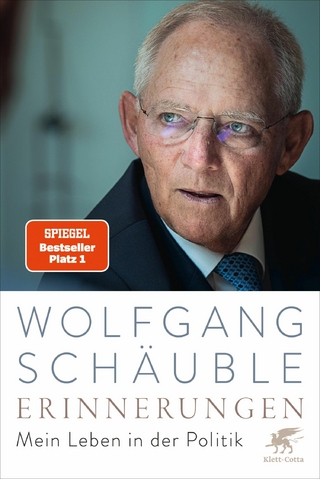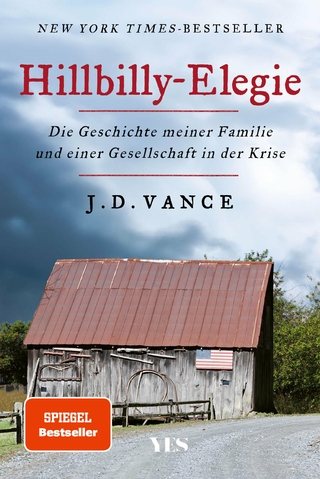Helmut Dietl - Der Mann im weißen Anzug (eBook)
352 Seiten
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH
978-3-462-31653-7 (ISBN)
Claudius Seidl, geboren 1959, Publizist und Filmkritiker. Von 2001 bis 2020 Feuilletonchef der FAS. Heute Autor bei FAZ und FAS. Zahlreiche Buchveröffentlichungen über Film (»Der deutsche Film der fünfziger Jahre«, »Billy Wilder«, »Bilder im Kopf« mit Michael Ballhaus), Musik (»Talking Jazz«). Bei Kiwi u. a. »Hier spricht Berlin« und »Schaut auf diese Stadt« als Herausgeber.
Claudius Seidl, geboren 1959, Publizist und Filmkritiker. Von 2001 bis 2020 Feuilletonchef der FAS. Heute Autor bei FAZ und FAS. Zahlreiche Buchveröffentlichungen über Film (»Der deutsche Film der fünfziger Jahre«, »Billy Wilder«, »Bilder im Kopf« mit Michael Ballhaus), Musik (»Talking Jazz«). Bei Kiwi u. a. »Hier spricht Berlin« und »Schaut auf diese Stadt« als Herausgeber.
IV. Wie weit reicht der Horizont
»Es gibt nur eine Stadt in Deutschland, der Hitler versprach, sie groß zu machen – und die es trotzdem geworden ist.« Mit diesem Satz fing, im Herbst 1964, in dem Jahr also, da Helmut Dietl zwanzig geworden war, die Titelgeschichte des »Spiegels« über München an, die Story, die den Slogan von der »heimlichen Hauptstadt« etablierte und in der es weiter hieß: »Nirgendwo sonst mischen sich Knödeldampf, Bierdunst und Weihrauch so innig mit dem Duft der großen Welt. Nirgendwo sonst fühlen sich Playboys und Professoren, Bayern und Preußen, Sozis und Spezis, Gamsjäger und Kulturkritiker, Dirndl-Matronen und Topless-Twens in gleichem Maße zu Hause wie in ebendieser Stadt.« Das waren die Verhältnisse, wie Dietl sie vorfand, als er erwachsen und dann zum Chronisten dieser Verhältnisse wurde. Und wenn man sich noch einmal vor Augen führt, dass die Mutter eben zwanzig Jahre zuvor, im Frühjahr 1944, aus einem München, das in Trümmern lag und als »Hauptstadt der Bewegung« auch moralisch ruiniert war, nach Bad Wiessee am Tegernsee geflohen war, um dort, einigermaßen sicher, ihren Jungen zur Welt zu bringen, wird einem auch klar, dass die erneute Münchenwerdung Münchens und die Dietlwerdung Helmut Dietls sich zur selben Zeit am selben Ort abgespielt haben; dass es also womöglich einen tieferen inneren Zusammenhang gibt. Die Jahre, in denen Helmut Dietl groß wurde, waren zugleich die Jahre, in denen München aus Ruinen wiederauferstand. Und größer wurde, als es je gewesen war.
Nach München zogen nach dem Krieg die großen Unternehmen um, allen voran Siemens, dem es im belagerten Westberlin zu eng und zu unsicher geworden war. Nach München zog das liberale Bürgertum, das hier nicht nur Jobs fand, sondern auch eine schnell wiederbegründete Hochkultur, zwei Schauspiel-, zwei Opernbühnen, drei Symphonieorchester sowie die Hoffnung auf Lebensfreude und liberalitas Bavariae. Nach München zog es schließlich auch die Schriftsteller und Intellektuellen, die Verlags- und Zeitungsleute, die alle spürten, dass Westberlin zu düster, zu isoliert, zu randständig geworden war, ein ökonomischer und kultureller Pflegefall, nicht mehr kräftig und vital genug für die Rolle der Metropole. Randständig war München auch, es war aber der richtige, der südliche Rand. Man brauchte damals, mit einem PS-schwachen Käfer und ohne Brennerautobahn, dreimal länger bis zum Gardasee. Aber immerhin konnte man sich jetzt so ein Auto leisten. Und die Nähe Italiens lag doch offensichtlich in der Luft, auch wenn man auf der nördlichen Seite der Alpen blieb. »Liederliche Sitten« hatte Thomas Mann einst den Münchnerinnen bescheinigt, und genau das, ein Lebensstil, der anscheinend das Gegenteil des zackigen, martialischen Preußentums versprach, war es, wozu man sich jetzt, nach Weltkrieg und Naziherrschaft, unbedingt bekennen wollte.
Damit aus der »Hauptstadt der Bewegung«, der Stadt also, in der Hitler und die Nazis groß geworden waren mit kräftigen Subventionen aus dem Münchner Großbürgertum, das genaue Gegenteil wurde, die heiterste, südlichste, zukunftsfreudigste deutsche Stadt: Dafür mussten, außer vielen Trümmern, auch große Mengen an Erinnerungen weggeräumt oder zumindest neu zusammengesetzt und frisch gestrichen werden. Und Helmut Dietl hat, als die Stadt dann Schauplatz und Gegenstand seiner Werke wurde, immer wieder darauf bestanden, dass die Vergangenheit nicht verschwunden und noch nicht einmal ganz vergangen war. Dass es also ein paar gute Gründe gab, an der Farbe zu kratzen und in den Trümmern zu wühlen.
Aber für die, die zu jung waren, als dass sie hätten mitschuldig werden können am Krieg und an den Verbrechen der Nazis, war das Leben im München der Nachkriegszeit – obwohl oder vielleicht auch gerade weil die Altstadt, all die Kirchen und Paläste konsequenter als in jeder anderen deutschen Stadt wieder aufgebaut wurden – so neu und unerhört, wie Reinhart Kosseleck das für Frankreich nach der Revolution beschrieben hat. Die Alten waren als Vorbilder und Role Models erledigt. Und von den Jungen wurde die Zeit »als Aufbruch in eine nie da gewesene Zukunft erfahren«.
Und natürlich erfasst dieser Geist auch einen kleinen Jungen, der am westlichen Rand der Stadt München aufwächst, in der Innerstorfer Straße, in einem Viertel, das seinen Namen, Neufriedenheim, von jener Nervenheilanstalt hat, die dort als erstes Gebäude stand. Und in welcher, wegen seelisch-künstlerischer Verwirrtheit, auch der Schriftsteller Oskar Panizza einst zehn Tage lang Patient gewesen war.
Die Familie war nicht reich, wohlhabend nur vorübergehend, bis das große Haus in Neufriedenheim für eine sehr viel billigere Wohnung im Vorort Gräfelfing aufgegeben werden musste, bankrott nach dem Ende des Wirtshaus-Abenteuers am Schliersee. Und als die Eltern dann geschieden waren, zahlte der Vater keinen Unterhalt, und die Mutter arbeitete viel und verdiente wenig. Dass er trotzdem ungeheures Glück mit dieser Familie hatte, in der der Vater meistens weg war – das war Dietl sehr bewusst. Es sieht so aus, als habe es auch in dieser Familie ein paar Geheimnisse gegeben, Dinge, von denen man lieber nicht sprach und schon gar nicht mit einem Kind, tief vergrabene und verschüttete Erinnerungen. Aber es sieht eben auch so aus, als ob es dabei eher um erotische als um politische Verstrickungen gegangen sei, um Fritz Greiners Lebenswandel vor allem und dann um die Frage, wie sein Sohn sich durchgeschwindelt hatte durch den Krieg und wie er es schaffte, rechtzeitig zu den Amerikanern überzulaufen. Die Großväter waren tot, der eine war Kommunist gewesen und in Dachau, der andere hatte sich umgebracht, bevor er sich hätte schuldig machen können. Und der Vater war ein Strizzi, aber ganz bestimmt kein Nazi gewesen.
Und so darf man diese, mehr oder weniger, vaterlose Kindheit als ein Glück begreifen, eine unverdiente Gnade. Helmut Dietl blieb viel von dem erspart, was deutschen Männern seines Alters das Leben so furchtbar schwer machte: das Verdrängte und Verschwiegene, die Schuld der Väter, deren Last, gerade weil darüber nicht gesprochen werden durfte, an die Söhne weitergereicht wurde. Die Kindheit in Familien, wo die Väter ihre totale Niederlage als Soldaten, den Bankrott all dessen, wofür sie gekämpft hatten, zu vergessen versuchten, indem sie sich wie die totalen Herrscher aufspielten. Oder schweigsam und verbittert den alten Zeiten nachtrauerten. Der Hass, der Zorn, die Unversöhnlichkeit der Generation von 1968 lässt sich sicher nicht nur aus solchen Kindheitserfahrungen erklären; aber aus ihnen eben auch, wie Götz Alys Studie »Unser Kampf 1968« gezeigt hat. Nichts, absolut gar nichts wollten diese Kinder übrig lassen von der Welt ihrer schweigsamen, unsicheren, lieblosen Eltern. So blieben sie ihnen fester verbunden, als es ihnen lieb sein konnte.
Die Frauen, unter denen Helmut Dietl aufwuchs, hatten den Krieg nicht gewollt, sie hatten ihn nicht geführt, und sie hatten nichts getan, was danach verschwiegen werden musste. Sie hatten niemanden erschossen, niemanden an die Polizei ausgeliefert – im Gegenteil, die Mutter hatte jenen Italiener, der womöglich der Vater war, vor der Polizei versteckt. Sie waren am Schluss nicht geschlagen worden, besiegt, womöglich gedemütigt und gequält in der Kriegsgefangenschaft. Sie hatten den Krieg nicht verloren, und es waren die Frauen, die tatsächlich allen Grund hatten, das Kriegsende als Befreiung zu empfinden. Sie hatten eine andere, eine bessere, eine weniger gebrochene Geschichte als die Männer, und sie durften sie anders erzählen. Und so erzählte die Greiner-Oma außer von der Film- und der Lebenskunst vor allem von der Kunst des Kochens – einer Kunst, die sie sehr gut beherrschte. Und ihr Enkel schaute und schwärmte schon als Junge am allerliebsten die Mädchen und die Frauen an. Aber gleich danach, an zweiter Stelle unter den sinnlichen Freuden, kamen die bayerisch-österreichischen Herrlichkeiten, welche die Oma kochte und backte, der feine Tafelspitz, das Kalbsgulasch, das Paprikahuhn, der Apfelstrudel und die anscheinend sagenhaften Marillenknödel, von denen der junge Helmut sechs bis sieben gut verkraften konnte. Wer so aufwächst, wird ja nicht nur zur Kennerschaft erzogen und lernt, dass solche Genüsse die Kennzeichen einer zivilisierten Existenz sind und eigentlich ein Menschenrecht. Er verbindet mit Herkunft und Tradition etwas anderes als das Schweigen, das Verdrängen, die uneingestandene Schuld der Väter. Der Marillenknödel und der Tafelspitz bezeichnen insofern eine Herkunft, zu der man sich viel leichteren Herzens bekennen kann, eine Tradition der Selbstgewissheit und der Sinnlichkeit, die nichts gemein hat mit den Posen, dem faulen Zauber und den halb wahren Geschichten, die auch in Bayern die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit immer ersetzen sollten. Später, als Helmut Dietl erwachsen und berühmt war, ist vielen seiner Bewunderer aufgefallen, dass er, einerseits, die perfekte Verkörperung eines Münchners war, mit seiner Eleganz, seiner Weltläufigkeit, seinem unaufgeregten Beharren darauf, in Ruhe gelassen zu werden. Und andererseits war er das genaue Gegenteil eines typischen Münchners, ein Mann, dem der Dunst von Bier, Bratensoße und Ressentiment immer zuwider war; der mit dem Preußenhass so wenig anfangen konnte wie mit der sogenannten Griabigkeit, jenem bornierten und durch nichts gerechtfertigten Selbstgefallen, den schon Lion Feuchtwanger in seinem Roman »Erfolg« dafür mitverantwortlich gemacht hatte, dass es eben München war, wo die Nationalsozialisten, solange sie nur...
| Erscheint lt. Verlag | 3.11.2022 |
|---|---|
| Verlagsort | Köln |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Schlagworte | Filmgeschichte • Helmut Dietl • Kino • Kir Royal • Kulturgeschichte • Lebenswerk • Monaco Franze • München • Münchner Geschichten • Regisseur • Rossini • Schickeria • Zettl |
| ISBN-10 | 3-462-31653-2 / 3462316532 |
| ISBN-13 | 978-3-462-31653-7 / 9783462316537 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich