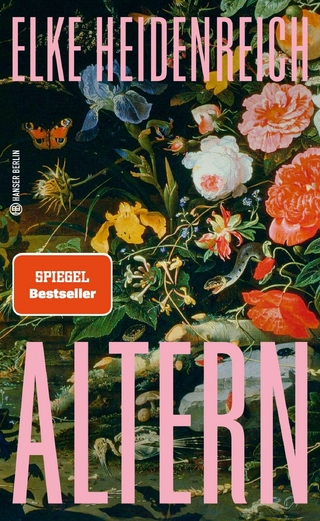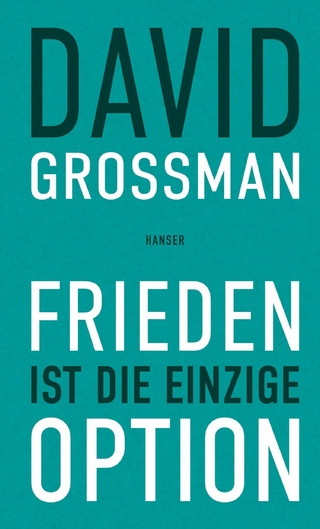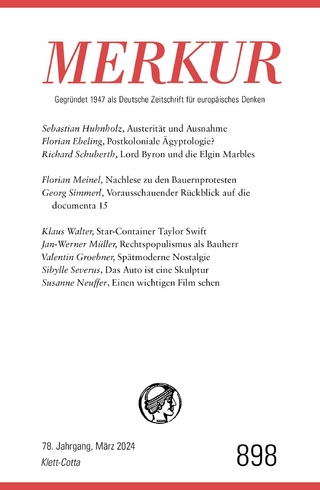Unser Auschwitz (eBook)
400 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-55341-5 (ISBN)
Martin Walser, 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, war einer der bedeutendsten Schriftsteller der deutschen Nachkriegsliteratur. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis, 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2015 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis. Außerdem wurde er mit dem Orden «Pour le Mérite» ausgezeichnet und zum «Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres» ernannt. Martin Walser starb am 26. Juli 2023 in Überlingen.
Martin Walser, 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, war einer der bedeutendsten Schriftsteller der deutschen Nachkriegsliteratur. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis, 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2015 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis. Außerdem wurde er mit dem Orden «Pour le Mérite» ausgezeichnet und zum «Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres» ernannt. Martin Walser starb am 26. Juli 2023 in Überlingen.
Halbzeit
(Auszug)
Es muß schön sein, wenn man sich’s leisten kann, sich vor einem Beruf zu drücken, sagte Susanne.
Das kann sich jeder leisten, sagte ich großspurig.
Meinen Sie, sagte Susanne und sah mich feindselig an. Sie habe einen Onkel in Breslau gehabt, sagte sie, Onkel Herbert, bei dem konnte man Vogelfutter und Hundekuchen und Wellensittiche kaufen. Der hat 1936 einen großen Käfig ins Schaufenster gestellt. In dem Käfig lebten eine Katze und eine Blaumeise. Onkel Herbert hatte die beiden so aneinander gewöhnt, daß sie aus einem Tiegel fraßen. Aber sein Ladengehilfe, der HJ-Führer war, wechselte eines Morgens die Katze aus, als mein Onkel gerade nicht im Laden war, und als der Onkel zurückkam, war die Blaumeise tot. Außen am Schaufenster klebte ein großer Zettel, auf dem stand: So geht es, Herr Schwedenser, wenn die Rasse sich rührt.
Schon wollte ich einwenden, daß die Idee des Onkels, falls er mit seinem Käfig etwas Symbolisches im Auge hatte, eine sehr unglückliche Idee gewesen sei, aber Susanne, die jetzt Gott sei Dank viel leiser geworden war, sprach sofort weiter. Um diese Zeit sei sie in Kolumbien gewesen. Onkel Herbert habe einen Brief um den anderen geschrieben, aber ihre Eltern hätten immer zurückgeschrieben, wovon denn er, der zoologische Händler, in Bogotá leben wolle? Onkel Herbert fuhr dann nach Budapest, wurde Lotterieeinnehmer. Ein paar Jahre später brachte man ihn nach Auschwitz, wo er, Sie wissen ja.
Mhm.
Sie hob ihre Stimme an und leierte rasch herunter, was sonst noch passiert war. Sie sprach, als stünde sie unter einem ihr widerlichen Zwang, als erzähle sie gegen ihren Willen die Geschichte eines langweiligen Sonntagsausflugs. Und weil sie so hastig sprach, so, als sei es sinnlos, bei irgendeinem Punkt länger zu verweilen, wirkte alles wie ein Trickfilm, der zu schnell läuft, ein Trickfilm, in dem Bewegungen von Heeren dargestellt werden mit Männchen, Pfeilen und gestrichelten Linien, der Globus drehte sich, Breslau ein roter Punkt, Jahreszahlen schossen auf, begannen zu glimmen, zu brennen. Herr Schmolka griff seine Frau an der Hand, sie hielt es noch für eine alltägliche Zärtlichkeit, er aber zog sie über den Globus hinüber, hinab nach Kolumbien. Wievielmal fliegt einem da Ruß ins Auge, daß es tränt? Die Münder der Direktoren in Bogota straffen sich unter den Bärtchen, öffnen sich dann aber wieder, als Herr Schmolka aus der gerade in Hamburg gekauften Offenbacher Mappe die Papiere hervorholt. Dies ist zwar eine Zementfabrik, mein Herr. Aber immerhin ein deutscher Chemiker. Bereut er alles? Oder warum sonst sagt er seiner Frau ins Gesicht, daß sie ohne ihn in Dachau säße? Was jetzt geschieht, hätte auch in Breslau geschehen können. Dann hätte aber Frau Schmolka keine so weite Reise gehabt, bis sie mit der zweijährigen Susanne wieder bei ihrer Mutter war. Die führt sie gleich wieder auf den Breslauer Bahnhof und fährt selbst mit. Vorsichtig über die Perrons des Schlesischen äugend, zieht sie Tochter und Enkelin hinter sich in die U-Bahn. Zum Anhalter. Und nach Genua. Das kleine Schiff hastet wieder über das Meer. Herr Schmolka ist überrascht. Er stellt seine Frau vor, Lissi, geborene Spiegel, aus Köln. Die Schwiegermutter bietet ihm allen Schmuck an. Aber was soll er mit zwei Frauen? Das geht doch nicht. Also kann er auch den Schmuck nicht nehmen. Zurück nach Breslau. Die Großmutter in Gedanken an der Reling. Die Mutter mit Augen ohne Regung im Liegestuhl, wahrscheinlich hält sie ein Buch vors Gesicht. Auch ein solches Schiff kommt an. Die Großmutter legt vielleicht sogar Wert darauf. Sie rennt zum Postamt, telegraphiert nach Budapest und schickt Tochter und Enkelin hinter dem Telegramm her, als sollten sie’s einholen. Der Onkel Lotterieeinnehmer, der sich zu helfen gewußt hat, empfängt sie und küßt, darf man annehmen, von Susannes kleinem Gesicht die vielen tausend Kilometer.
Oma selbst kann nur in Breslau leben. Mir passiert nichts, schreibt sie in jedem Brief. Schließlich ist er Offizier gewesen, sollen sie nur die Tür aufreißen, sein Eisernes erster Klasse liegt unter Zellophan auf staubfreiem Kissen, und beim Freikorps noch ein Bein verloren. Sorgt euch nicht um mich, schreibt sie bis sie, nach Bautzen transportiert, das nicht mehr und auch sonst nichts mehr schreiben kann, weil sie, Sie wissen ja.
Ihren Fohlenmantel hat sie denen mit nach Budapest gegeben und den ganzen Schmuck.
Folgt ein kurzes Kapitel, überschrieben: gut, daß die beiden katholisch sind. Susanne seh’ ich im Bergkloster unter Magyarenmädchen sitzen, als wäre sie selbst eins. Die Nonnen lehren zwar die Kleinen, alle Juden seien Menschenfresser, aber Susanne weiß ja nicht, daß sie eine Jüdin ist. Mitten in den Gesang rennt Mutti hinein. Susanne geniert sich. Endlich fährt der Omnibus. Der Onkel bleibt zurück und weint, als wisse er schon, daß ihn einer verraten und nach Auschwitz bringen wird. Der Zuschauer folgert: solang einer Abschied nimmt, weiß er mehr, als er selbst ahnt. Insbesondere der, der zurückbleibt. Warum bleibt er dann zurück? Weil er nicht ahnt, was er weiß. Einer Ahnung gehorcht er blind, gegen das, was er weiß, gibt es Argumente.
Vom vereisten Laufsteg, zwischen Rumänien und dem türkischen Schiff, fällt Mutti ins Wasser, wird aber gerettet. In Istanbul ist es eine Zeit lang, wie es in Istanbul sein soll. Bis hierher kommen die Landsleute wohl nicht. Ein richtig reicher Mann, der einfach Geld genug hat und Häuser und Diener, ein Landsmann sogar, Susanne darf ihn Onkel nennen, der sorgt für sie. Im Hotel braucht Susanne, wenn die Mutter in der Stadt ist, nur an der grünen Quaste mit den goldenen Troddeln zu ziehen, dann kommt Achmed und fragt, was sie will, sogar ans Bett setzt er sich und erzählt Märchen in einer lustigen Sprache, die sie zur Hälfte versteht. Es geht in Achmeds Märchen ganz anders zu als in ihrem Märchenbuch. Wenn sie starr vor Angst ist, streichelt er sie. Plötzlich prasselt Regen herab und verjagt das Geschrei von der Straße. Susanne erschrickt, und erschrickt gleich noch einmal, denn Achmed legt sich zu ihr. Sie schreit, obwohl sie nicht recht weiß, warum. Wie vom Schutzengel selbst geschickt, es gibt ihn also doch, kommt Mutti. Achmed grinst, erklärt, zieht sein Gesicht in die Breite und in die Länge und Mutti lacht und gibt ihm ein Trinkgeld, da lacht er noch mehr, und immer noch lachend, geht er rückwärts und sich verbeugend hinaus. In der nächsten Szene gehen beide, die ich, wie es zur Zeit ähnlicher, wenn auch milderer Schicksale üblich war, unsere Reisenden nennen dürfte, gehen also jetzt beide durch eine Istanbuler Straße. Die Szene könnte prächtig sein, verziert mit Gewändern, gebogenem Kupfer, Perlvorhängen, Bilderbuchgesichtern, aber auf dem Marktplatz von Saloniki werden schon Transporte zusammengetrieben, und plötzlich greifen noch vier Hände durch den hellichten Tag, die beiden werden wie Fische, die man ins Bassin bringen will, in den steinernen Hof geschleppt, an den Wänden stehen zwanzig schöne Gestalten und lachen. Mutti zahlt in bar, was denen ihr Vergnügen wert wäre, da läßt man sie laufen.
Ein Schiff wird gerüstet, nach Haifa zu fahren. Susanne liegt mit Fieber im Hotel. Der Arzt hat in München studiert und rät ab. Das Schiff fährt ohne die beiden und geht unter, denn was die Landsleute nicht mit dem Brandstempel versehen und dann sorgfältig vergasen können, das wollen sie wenigstens en gros ersäufen.
Aber in den zweiundzwanzig Omnibussen, die über den Libanon holpern, bis Tel Aviv, da sind sie drin. Landschaft gilt nichts momentan, nichts die Zedern, aus denen Vorfahr Salomo die Sänfte bauen ließ, nichts der Geruch des Libanon, nichts Narde, Safran, Kalmus, Zimt, Myrrhe und Aloe, nur Entfernung gilt und die Frage, ob man am Ende noch Rommel entgegenfährt.
Jetzt beginnt das Kapitel: daß Susanne und ihre Mutter katholisch sind, ist kein Vorteil mehr. Mutti sucht Anschluß bei den Engländern. Bei Leschnitzers wohnen sie. Frau Leschnitzer hat man sich klein vorzustellen. Ihre Sorge ist, Teddy könnte klein bleiben. Wenn man doch bloß einen hat. Susanne wird endlich ausgebildet: Gepäckmärsche, Gänge durch arabische Dörfer, das komische Gefühl im Rücken, plötzlich schaut man um, aber kein Gewehrlauf blinkt, die Gadna legt Wert auf derlei Mutproben. Dazu Hebräisch, Althebräisch, Talmudübungen, Baruch ta adonai, und warum dann Jehováh gesagt werden muß. Eine neue Muttersprache, die die Mutter zwar nicht spricht, soll Susanne bekommen. Wenn jemand am schönen Strand von Tel Aviv – ist das da draußen ein Schnorchel? da, der Strich? – etwas fragt, muß sie antworten: hier spricht man hebräisch. Immer häufiger fällt ihr auf, daß viele Kinder einen Vater haben. Der ist tot, sagt Mutti, gestorben in Bogotá. Plötzlich rennt Frau Leschnitzer herein und ruft: die Araber, Krieg. Die Mutter näht Kunstblumen aus Velours. Über den Häusern summt es. Susanne zieht die Mutter vom Fenster weg. Die Bombe krepiert, ein Splitter schlägt durchs Fenster. Susanne wird eine Autorität. Mutti schenkt ihr den Fohlenmantel. Aber sie sind immer noch katholisch, und Mutti kann die neue Muttersprache nicht. Überhaupt gehören sie nach Breslau. Leschnitzers sind schon fort. Also fahren sie hinter Leschnitzers her nach Berlin. Breslau haben die Landsleute verscherzt. Ein für allemal. Tante Maria ist angeblich nach Moskau geflohen und in Rußland verschwunden, Onkel Herbert und Oma, Sie wissen ja, und wo sind die Brüder des Vaters? Es könnte sein, in Amerika. Muttis Cousine ist in Rio, das weiß man. Und Sophie war immer besorgt. Was soll man auch in...
| Erscheint lt. Verlag | 23.2.2015 |
|---|---|
| Nachwort | Andreas Meier |
| Zusatzinfo | 1 S. s/w Faksimile |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Schlagworte | Auschwitz-Prozess • Essays • Paulskirche • Vergangenheitsbewältigung |
| ISBN-10 | 3-644-55341-6 / 3644553416 |
| ISBN-13 | 978-3-644-55341-5 / 9783644553415 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 821 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich