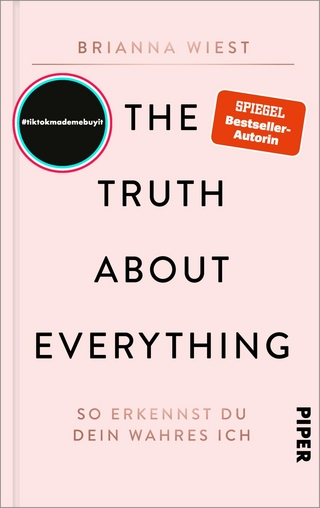Stilmeierei oder Neue Baukunst
Transit (Verlag)
978-3-88747-246-7 (ISBN)
'Man kann jedes Verhältnis zu Berlin gewinnen, nur lieben kann man diese Stadt nicht', schrieb Karl Scheffler 1910. Einfühlsam und polemisch zugleich hat er ein Literatenleben lang der Physiognomie jener Stadt nachgespürt, die er zu seiner 'Arbeitsheimat' erkoren hatte. Die rauschhafte Entwicklung der Provinzmetropole zur Millionenstadt, die Kaiser Wilhelm II. mit gewaltigem Aufwand zur 'schönsten Stadt der Welt' machen wollte, kommentierte Scheffler immer wieder mit einer ordentlichen und kenntnisreichen Portion Sarkasmus. Dabei war er alles andere als ein Gegner der Großstadt. Energisch forderte Scheffler eine dem technischen Zeitalter angemessene Architektur und Stadtplanung, wie er sie bei modernen Architekten wie Alfred Messel, Peter Behrens oder August Endell verwirklicht sah. Als einer der ersten entdeckte er auch den ästhetischen Reiz von Industrie- und Verkehrsbauten.
Dieses Buch versammelt weitgehend unbekannte Texte zur Berliner Architektur aus vier Jahrzehnten, in denen erfrischend und unterhaltsam die wilhelminische 'Hofkunst', die 'Ankunft der Moderne' und das 'Neue Berlin' der Weimarer Zeit besichtigt werden. Manches wird dem Leser nicht nur vom Stadtbild her, sondern auch als Gegenstand damaliger wie aktueller Auseinandersetzungen bekannt vorkommen: die Museumsinsel, der Dom, der Lesesaal der Staatsbibliothek, Schinkels Wache, Leipziger und Potsdamer Platz – und nicht zuletzt das Schloss…
Karl Scheffler wurde 1869 in Hamburg geboren. Nach einer Lehre als Dekorationsmaler ging Scheffler um 1890 nach Berlin und arbeitete als Musterzeichner in einer Tapetenfabrik. Wenig später begann er, sich autodidaktisch als Kunstpublizist zu profilieren – der Anfang einer außergewöhnlichen Karriere. Seit 1906 leitete Scheffler die damals führende Kunstzeitschrift 'Kunst und Künstler' (im Verlag von Bruno Cassirer), das Sprachrohr der Berliner Moderne. Daneben schrieb er für die 'Neue Rundschau', war Redakteur der 'Vossischen Zeitung' und auch als Buchautor äußerst erfolgreich. Mit dem 1910 erschienenen Titel 'Berlin – ein Stadtschicksal' legte Scheffler einen Klassiker der Berlin-Literatur vor, der in seiner polemischen Zuspitzung bis heute fasziniert. Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung wurde die Zeitschrift 'Kunst und Künstler' eingestellt. Scheffler verließ Berlin und zog sich nach Überlingen am Bodensee zurück, wo er 1951 starb.
I „Hofkunst“ 2
Der Dom (1905) 2
Die Siegesallee (1901) 4
Hofarchitektur (1905) 6
Wilhelm II. als Bauherr (1910) 9
Der Neubau der Königlichen Bibliothek (1914) 11
II Ankunft der Moderne 13
Hochbahn und Ästhetik (1902) 13
Das Kaufhaus Wertheim (1897) 14
Ein moderner Laden (1901) 15
Das Wolzogen-Theater (1902) 17
Die Hackeschen Höfe (1907) 18
Die neue Nationalbank (1907) 19
Alfred Messel (1910) 21
Kunst und Industrie (1908) 22
Das Turbinenwerk der A.E.G. (1910) 25
Eine Rennbahnarchitektur (1913) 26
Zoologische Architektur (1913) 27
Gute und schlechte Arbeiten im Schnellbahngewerbe (1914) 27
Untergrundbahnhof Wittenbergplatz (1913) 29
III Das „Neue Berlin“ 31
Die Zukunft Berlins (1919) 31
Wie sieht der Potsdamer Platz in 25 Jahren aus? (1920) 32
Das Große Schauspielhaus (1920) 32
Wettbewerb „Unter den Linden“ (1925) 35
Das neue Berlin I (1927) 36
Der Film „Berlin“ (1927) 38
Universum (1928) 39
Dächerkrieg (1928) 39
Das neue Berlin II (1931) 40
Das Pergamonmuseum (1930) 41
Das Ehrenmal (1931) 43
IV Berlin im Rückspiegel 45
Konstitutionsfehler im Berliner Stadtplan (1936) 45
Das Schloss (1931) 47
Andreas Schlüter (1935) 48
Preußischer Klassizismus (1936) 50
Gründerzeit (1931) 51
Berliner Christbäume (1937) 54
Berlin als Heimat (1936) 55
I „Hofkunst“ Der Dom (1905) (Erschienen in „Kunst und Künstler“, Jg. 3, 1904/05, S. 228-230) Die Tat ist vollbracht, die so viele Geschlechter schon beschäftigt hat. Wenn der Plan, in Berlin eine neue Domkirche zu bauen, von dem schon unter Friedrich Wilhelm III. viel die Rede war, bis zu den neunundneunzig Tagen Kaiser Friedrichs immer wieder vertagt wurde, so war im wesentlichen das Gefühl für die Wichtigkeit und Verantwortlichkeit der Aufgabe schuld daran. Die Beteiligten, zu denen auch Schinkel gehörte, der sich in vielen Entwürfen mit dem Problem beschäftigt hat, empfanden, dass das Beste gegeben werden müsse, was die moderne Baukunst zu leisten vermag. Dem stellte sich aber stets ein prinzipieller Widerspruch entgegen, eine Unwahrhaftigkeit, die in der Idee liegt und aller reinen Anstrengungen spottet. Dagegen konnte selbst Schinkel mit der Fülle seines nachgeborenen Genies nicht aufkommen, was man deutlich erkennt, wenn man sieht, wie weit seine Entwürfe für Kirchen hinter seinen andern Werken zurückbleiben und wie unsicher er sich gerade in den Domplänen gefühlt hat. ihm bot sich nirgends die führende Notwendigkeit, das fordernde Bedürfnis. Er fühlte, und mit ihm seine Zeit, zu romantisch-hellenisch, zu goethisch-heidnisch, um eine schlichte protestantische Predigthalle vorschlagen zu können; und andererseits blieb ihm die Idee einer kalten Repräsentationskirche fremdartig. Eine rein darstellende Architektur, die nur dem Auge imponieren soll und deren Inneres sein kann, wie es will, weil der Gottesdienst so wesenlos geworden ist, dass er sich jeder Raumdisposition anpassen lässt: das ist eine Aufgabe für Dekorateure, die auf dem sicheren Boden eines geltenden Stils stehen, aber nicht für einen schöpferischen und - nur wenige wissen es! - modernen Geist, wie Schinkel es trotz alledem war. Es ist denn auch unserer skrupellosen Zeit vorbehalten geblieben, die sittlichen Künstlerbedenken dieser Art gründlich zu überwinden. Das feinere Verantwortlichkeitsgefühl musste erst im Illusionismus des jungen Reichsbewusstseins untergehen, bevor der alte Plan hastig zur Tat werden konnte. Den gelehrten Baubeamten Raschdorff schreckten die Widersprüche nicht. Für ihn lag die Aufgabe ja auch viel einfacher. Das geeinte Reich bedurfte des Glanzes nach außen, und jeder anderen Rücksicht stand dieses Repräsentationsbedürfnis voran, das vor allem von Kaiser Friedrich vertreten wurde, den die deutsche Liberalität immer noch den feinen Kunstkennern zuzuzählen pflegt und von dem wir doch auch eine Siegesallee hätten erwarten dürfen, wenn er länger regiert hätte. Die zarten Kulturkeime, deren edelste in Weimar gepflanzt worden waren, sind in der Zeit nach den Kriegen zugrunde gegangen. Der Protestantismus hat über das religiösere philosophische Bewusstsein wieder gesiegt; aber er wird jetzt nur kalt oder puritanisch als nützlicher Staatsgedanke erfasst und je materieller, rationalistischer und ungeistiger die sich bereichernde Bevölkerung des neuen Reichs wurde, desto mehr auch wurde das Dogma nach außen als Flagge benutzt. Nur so. ist der neue Dombau, wie er nun vollendet vor der dumpf staunenden Menge sich erhebt, verständlich: als eine riesenhafte Staatsreklame für einen Gedanken der Staatsdisziplin und dynastischen Machtentfaltung. Der Gottesdienst muss sich diesen äußeren Zwecken vollkommen unterordnen. Nicht einen Predigtraum brauchte man in erster Linie, nach dem einst von einer Gemeinde aufgestellten Grundsatze: „Die Kirche soll im allgemeinen das Gepräge eines Versammlungshauses der feiernden Gemeinde, nicht dasjenige eines Gotteshauses im katholischen Sinne an sich tragen,“ sondern die Forderung ging auf einen gewaltigen Kuppelraum, mit Säulen und Statuen in Metall und Marmor, mit Bildern und Mosaiken, mit Logen für den Hof und für das seidene Hofgesinde, mit Musikemporen und Chortribünen, man wollte einen katholisch prunkenden Dom: eine Jesuitenkirche, Nicht bewusst wollte man es; aber der Instinkt hat gesprochen und so ist uns diese Reichsrenommierkirche, worin der Glanz und die Pracht und die Herrlichkeit des Kaisertums sich dem Volke überwältigend entfalten, beschert worden. Ein Einzelner ist hierfür nicht wohl verantwortlich zu machen. Die Dinge liegen in unserer Zeit in der Tat so, dass man sich an der Stelle, zwischen Schloss und Museum, eine einfache Predigthalle, eine öde Langkirche nicht denken mag. Man muss, die Hofkirche gelten lassen und schließlich sogar die dem protestantischen Gottesdienst absolut widersprechende Form der Zentralanlage (die Form aus Byzanz!); unverantwortlich ist nur die Art der Ausführung. Auch Schinkel hatte unter anderem eine Zentralkirche geplant; hätte er sie doch gebaut! Die Türen hätten ewig verschlossen bleiben können, wenn der Platz uns nur gerettet worden wäre; und das hätte dieser Künstler mit seinem sicheren Raumgefühl, seinem reifen Formensinn gewiss vollbracht, Er hätte das rechte Verhältnis gefunden und nicht so einen Popanz errichtet, der die ganze charaktervolle Umgebung überschreit. Es gab doch die schlanken Gendarmenkirchen als Vorbild, oder die wichtigere Dresdener Frauenkirche; und sollte es durchaus italienisch sein, so waren doch auch dann die vollkommensten Muster zur Hand. O Gott! ein wenig Musik tragen doch die Heutigen in der Seele! Sie messen jede Schönheit und versehen es doch, weil sie den organischen Verband der Teile mit dem Ganzen nicht fühlen; sie tragen mit emsigem Fleiß auf einen Fleck zusammen, was einst viele persönliche Künstler, jeder für sich, gebildet haben, glauben so eine Quintessenz zu geben und richten doch nur ein Ragout an; unter ihrer Hand wird das genial Geschaffene zum Schema, das motivierende Bauglied zur Dekoration, die Musik des Ornamentalen zum Spektakel; auf dem Wege durch ihren in Schulwissen verdorrten Geist wird das grandios Schöne wie das spielerisch Graziöse zu Phrasen umgemünzt, die dann unter den Handwerkern von Hand zu Hand gehen. Raschdorff ist nicht schlimmer als seine Kollegen, ja, ist vielleicht gebildeter als die meisten. Aber er ist nicht die Spur Künstler. Sein Werk, das ihn ein Jahrzehnt und länger beschäftigt hat, ist ein vollkommener Prototyp der ideenlosen, kompilatorischen, rein wissenschaftlichen, großmannssüchtigen Bauweise, die die drei Jahrzehnte nach dem Krieg charakterisiert. Dieser Dom verhält sich zur Peterskirche wie ein westliches Berliner Mietshaus zu einem Florentiner Palazzo, wie eine Skulptur von Eberlein zu einer von Michelangelo oder wie Prells Malereien im Dresdener Albertinum zu denen der Sixtinischen Kapelle. Die deutschen Künstler sind alle in Italien gewesen, um die alten Meister zu „studieren“; aber sie haben nie mit ganzer Kraft ihr eigenes Leben gelebt, weder im Süden noch im Norden. Genau dort, wo Künstler dieser Art mit der Pflege ihrer berüchtigten „Traditionen“ aufhören, beginnt die wahre, anregende und schöpferische Pietät. Die rein kubische Mächtigkeit der Massen des neuen Dorns hätte wirken müssen, wenn nur ein wenig wirkliche, lebensvolle Harmonie zustande gekommen wäre; nun aber ist das niedrige, im Vergleich kleine Museum Schinkels großräumig und monumental gegenüber der bunten Unruhe des Kolosses. Nicht dass es Renaissanceformen sind ist tadelnswert, sondern dass es schlechte Formen sind. Es gibt geschickte Kompilatoren, deren Geschmack aus dem Alten ein Neues zu machen weiß; Raschdorff aber ist noch nicht einmal zu jener mittleren Erkenntnis vorgeschritten, die dem Architekten zeigt, dass die Fläche das vornehmste Dekorationsmittel ist. Das lehren, um die erreichbaren Beispiele gleicher Art zu nennen, die Gendarmenkirchen und Schinkels Nikolaikirche in Potsdam (auch ein Kuppelbau, aber mit rechteckigem, hallenartigen Grundriss), und noch besser die unmittelbaren italienischen Vorbilder. Die Säulenreihen mögen genau gemessen sein: sie stehen doch in schlechter Proportion zu den Massen, die sie tragen; die Kuppel mag nach den besten Erfahrungen konstruiert sein: sie sitzt doch falsch auf ihrem Unterbau; die Glockentürme sind gewiss, kunsthistorisch betrachtet, nicht Willkürlichkeiten: aber sie sehen leider so aus; der überreiche Schmuck mag sich Stück für Stück in Italien nachweisen lassen: er ist und bleibt doch eine Anthologie für Baugewerksschüler. Diese Art zu bauen ist als nähme ein Anatom von zwanzig Pferden verschiedene Körperteile, um ein Idealpferd zusammenzustellen. Das so konstruierte Muster würde nicht nur tot sein - was ja immerhin nicht ganz unwesentlich ist -, sondern auch abscheulich charakterlos. Kunstwerke können nur wachsen wie Naturorganismen; diese nach den Gesetzen der Natur, die das Ideal stets anstrebt, ohne es je ganz zu erreichen, jene nach den Gesetzen der individualisierten Seele, die auch das ganze Ideal immer will und es doch nur stückweis verwirklichen kann. „Geprägte Form, die lebend sich entwickelt“ ist beides. Sind es nun der Irrtümer genug im neuen Berlin? Es ist Zeit, eine Pause eintreten zu lassen, denn jedes Jahrhundert hat nur eine bestimmte Zahl von Monumentalaufträgen zu vergeben und wenn sie erschöpft sind, müssen die Söhne und Enkel mit der Hinterlassenschaft der Väter haushalten. Ein Gebäude wie den Dom kann die bessere Einsicht der Zukunft nicht niederreißen; denn es ist für Jahrhunderte gebaut. „Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein.“; dieses Kämmerlein kostet ungefähr zwölf Millionen Mark.
| Erscheint lt. Verlag | 2.3.2010 |
|---|---|
| Vorwort | Andreas Zeising |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 140 x 240 mm |
| Gewicht | 370 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Technik ► Architektur | |
| Schlagworte | 20. Jahrhundert • Architektur • Architekturgeschichte • Architekturkritik • Berlin • Berlin, Kunst; Architektur • historisch • Stadtplanung |
| ISBN-10 | 3-88747-246-2 / 3887472462 |
| ISBN-13 | 978-3-88747-246-7 / 9783887472467 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich