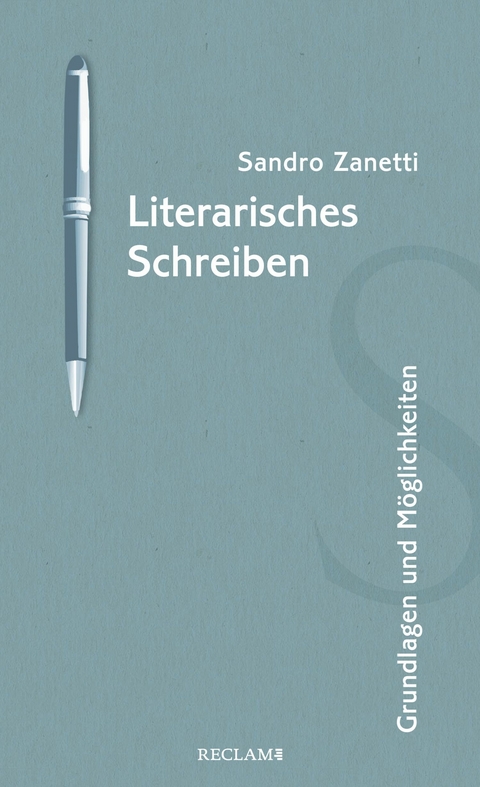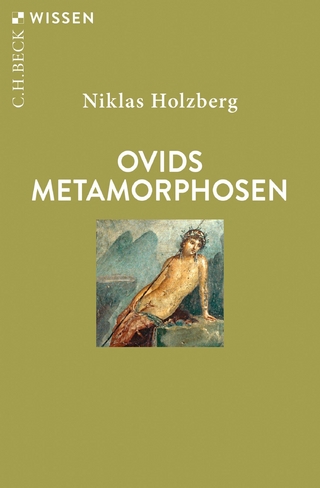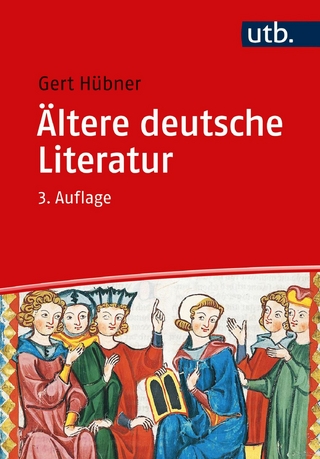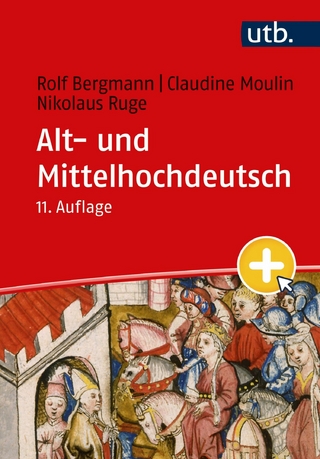Literarisches Schreiben (eBook)
285 Seiten
Reclam Verlag
978-3-15-962000-8 (ISBN)
Sandro Zanetti , geb. 1974, ist Professor für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Er studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie in Basel, Freiburg im Breisgau und Tübingen. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Produktionsästhetik. Nach Forschungstätigkeiten in Frankfurt am Main, Basel und Berlin lehrte er u. a. einige Jahre an der Universität Hildesheim im Studiengang Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus.
Sandro Zanetti , geb. 1974, ist Professor für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Er studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie in Basel, Freiburg im Breisgau und Tübingen. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Produktionsästhetik. Nach Forschungstätigkeiten in Frankfurt am Main, Basel und Berlin lehrte er u. a. einige Jahre an der Universität Hildesheim im Studiengang Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus.
Einleitung
1 Grundlagen: Aspekte, Modelle, Fragen
1.1 Sprache, Schreibwerkzeuge, Körper
1.2 Rhetorik und Poetik
1.3 Genialität oder Handwerk?
1.4 Vom Abschreiben zum Selberschreiben
1.5 Das Verhältnis zur Tradition
1.6 Prozess-, Ergebnis- und Persönlichkeitsorientierung
1.7 Schreibprozessforschung
1.8 Literarisches Schreiben: poetische Verfahren
1.9 Welche Form? Welcher Inhalt?
2 Momente: von den ersten Ideen bis zur Veröffentlichung
2.1 Wahrnehmungen, Lektüren, Erinnerungen, Ideen
2.2 Einfälle, erste Notizen, Stoffe, Skizzen, Pläne
2.3 Öffnungen nach außen: Rekurrieren, Aneignen
2.4 Im Zickzack: zwischen Schreibstrom und Unterbrechung
2.5 Die Arbeit am eigenen Stil
2.6 Variieren, Ergänzen, Streichen, Verdichten
2.7 Überarbeitung und Redaktion – Mentorat und Lektorat?
2.8 Vorlesen, Aufführen, Veröffentlichen
2.9 Wie weiter?
3 Möglichkeiten: Schreibprojekte von Achleitner bis Zola
3.1 Friedrich Achleitner: Spiel mit dem Quadrat
3.2 André Breton, Philippe Soupault, Jack Kerouac: Los!
3.3 Emily Dickinson: Prozessualität und Variantenbildung
3.4 Friedrich Dürrenmatt: Wiedererinnern, Umarbeiten
3.5 Ernst Jandl, Oskar Pastior: Übersetzen mit dem Ohr
3.6 Elfriede Jelinek: Arbeiten mit Zitaten
3.7 Stéphane Mallarmé, Samuel Beckett: Verknappung
3.8 Peter K. Wehrli: Literarische Momentaufnahmen
3.9 Émile Zola und die Folgen: Poesie des Alltags
Zum Schluss: Nichtschreiben (Wahrnehmen, Ausgehen, Nachdenken)
Literaturhinweise
Basisglossar
Abbildungs- und Textnachweis
Rückblick und Dank
[12]1 Grundlagen: Aspekte, Modelle, Fragen
1.1 Sprache, Schreibwerkzeuge, Körper
Wer schreibt, zeichnet auf, bringt Schriftzeichen auf eine Oberfläche und macht diese Zeichen durch den Schreibakt lesbar für sich und andere. Gelesen werden Schriftzeichen, wenn sie nicht bloß angeschaut, sondern in ihrem Zeichencharakter erkannt und entsprechend mit Bedeutung versehen werden. Zeichen sind dadurch definiert, dass sie für etwas anderes stehen: aliquid stat pro aliquo – wie es auf Latein heißt. Zeichen verweisen auf etwas anderes oder evozieren es zumindest: Ereignisse, Dinge, Zustände, Eindrücke, Bedeutungen, andere Zeichen. Gleichzeitig müssen Zeichen, um überhaupt wahrnehmbar zu sein, eine materielle Seite aufweisen. Das gilt auch für Schriftzeichen. Die 26 Buchstaben des Alphabets geben im Deutschen den Grundbestand für die durch Kombinatorik und Wiederholung ermöglichte Bildung von Wörtern und Sätzen ab. Dazu kommen Satzzeichen und weitere Hilfsmittel wie Wortabstände, Absätze und dergleichen.
In ihrem Zeichencharakter sind aus Buchstaben gebildete Wörter und Sätze stets in der Lage, mehr zu bedeuten als das, was sie in Form von Druckschwärze, Tinte, Kreide oder als Simulationen davon faktisch oder scheinbar verkörpern. In ihrer Materialität verweisen Zeichen und somit auch Schriftzeichen zwar durchaus auf sich selbst: als Markierungen in Raum und Zeit, auf einem Blatt Papier oder als Schriftzug auf einem Plakat. Doch Zeichen gehen in diesem Selbstverweis nicht auf, sondern überschreiten ihn, indem sie auf anderes verweisen, Bedeutungen generieren, Assoziationsmöglichkeiten eröffnen.
Dabei besteht zwischen dem Selbstverweis in dem eben definierten materialen Sinne und dem Fremdverweis im [13]Sinne einer Bedeutungen generierenden Überschreitung dieser Dimension in dem Maße eine Kluft, wie Zeichen nicht natürlich auf etwas Bestimmtes anderes verweisen, sondern in ihrem Verweischarakter kulturell vorgeprägt sind: Wer nicht weiß, dass eine rote Ampel Stopp bedeutet, erkennt die Ampel nicht in ihrer Zeichenfunktion – oder sie steht für ihn als Zeichen für etwas anderes (was mehr oder weniger gefährliche Folgen haben kann). Das gilt auch für Schriftzeichen. Kulturelle Vorprägungen dieser Art können sich nur etablieren, wenn Zeichen sich erstens von anderen Zeichen unterscheiden und somit identifizierbar werden und wenn zweitens Zeichen in Wiederholungen auftreten und somit in ihrer Verweisstruktur an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten erkennbar werden.
Die Bedeutung eines Zeichens ist allerdings nie ein für alle Mal festgelegt. Gerade weil zwischen dem Selbstverweis und dem Fremdverweis eines Zeichens keine natürliche Verbindung besteht (Saussure 1967, 79–82), sind Zeichenbedeutungen im Prinzip veränderlich, wenn auch nicht beliebig oder gar frei: so veränderlich und zugleich an kollektive Praktiken zurückgebunden wie die jeweiligen kulturellen Prägungen und individuellen Akzentsetzungen, aus denen sie selbst hervorgehen. Dagegen erweist sich die materielle Seite eines Zeichens als zeitgebunden und beharrlich auf eine andere Weise: Druckerschwärze und Tinte sind in der Regel ähnlich geduldig wie das Papier, auf dem die entsprechend gefärbten Wörter oder Schriftzüge stehen.
Mit dieser Geduld hat es im Zeitalter der Computer zwar ein Ende: Gespeicherte Dateien müssen immer wieder neu gespeichert werden (können), wenn sie sich unabhängig von einem papiernen Korrelat oder einer einzelnen lokalen Festplatte erhalten sollen. Nicht zu Ende ist es jedoch mit der prinzipiellen Kluft zwischen der technisch-materialen und der sinnhaft-assoziativen Dimension von Schriftzeichen. [14]Auch elektronisch generierte Schriftzeichen, die auf einem Bildschirm oder einem Ausdruck erscheinen und vorher eine Reihe von Übertragungs- und Übersetzungsprozessen durchlaufen haben, verstehen sich nicht von selbst: Auch diese Zeichen verweisen über sich und ihren Kontext hinaus auf Anderes, indem sie dieses evozieren und in eine Form von Darstellung dieses Anderen überführen.
Wer schreibt, bewegt sich im Spielraum, der sich zwischen der bloßen Buchstäblichkeit des Geschriebenen (der Materialität der Schriftzeichen) und ihrer durch Konventionen bedingten Bedeutungsdimension (ihrer Semantik) öffnet. Wie sehr jemand sich in diesem Spielraum nicht nur einfach bewegt, sondern ihn gestaltet, ist je nach Situation, Person und Kontext hochgradig unterschiedlich. Eine wichtige Rolle spielt die Frage, wie sehr (nicht) und auf welche Weise (nicht) der Schreibprozess mit dem Leseprozess in ein Rückkopplungsverhältnis versetzt wird – und welche Folgen das für das Geschriebene hat.
Eine aufmerksame Rückkopplung mag dabei helfen, eine Ahnung davon zu erhalten, wohin das Geschriebene einen selbst – vielleicht aber auch andere – leitet. Ob eine solche Orientierung auch für andere relevant ist, kann im Schreibakt selbst jedoch nicht vorherbestimmt, sondern höchstens vermutet und allenfalls provoziert werden. Eine Notwendigkeit, sich bereits im Schreiben von bestimmten Leseerwartungen abhängig zu machen, mag es für bestimmte, aber sicherlich nicht für alle Schreibprozesse geben.
Ist einem die vermutete oder bekannte Erwartung anderer aus freien Stücken wichtig, dürfte es nicht schaden, sich selbst nicht nur als Schreibsubjekt zu empfinden, sondern auch Erfahrungen darin zu gewinnen, die eigene Schreibweise lesend einzuschätzen. Relativiert werden Selbsteinschätzungen dieser Art ohnehin, früher oder später, durch Reaktionen der Umwelt. Implizit oder explizit sind Schreibprozesse stets in [15]größere kommunikative Strukturen eingebunden: Das gilt in der Regel noch über den Tod all derer hinaus, die schreiben, denn das Geschriebene bleibt, sofern aufbewahrt, auch dann noch lesbar, wenn die (ehemals) Schreibenden tot sind. Um kommunikativ zu sein, sind Schriftstücke nicht auf die Präsenz von Körpern und Subjekten angewiesen, die Anspruch auf ›Urheberschaft‹ erheben.
Schreibprozesse erschöpfen sich allerdings weder in ihrer möglichen kommunikativen Funktion noch überhaupt in ihrer zeichenhaften Qualität. Versucht man, die Faktoren zu benennen, die nötig sind, damit Schreibprozesse passieren können, wird man zunächst von einer gar nicht so leicht zu ordnenden Vielzahl an Faktoren auszugehen haben. Der Kommunikations- und Medienphilosoph Vilém Flusser (1920–1991) hat diese Vielzahl an Faktoren in seinem Buch Gesten. Versuch einer Phänomenologie wie folgt zu bestimmen versucht (Flusser 1991, 40):
Um schreiben zu können, benötigen wir – unter anderen – die folgenden Faktoren: eine Oberfläche (Blatt Papier), ein Werkzeug (Füllfeder), Zeichen (Buchstaben), eine Konvention (Bedeutung der Buchstaben), Regeln (Orthographie), ein System (Grammatik), ein durch das System der Sprache bezeichnetes System (semantische Kenntnis der Sprache), eine zu schreibende Botschaft (Ideen) und das Schreiben. Die Komplexität liegt nicht so sehr in der Vielzahl der unerlässlichen Faktoren als in deren Heterogenität. Die Füllfeder liegt auf einer anderen Wirklichkeitsebene als etwa die Grammatik, die Ideen oder das Motiv zum Schreiben.
Auffällig an dieser Aufzählung sind, noch vor den einzelnen Bestandteilen, ihre merkwürdigen Grenzen: zum einen der Hinweis am Anfang, dass die genannten Faktoren nur solche [16]»unter anderen« sind, zum anderen die Pointe am Ende der Aufzählung, dass man, um »schreiben zu können«, schließlich auch noch das »Schreiben« benötige.
Wird auf der einen Seite betont, dass das Schreiben noch viel mehr voraussetzt, als mit ein paar schematischen Hinweisen gesagt werden kann, wird auf der anderen Seite betont, dass selbst bei einer Aufzählung aller Faktoren der Akt erst noch vollzogen werden muss, wenn diese Faktoren überhaupt von Relevanz sein sollen. Die Möglichkeitsbedingungen – Oberfläche, Werkzeug, Zeichen, Konvention, Regeln usw. – gewinnen Wirklichkeit erst, und werden dadurch auch erst in ihrem Möglichkeitssinn erkennbar, wenn der Akt des Schreibens tatsächlich geschieht.
Nimmt man den Stift in die Hand oder klappt das Notebook auf und beginnt mit dem Schreiben, geraten zunächst ganz grundsätzliche Faktoren in den Blick: materielle und technische Bedingungen, schließlich weniger leicht zu fassende Komponenten wie Ideen, Konventionen, Botschaften. Je feinstofflicher diese Faktoren werden, desto schwieriger werden sie fassbar. In jedem Fall aber sind auch diese Faktoren, die solche »unter anderen« sind, für die spezifische Prozessqualität eines Schreibaktes von entscheidender Wichtigkeit. Zu diesen Faktoren gehören auch individuelle Vorlieben, Obsessionen, Schwächen. Zu Recht betont Flusser, dass all diese Faktoren in ihrer Heterogenität auf unterschiedlichen Wirklichkeitsebenen anzusiedeln sind – und von Literatur ist hier noch gar nicht die Rede.
Ein wichtiger Aspekt, der in der Liste von Flusser fehlt, bleibt noch zu ergänzen (Flusser kommt darauf selbst im weiteren Verlauf seines Textes zu sprechen): Es ist die Körperlichkeit des Schreibaktes, die gestische und sinnliche Komponente. Wer schreibt, trifft nicht nur technische Vorkehrungen und aktiviert das Sprachvermögen, er oder sie muss auch den eigenen Körper zum Einsatz bringen. Um zu schreiben, [17]muss man einen Stift in die Hand nehmen und...
| Erscheint lt. Verlag | 18.3.2022 |
|---|---|
| Zusatzinfo | 30 s/w-Abbildungen |
| Verlagsort | Ditzingen |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Germanistik |
| Schlagworte | Anleitung Textredaktion • Anleitung Textüberarbeitung • Basiswissen Literarisches Verfahren • Basiswissen Poetik • Basiswissen Rhetorik • Einführung Literarische Verfahren • Einführung Poetik • Einführung Rhetorik • Grundlagen der Schreibprozessforschung • Grundlagen Literarische Verfahren • Grundlagen Schreibprozess • Grundwissen Literarisches Verfahren • Grundwissen Poetik • Grundwissen Rhetorik • Hilfe Kreatives Schreiben • Hilfe Textredaktion • Hilfe Text überarbeiten • Kreatives Schreiben für Anfänger • Kreatives Schreiben für Dummies • Lehrbuch Kreatives Schreiben • Lehrgang Kreatives Schreiben • Ratgeber Kreatives Schreiben • Schreiben für Anfänger • Schreiben Schritt für Schritt • Schreiben Zusammenhang Inhalt und Form • Wie entsteht gute Literatur • Wie kann man gute Literatur schreiben • Wie schreibt man • Wie überarbeitet man einen Text • Wie werde ich Romanautor • Wie werde ich Schriftsteller |
| ISBN-10 | 3-15-962000-X / 315962000X |
| ISBN-13 | 978-3-15-962000-8 / 9783159620008 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich