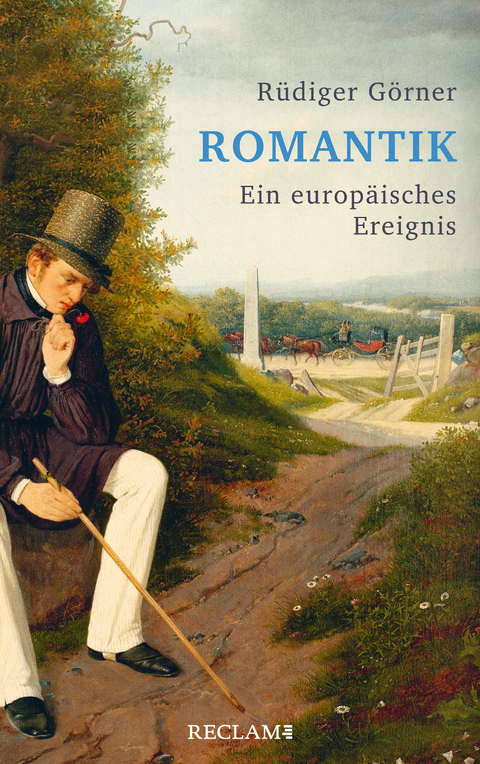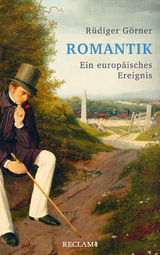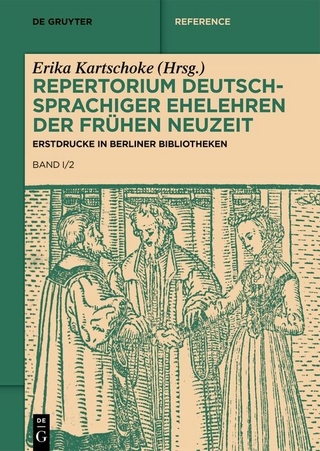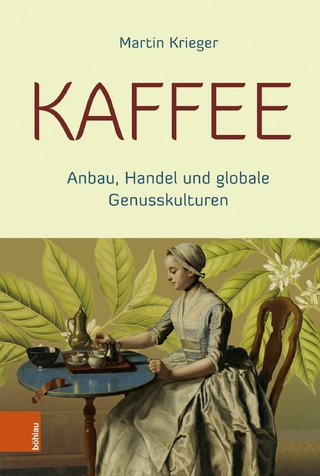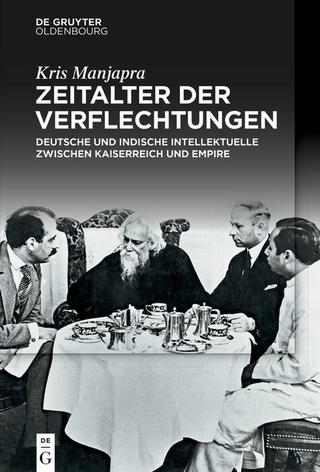Romantik (eBook)
384 Seiten
Reclam Verlag
978-3-15-961916-3 (ISBN)
Rüdiger Görner, geb. 1957, ist Professor für Neuere deutsche und vergleichende Literatur an der Queen Mary University of London. Er ist Autor zahlreicher Biographien und literaturgeschichtlicher Sachbücher sowie Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Görner lebt in London und in Lindau am Bodensee.
Rüdiger Görner, geb. 1957, ist Professor für Neuere deutsche und vergleichende Literatur an der Queen Mary University of London. Er ist Autor zahlreicher Biographien und literaturgeschichtlicher Sachbücher sowie Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Görner lebt in London und in Lindau am Bodensee.
Préludes mit weiblicher Note …
I … in As-Dur
II … in cis-Moll
III … in G-Dur
IV … in E-Dur
V … in D-Dur
Kapitel I
Bestimmungsversuche: Zugänge zur Romantik
Was Romantik ›ist‹ und wie man sie sieht
Revolutionäre Romantik auf dem Weg zum eigenen Ich
Geschichtlich-poetische Selbstbesinnung
Antisemitische Entgleisungen
Spätromantische Rückblicke (I)
Spätromantische Rückblicke (II)
Das unbekannte Meisterwerk als Ikone des Romantischen
Heinrich Heines Frühromantik
Kapitel II
Britisch-deutsche Verschlingungen in der Romantik
Vorspiel in Goslar
Das Bruchstück als ›Konfession‹
Geschichte und Imagination
Romantische Manifestationen
Ausklang mit Meistersängern à la E. T. A. Hoffmann
Kapitel III
Romanhafte Romantik
Wie (sich) eine Epoche erzählt
Experimentieren mit Sinnlichem, der Liebe und Gefühlsgrammatik zuliebe
Was der Roman vermag – eine romantische Ambition
Romantische Prosaisten – ein Quartett ›exemplarischer Sonderfälle‹: Novalis, E. T. A. Hoffmann, Hans Christian Andersen und Alexander S. Puschkin
Kapitel IV
Lyrische Weltbezüge oder: "Schläft ein Lied in allen Dingen"
Romantische Poesie und Prosa im Wechsel
Unterwegs zum "Zauberwort"
Die Lyrik des Späten am Rande der "Kunstperiode"
Wie politisch ist das romantische Gedicht?
Das Gedicht als Windharfe oder als Nest
Lyrisches Ausgreifen polarer Gegensätze: Karoline von Günderrode und Friedrich Rückert
Kapitel V
Schwellentanz: Das romantische Ballett als symbolische Kunstform
Kapitel VI
Romantisch Wissen schaffen
Wissensvorgaben und vulkanische Erfahrungen
Anderes, Neues wissen und benennen wollen
Carl Gustav Carus und die Psyche
Biosophisch gedacht
Was anzieht und abstößt – Romantischer Magnetismus und, einmal mehr, E. T. A. Hoffmann
Wortlob oder: Philologisches Wissen
Kapitel VII
Blühende Ruinenlandschaften, Nachtwelten und andere – auch theoretische – Kunsthorizonte
"Was malt er denn?" Mörikes Bilderzählung Maler Nolten und Balzacs Das unbekannte Meisterwerk
Romantisches Bild-Denken
Was ist eine ›romantische Landschaft‹?
Vom Blühen der Ruine
Nachtwelten, ein poetischer Exkurs in dunkle Klangbildwelten
Kapitel VIII
Da capo: die romantische Sprache der Musik, literarisch gehört
Beethoven als musikalisches Maß aller Klänge – eine Kreislerianerei
Das romantisch-utopische Musikethos des Hector Berlioz
Und noch einmal und immer wieder: E. T. A. Hoffmann
Vom Anrührenden des "Übelklangs" in Der arme Spielmann
Den Klängen nachsinnen
Kapitel IX
›Productive Imagination‹ und religiöse Anklänge in der englischen und deutschen (Spät-)Romantik
Auftakt mit Marbot
Romantische Kunstkritik auf Englisch
Heine rechnet ab
Romantische Resakralisierungen – durch Kunst
Was ›productive imagination‹ ist
Kapitel X
Finale con moto oder: Wie die Romantik verstehen?
Neuorientierungen
Die Frage der Fragen: das Verstehen
Wie enden? – monströs mit Frankenstein …
Ausblicke
Ein Aprèslude
Anmerkungen
Literaturhinweise
Abbildungsnachweis
Worte des Dankes
Personenregister
Préludes mit weiblicher Note …
I … in As-Dur
Europäischer gestimmt war man nie als in der (frühen) Romantik, dieser Fortsetzung der Aufklärung mit anderen Mitteln und Themen. Ihr vorrangiges Mittel war das Poetische; ihr Hauptthema die Psyche. Ihr bevorzugtes Ausdrucksmedium wurde überall verstanden, wie Joseph Haydn (1732–1809) zu antworten wusste, als man ihm in Wien zu bedenken gab, dass man ihn, der des Englischen nicht mächtig war, in London nicht verstehen würde: Musik verstehe die ganze Welt – damals tat das zumindest die europäische.
Romantisieren, wie es der Dichter Novalis (1772–1801) als universales ästhetisches Prinzip forderte, bedeutete in erster Linie: die Musikalisierung des Empfindens und seiner künstlerischen Umsetzung, in welcher Kunstform auch immer. E. T. A. Hoffmann (1776–1822), weltweit als Universalromantiker anerkannt, imaginierte in seiner schizophrenen Kunstfigur Johannes Kreisler einen erzählenden Musiker, der »pianissimo mit gehobenen Dämpfern im Baß den vollen As-Dur-Akkord« greift, dessen »versäuselnde Töne« ihn zum Sprechen bringen; er erzählt daraufhin in verschiedenen Tonarten, wobei dieses Erzählen einem Improvisieren in Worten gleicht.1
Reflektieren wir denn eingangs auch in quasi tonartenhaft vorgegebenen Stimmungen, stilistischen Schattierungen, vorspielgleichen gedanklichen Klangfärbungen, und versichern wir uns dabei der Form des Prélude, derer sich romantische Musiker so gerne bedienten. Das Prélude ist eine musikalische Vorskizze, ursprünglich als Einstimmung gedacht, wobei diese Vorspiele nicht selten Hauptsachen enthielten, Leitthemen für ganze Werke und Entwicklungen. Um es paradox zu sagen, was gleichfalls eine beliebte Aussageform in der Romantik war, im Prélude drückten sich schlussfolgernde Vorwegnahmen aus. Ich möchte nämlich auch in der Form der Darstellung, der Sageweise, mit zum Ausdruck bringen, dass die Romantik Ungewöhnliches bot auf eine Art, die uns bleibend zu beschäftigen hat: (sozial-)politisches Engagement und Herz-Schmerz-Poesie, philosophischer Tiefgang und Ironie, Spiel mit Formen und emanzipatorische Ansätze, Gefühlsauslotung und (natur-)wissenschaftliche Analyse. Das soll in Anspielung auf Tonarten geschehen, deren Klangcharakter die Romantik bevorzugt verwendete.
In den verschiedenen Kulturen Europas erwies sich das Romantische als ein Thema mit nationalen Variationen, die zeitversetzt wirkten. So klein die künstlerischen und intellektuellen Kreise in den einzelnen Ländern auch gewesen sind,2 in denen diese Variationen ›gespielt‹ wurden, sie übten doch erheblichen Einfluss auf die Selbstfindung der bürgerlichen Gesellschaften aus.
Kinder der Aufklärung waren die frühen Romantiker allesamt – auch und gerade im Hinblick auf ihre politische, auf Europa bezogene Einstellung.3 Sie probten im Schatten der Französischen Revolution und der Bewusstseinskritik Immanuel Kants die quasi radikale Gemeinschaft, das aber als Erzindividualisten, und verschwisterten sich quer durch Europa im Namen der Künste, die sie verflechten, wenn nicht gar vereinigen wollten.4 Friedrich Schlegel (1772–1829) etwa wird sich am Ende seines Aufenthalts in Paris (1802–04) dazu entschließen, die Schriften Gotthold Ephraim Lessings neu herauszugeben, obwohl er selbst nicht gerade ein Musterbeispiel für Lessing’sche Toleranz war. Das Urteil des von der Aufklärung her die frühe Romantik bedenkenden Romanisten Werner Krauss hat an Gültigkeit und Triftigkeit nichts eingebüßt: »Die Romantik ist zunächst Modernismus« gewesen,5 bevor sie sich der Restauration andiente.
Wie so oft schufen die ersten Vertreter einer neuen Zeitkultur, in diesem Fall die frühen Romantiker, zunächst eine culture mineure, eine Minderheitenkultur im Widerstand gegen den mainstream, bis diese selbst zur Mode wurde – und durch ihre romantisierenden Trivialnachahmer nicht selten zu einem ans Kitschhafte grenzenden Klischee. Man ließ die Perücken verstauben und trug das Haar offen; die Frauen in diesen intellektuell-künstlerischen Kreisen lockerten ihre Mieder. In den Salons in Berlin, die geistreiche Frauen jüdischer Herkunft als Orte geistiger Emanzipation begründet hatten,6 rief man die Republik des Geistes im Namen der Universalpoesie aus. Die Gesprächskreise im Hause von Rahel Varnhagen (1771–1833), Henriette Herz (1764–1847) und Dorothea Veit (1764–1839), der Tochter des jüdischen Aufklärers Moses Mendelssohn, zogen die Literaten magisch an.7
Die Salons der romantischen Frühzeit frequentieren etwa die Gebrüder Friedrich und August Wilhelm Schlegel (1767–1845), die man bald als die Gedankenschmiede der Romantik wahrnahm, die Wissenschaftler Wilhelm und Alexander von Humboldt, der Cheftheologe der Romantik, Friedrich Schleiermacher (1768–1834), sowie – als ungekrönter König in republikanischen Phantasien – der Dichter Ludwig Tieck (1773–1853);8 am Rande gehörte auch Novalis dazu. Man schätzt jedoch, dass in Berlin um 1798 gerade einmal einhundert Salonisten am ›Projekt Romantik‹ beteiligt waren – mit den Schlegels als Zentralgestirn und Novalis als geistesblitzendem Trabanten. Eine ähnliche Anzahl sammelte sich wohl in Jena um den jungen rebellischen Philosophen Johann Gottlieb Fichte (1762–1814). Bedeutend höhere Zahlen sind auch in den anderen europäischen Zentren und Schauplätzen der Romantik unwahrscheinlich. Aber was besagen schon Zahlen. Sie waren schon damals »Frevel«. Weitaus wesentlicher war die Wirkung dieser Einzelnen.
Als Zeugnis aus der Spätzeit dieser Gemeinschaft der Einzelnen, die sich mehr oder weniger vom Geist der Kunst für auserwählt hielten, mag dieses Bild der Bilder dienen, das von wahrer Eintracht unter kurzzeitig annähernd Gleichgesinnten geprägt scheint – man könnte auch sagen: Es übermalt ihre Spannungen. Es handelt sich um eine Ikonographie europäischer Romantik, geschaffen von Josef Danhauser am Ausgang der romantischen Kunstepoche (1840) im Auftrag des bedeutenden Wiener Klavierbauers Conrad Graf.
Abb. 1: Josef Danhauser, »Liszt am Flügel« (1840). Alte Nationalgalerie zu Berlin
Der Betrachter dieses Gemäldes soll sich wie ein Zaungast fühlen dürfen, gar wie ein Eindringling in diesen Kunstsalon. Zu sehen ist des Wiener Bildkünstlers Rückblick auf eine urromantische Szene, die Danhauser »Liszt am Flügel« (s. Abb. 1) nannte. Danhauser schart die prominenten Vertreter der Künste um Franz Liszt (1811–1886), der im Frühjahr 1838 und im Winter des darauffolgenden Jahres in Wien auf einem Graf-Flügel konzertiert hatte. In dieser Zusammenstellung hatte sich diese Künstlergruppe nie getroffen, schon gar nicht in Wien; wenn überhaupt wäre das eher in einem Pariser Salon möglich gewesen, etwa in jenem des Bildkünstlers Ary Scheffer (1795–1858): Einträchtig sich dem Spiel Liszts hingebend zeigt das Gemälde die Schriftstellerin George Sand (1804–1876), den Violinisten Niccolò Paganini (1782–1840), die Schriftsteller Alexandre Dumas d. Ä. (1802–1870) und Victor Hugo (1802–1885), den Komponisten Gioachino Rossini (1792–1868) und schließlich Liszts Geliebte, die Schriftstellerin und Historikerin Gräfin Marie d’Agoult (1805–1876), die ihrer beider Tochter Cosima das Leben schenken wird, der späteren zweiten Frau Richard Wagners. Bedeutsam sind die Verstorbenen, die nur als Kunstwerke, als Bild im Bild, präsent sind: der über allem thronende Beethoven und der den Hintergrund diskret dominierende englische Poet Lord Byron (1788–1824).
Einen bildenden Künstler sucht man auf diesem Gemälde jedoch vergebens, kein Eugène Delacroix (1798–1863) in Sicht, ein William Turner (1775–1851) schon gar nicht. Auch die Komponisten Clara (1819–1896) und Robert Schumann (1810–1856) fehlen, die beide zu der Zeit in Wien auf einem Graf-Flügel konzertierten. Aber Schumann war in Wien eben als vermeintlicher ›Revolutionär‹ eher verdächtig, auch wenn George Sand literarisch als Libertine weitaus ›revolutionärer‹ war. Der unsichtbare Urheber dieses Bildes, Danhauser selbst, vertrat die bildenden Künste und hatte damit die anderen buchstäblich in der Hand – oder eben am Pinselende, als seien sie die Marionetten des Malers. Seine visuelle Macht ermöglichte es ihm, sie alle zusammenzubringen, das Spiel Liszts sozusagen sicht- und...
| Erscheint lt. Verlag | 27.8.2021 |
|---|---|
| Verlagsort | Ditzingen |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geschichte ► Teilgebiete der Geschichte ► Kulturgeschichte |
| Schlagworte | Epochenbild Romantik • Epochenporträt Romantik • Epoche Romantik • Europäische Romantik • Kulturepoche Romantik • Romantik-Forschung • Romantik Kulturaustausch • Romantik Phänomen • Safranski Romantik |
| ISBN-10 | 3-15-961916-8 / 3159619168 |
| ISBN-13 | 978-3-15-961916-3 / 9783159619163 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich