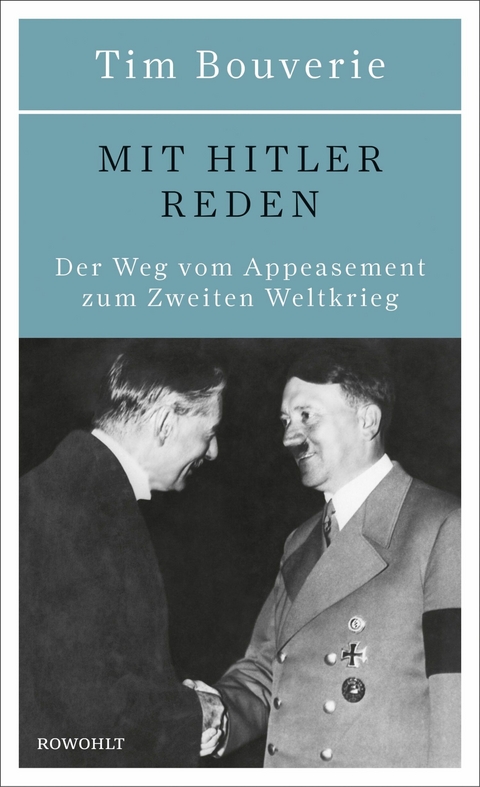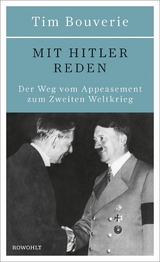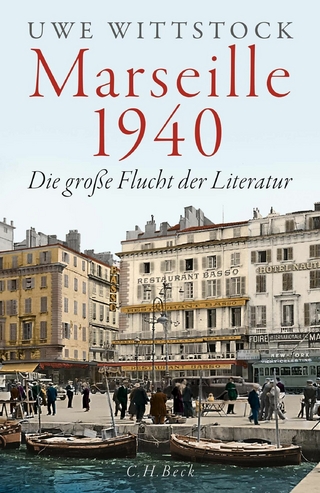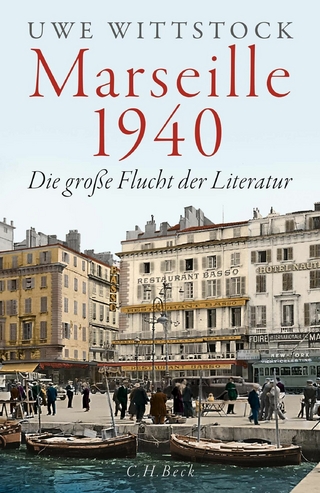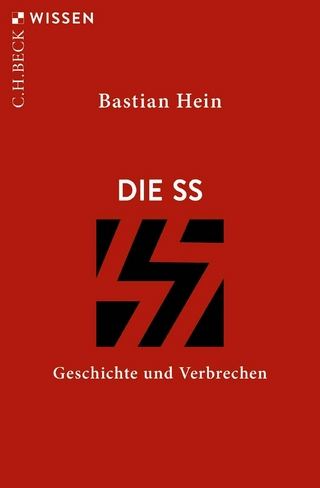Mit Hitler reden (eBook)
704 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-00512-9 (ISBN)
Tim Bouverie hat Geschichte am Christ Church College in Oxford studiert. Von 2013 bis 2017 arbeitete er als politischer Journalist für Channel 4. Er schreibt für The Spectator, The Observer und The Daily Telegraph und lebt in London. In den vergangenen fünf Jahren war er mitverantwortlich für das Chalke Valley History Festival.
Tim Bouverie hat Geschichte am Christ Church College in Oxford studiert. Von 2013 bis 2017 arbeitete er als politischer Journalist für Channel 4. Er schreibt für The Spectator, The Observer und The Daily Telegraph und lebt in London. In den vergangenen fünf Jahren war er mitverantwortlich für das Chalke Valley History Festival.
Vorbemerkung «Nie wieder Krieg!»
Was konnte angesichts des Ersten Weltkriegs verständlicher sein als der Wunsch, einen zweiten Weltkrieg zu verhindern? Es verwundert daher kaum, dass es sich bei diesem Wunsch seinerzeit um ein weltumspannendes Phänomen handelte. Mehr als 16,5 Millionen Menschen waren während des Ersten Weltkriegs getötet worden. In Großbritannien beklagte man 723000 Todesfälle, das Britische Empire zählte weitere 230000 Verluste, für Frankreich beziffert man die Zahl auf 1,7 Millionen, für Russland auf 1,8 Millionen, für Deutschland auf über 2 Millionen. Allein am ersten Tag der Schlacht an der Somme verloren 20000 britische Soldaten ihr Leben. Bis heute werden im Beinhaus von Douaumont die Gebeine von rund 130000 französischen und deutschen Soldaten aufbewahrt, die sterblichen Überreste von lediglich einem Sechstel der Gefallenen der 302 Tage dauernden Schlacht um Verdun. Unter den Überlebenden des Ersten Weltkriegs fand sich kaum jemand, der nicht zumindest seelische Narben davontrug, weil Vater, Ehemann, Sohn, Bruder, Cousin, Verlobter oder Freund getötet oder versehrt worden war. Als alles vorbei war, feierten noch nicht einmal die Gewinner das Ende als einen ruhmreichen Sieg. Dementsprechend war es auch kein Arc de Triomphe, der am 19. Juni 1919 als Ehrenmal von Whitehall in London enthüllt wurde, sondern ein Kenotaph, ein Symbol des Verlusts. Jedes Jahr am Tag des Waffenstillstands beteiligten sich Tausende Briten am stillen Trauerdefilee entlang dieses Kenotaphs, während auf der gesamten Insel in Schulen und Gemeinden, genau wie auf dem europäischen Festland auch, in Gedenkveranstaltungen an Freunde und Kollegen erinnert wurde. Die Losung dieser Zusammenkünfte hieß dabei über Jahre hinweg so konsequent wie entschieden: «Nie wieder Krieg!»
Dennoch kam es zu einem weiteren militärischen Konflikt. Trotz aller guten Absichten und Anstrengungen, die auf Beschwichtigung wie Abschreckung gezielt hatten, fanden sich Briten und Franzosen keine 21 Jahre nach dem Krieg, der alle Kriege hatte beenden sollen, in einem neuen Krieg wieder – mit demselben Kriegsgegner. Dieses Buch will zu einem besseren Verständnis der Entwicklungen, die zu diesem Ergebnis führten, einen Beitrag leisten.
Die Debatte über die Appeasement-Politik – den Versuch vonseiten Großbritanniens und Frankreichs, einen Krieg zu verhindern, indem man den diversen deutschen und italienischen Lamenti während der 1930er Jahre mit «maßvollen» Zugeständnissen zu begegnen versuchte – ist dabei als ausgesprochen langlebig und kontrovers zu charakterisieren. Während die einen in der Appeasement-Politik die «moralische wie objektive Katastrophe» sehen, die für den Konflikt mit den historisch höchsten Zahlen an Todesopfern verantwortlich ist, wurde sie von anderen als «eine noble Idee, die auf «christlichen Werten, Mut und gesundem Menschenverstand basiert»,[1] beschrieben. Zwischen diesen beiden Extremen lassen sich Hunderte von nuancierten Positionen finden, die sich in zahlreiche Unterargumente ausdifferenzieren und allerhand historische Kontroversen bedingen. Geschichte ist selten eindeutig, trotzdem werden von Politikern und Experten insbesondere in Großbritannien und den USA immer wieder gern die sogenannten Lehren aus der Geschichte bemüht, wenn es darum geht, Interventionen im Ausland zu legitimieren – in Korea, in der Golfregion, auf Kuba, in Vietnam, auf den Falklandinseln, im Kosovo und (bereits zweimal) im Irak. Gleichzeitig wird im Gegenzug jeder Versuch, eine Einigung mit einem früheren Gegenspieler zu finden, unweigerlich mit dem berüchtigten Münchner Abkommen von 1938 verglichen. Als ich mit der intensiveren Forschungsarbeit für dieses Buch im Frühjahr 2016 begann, hatten konservative Kreise in den USA in einer Kampagne gerade das Schreckgespenst von Neville Chamberlain gegen Präsident Obamas Atomabkommen mit dem Iran in Stellung gebracht. Inzwischen zirkuliert das Konzept des Appeasements in gänzlich anderen Zusammenhängen: etwa dort, wo der Westen nach einer Antwort auf die schwierige Frage sucht, wie mit der russischen Politik des Revanchismus und der Aggression umzugehen sei. Es scheint daher an der Zeit und ein berechtigtes Anliegen zu sein, in einer Neuerörterung des Appeasements herauszuarbeiten, wie diese Politik im Original konzipiert und umgesetzt wurde.
Selbstverständlich gibt es bereits ein beträchtliches Arsenal an Sekundärliteratur zu diesem Thema – auch wenn Anzahl und Aktualität der Veröffentlichungen oft überschätzt werden. Tatsächlich verhält es sich so, dass sich Publikationen über den Zweiten Weltkrieg in den letzten 20 Jahren zwar geradezu vervielfacht haben, die Vorgeschichte und die Ursachen dieser Katastrophe aber eher vernachlässigt wurden. Außerdem stellt man fest, dass es zwar viele exzellente Veröffentlichungen zur Appeasement-Politik gibt, die meisten sich jedoch entweder auf ein bestimmtes Ereignis, etwa das Münchner Abkommen, oder eine bestimmte Person, hier insbesondere Neville Chamberlain, fokussieren. Im Gegensatz dazu geht es mir darum, mit diesem Beitrag den gesamten historischen Zeitabschnitt zwischen Hitlers Ernennung zum Reichskanzler und der Beendigung des Sitzkriegs, auch Drôle de Guerre genannt, in den Blick zu nehmen und zu zeigen, wie sich das politische Konzept «Appeasement» entwickelt hat und wie sich die politischen Haltungen dazu mit der Zeit geändert haben. Außerdem war es mir wichtig, den Forschungsfokus breiter auszurichten und ein weiter gestreutes Personenfeld zu erfassen als lediglich die Hauptakteure. Der Wunsch, einen Krieg zu vermeiden, auch wenn man dafür einen Modus Vivendi mit den diktatorisch regierten Staaten Deutschland und Italien finden musste, wurde weit über die Grenzen der Regierung hinaus geteilt. Ich habe deswegen das Handeln von einigen weniger bekannten Personen, insbesondere das der sogenannten Amateurdiplomaten, in meine Forschungen mit einbezogen – wobei Chamberlain, Halifax, Churchill, Daladier und Roosevelt selbstverständlich auch in dieser Darstellung in ihrer zentralen Rolle für die Geschichte gewürdigt werden. Prinzipiell habe ich mich dafür entschieden, die Form einer narrativen Darstellung zu wählen, die die Unwägbarkeiten, die unmittelbare Dramatik und die Dilemmata der untersuchten Zeit erfasst. Der Leser wird so auf der Basis einer Auswertung von Tagebüchern, Briefen, Zeitungsartikeln und diplomatischer Korrespondenz entlang einer sich erzählend entfaltenden Chronologie – zu der Analyse und Einordnung des Geschehenen durchweg ihren Beitrag liefern – durch diese turbulenten Jahre geleitet. Um dies zu leisten, habe ich mehr als 40 Sammlungen privater Unterlagen und Korrespondenzen ausgewertet und dabei unveröffentlichtes Material entdecken können, das ich in den Text habe einfließen lassen, wann immer das möglich war, ohne den Erzählfluss zu beeinträchtigen. Im Text selber habe ich diese Funde nicht gesondert hervorgehoben, aber jeweils den unveröffentlichten Quellen den Vorzug vor bereits veröffentlichtem Material gegeben und zahlreich und ausführlich aus diesen Dokumenten zitiert.
Eine Veröffentlichung zu internationalen Beziehungen thematisiert ihren Gegenstand selbstverständlich aus internationaler Perspektive. Nichtsdestoweniger ist dies ein Buch über Politik, Gesellschaft und Diplomatie in Großbritannien. Denn auch wenn es heute in Vergessenheit geraten sein mag: In den 1930er Jahren war Großbritannien nominell noch immer das mächtigste Land der Welt – stolzer Dreh- und Angelpunkt eines Empires, dessen Fläche ein Viertel des Erdballs ausmachte. Es war nicht zu übersehen, dass Amerika die kommende Großmacht sein würde, aber die USA hatten sich infolge des Ersten Weltkriegs auf eine Position des Isolationismus zurückgezogen. Und Frankreich, das als einzige andere Nation in der Lage gewesen wäre, die deutschen Ambitionen zu beschränken, hatte sich entschieden, in Bezug auf diplomatische wie militärische Initiativen den Briten die Führungsrolle zu überlassen. Obwohl die Briten es vorgezogen hätten, nicht zu intensiv in die problematische Situation auf dem Kontinent involviert zu werden, fanden sie sich daher in einer gänzlich anderen Rolle wieder: als die eine politische Kraft, die sowohl faktisch als auch in der Wahrnehmung der Welt über die diplomatische Kompetenz, die moralische Autorität und die militärische Erfahrung verfügte, um Hitlers Streben nach der Vorherrschaft in Europa etwas entgegenzusetzen.
Die in Frage stehenden Entscheidungen, die nicht nur die Entwicklung Großbritanniens, sondern die Geschichte der ganzen Welt beeinflussen sollten, wurden dort von einer bemerkenswert übersichtlichen Anzahl von Personen getroffen. Die folgenden Ausführungen könnten zunächst den Eindruck erwecken, sie seien im Geist der ultimativen Ehrenrettung einer historischen Perspektive der «Geschichte großer Männer» geschrieben. Diese Männer (und es waren tatsächlich nahezu ausschließlich Männer) handelten jedoch keineswegs in einem gesellschaftlichen Vakuum. Großbritanniens politische Führungsmannschaft war sich ihres Handlungsspielraums ob der realen Rahmenbedingungen wie der vermeintlichen Zwänge in politischer, finanzieller, militärischer und diplomatischer Hinsicht äußerst bewusst. Und sie hatten die öffentliche Meinung bei allen ihren Überlegungen mit im Blick, auch wenn es sich dabei, in einer Ära, in der Meinungsumfragen noch in den Kinderschuhen steckten, noch um ein recht amorphes Gebilde handelte. Ignorieren konnte man die öffentliche...
| Erscheint lt. Verlag | 26.1.2021 |
|---|---|
| Übersetzer | Karin Hielscher |
| Zusatzinfo | 2 x 8 S. s/w Tafeln, mit 2 s/w Karten |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► 20. Jahrhundert bis 1945 |
| Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► 1918 bis 1945 | |
| Schlagworte | Abkommen von München • Appeasement-Politik • Buch zum Film "München - Im Angesicht des Krieges" • Christian Schwochow • Deutschland • Drittes Reich • Großbritannien • Hitler • Jeremy Irons • "München - Im Angesicht des Krieges" • "Munich - The Edge of War" • Netflix • Neville Chamberlain • Robert Harris • Robert Harris' München • Robert Harris' "Munich" • Ulrich Matthes • Winston Churchill |
| ISBN-10 | 3-644-00512-5 / 3644005125 |
| ISBN-13 | 978-3-644-00512-9 / 9783644005129 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 12,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich