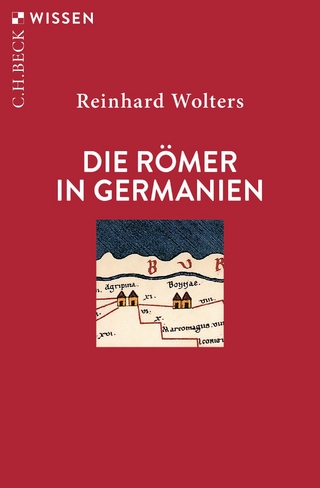Antike Welten
Einführungen in die Geschichte der Antike orientieren sich auch heute noch oft an politischen Ereignissen und den Taten "großer Männer". Beate Wagner-Hasel stellt in diesem Studienbuch dagegen die Kultur- und Religionsgeschichte, die Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie die Geschlechtergeschichte der antiken Welt ins Zentrum ihrer Darstellung, die chronologisch vom minoisch-mykenischen Griechenland bis in die römische Kaiserzeit reicht.
Entlang von Umbrüchen der politischen Systeme - der Entstehung der griechischen Polis, dem Sturz der Tyrannis, dem Aufkommen der attischen Demokratie, der Gründung und Krise der römischen Republik und der Ausbildung des Prinzipats - entfaltet sie ein farbiges Bild einer Epoche, deren kulturelle und soziale Praktiken uns heute fremd geworden sind, die für die Identität Europas aber unabdingbare Anknüpfungspunkte bietet.
Knossos, Troja, Athen, Rom, Pompeji, Palmyra
Einführungen in die Geschichte der Antike orientieren sich auch heute noch oft an politischen Ereignissen und den Taten "großer Männer". Beate Wagner-Hasel stellt in diesem Studienbuch dagegen die Kultur- und Religionsgeschichte, die Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie die Geschlechtergeschichte der antiken Welt ins Zentrum ihrer Darstellung, die chronologisch vom minoisch-mykenischen Griechenland bis in die römische Kaiserzeit reicht.
Entlang von Umbrüchen der politischen Systeme - der Entstehung der griechischen Polis, dem Sturz der Tyrannis, dem Aufkommen der attischen Demokratie, der Gründung und Krise der römischen Republik und der Ausbildung des Prinzipats - entfaltet sie ein farbiges Bild einer Epoche, deren kulturelle und soziale Praktiken uns heute fremd geworden sind, die für die Identität Europas aber unabdingbare Anknüpfungspunkte bietet.
Beate Wagner-Hasel ist emeritierte Professorin für Alte Geschichte an der Universität Hannover.
Inhalt
Einleitung: Antiquierte Antike?
Vom Nutzen der Alten Geschichte 7
1. Die minoisch-mykenische "Palastkultur" 15
1.1 Was Steine und Mythen erzählen: Europas Anfänge in Knossos 16
1.2 Buchhaltung und Schriftkultur: Die Entzifferung der Linear B-Tafeln 32
1.3 Der Untergang der "Palastkultur" und das Problem der Ethnogenese 39
2. Die griechische Poliskultur 51
2.1 Polisbildung: Revisionen und Perspektiven 52
2.2 Neue Schriftlichkeit und das Entstehen der Geschichtsschreibung 60
2.3 Mündliche Dichtung und Erinnerungskultur: Die Erzählung vom Trojanischen Krieg 67
2.4 Das Homerische Herrschaftssystem: Erbliches Königtum oder big men-System? 75
2.5 Der idealtypische Gesetzgeber: Solon und die Formierung der attischen Bürgerschaft 80
2.6 Tyrannenherrschaft und die Entwicklung Athens zum Kultzentrum 93
2.7 Politische Dressur im Theater: Demokratische Kultur in Athen 104
2.8 An der Polis und am Heiligen teilhaben: Das Bürgerrecht der Frauen 118
2.9 Lockende Ferne: Seeherrschaft und Piraterie im Zeitalter des Hellenismus 130
3. Das Römische Weltreich 144
3.1 Tuffstein, Tiberfurt und Salinen: Rom und seine Landschaften 147
3.2 Gründungsmythen und Exemplaliteratur: Die Fundierung der sozialen und politischen Ordnung Roms 158
3.3 Konsenskultur und Konkurrenz in der römischen Republik 175
3.4 Das Ende des Konsenses: Politische Skandale und die Krise der Republik 194
3.5 Hungerkrisen und die Etablierung des Prinzipats 206
3.6 Kaiserliche Pracht: Vom aristokratischen Hauswesen zum Hof des Princeps 215
3.7 Hinter dem Vorhang: Die Nachfolge?frage und die Macht der Kaiserfrauen 222
3.8 Pompeji: Vom Leben in einer römischen Stadt 229
3.9 Weltwunder Kolosseum und die Kultur der Spiele 245
3.10 Das Ende des Weströmischen Reiches: Wandel oder Niedergang? 256
Danksagung 267
Bibliographie 269
Register 305
Einleitung: Antiquierte Antike? Vom Nutzen der Alten Geschichte "Antiquierte Antike?": Mit dieser rhetorischen Frage überschrieb 1971 der Tübinger Altphilologe und Rhetorikprofessor Walter Jens seine Rede zur 350-Jahr-Feier des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Heilbronn, um mit dem Untertitel zugleich die Antwort zu geben: "Perspektiven eines neuen Humanismus". Autonomie bewahren zu können, einen geistigen Raum zu erhalten, in dem kritisches Überschreiten, Opposition und Absage sich entfalten könne, all dies sollte die Beschäftigung mit der Antike ermöglichen (Jens 1971, 57). Er spielte dabei mit der Doppelbedeutung von Antike als Wert- und Epochenbegriff. Antike kommt vom lateinischen antiquus, anticus ("alt", "ehrwürdig", "überkommen") und wurde erst im 17. Jh. zum Epochenbegriff erhoben (Settis 2005). Indem Jens die Erziehung zur Kritikfähigkeit zur Leitlinie seines gerade nicht antiquierten Antikenverständnisses machte, bot er der kritischen Generation der "1968er" ein ihr zeitgemäßes Antikenbild an, das dem Glauben an die Wandelbarkeit von Normen und Werten Rechnung trug. Damit setzte er sich von seinem älteren Kollegen, dem Tübinger Gräzisten Wolfgang Schadewaldt, ab, einem Verfechter des sogenannten Dritten Humanismus der 1930er Jahre. Zeitlose Geltung von Maß, Ordnung und Schönheit, vor allem aber der Vorrang eines abendländischen Menschenbildes gehörten zum Credo der Vertreter des Dritten Humanismus (Hölscher 1989, 4-6). Sie sahen sich in einer jahrhundertealten Tradition, die bis in die Renaissance und in das Zeitalter der Aufklärung zurückreichte. Bis ins 19. Jh. hinein dienten antike Werke als ein allgemeines Verständigungsmittel über politische und moralische Wertvorstellungen. Als es beispielsweise im 18. Jh. in Nordamerika darum ging, sich für eine bundesstaatliche oder eine zentralistische Ordnung zu entscheiden, bezogen sich die Gründungsväter der Vereinigten Staaten Amerikas in ihren politischen Reden auf antike Beispiele. Die Antiföderalisten bewunderten die antiken Bürgerheere und verwarfen den Vorschlag der Federalists, eine dauerhafte Armee zu unterhalten, wie dies Römer und Perser getan hätten. Sie hielten dies angesichts des antiken Vorbildes der Spartaner für überflüssig. Diese hätten einst mit nur wenigen Kriegern ihr Land gegen eine Million persischer Sklaven verteidigt (Richard 1994, 79). Auf historische Richtigkeit kam es dabei nicht an. Denn die Klasse der Spartiaten, von der hier die Rede ist, bildete eine gut trainierte Kriegerkaste; sie waren quasi-professionelle Krieger, nicht Bürger, die im zivilen Leben einem anderen Beruf als dem des Soldaten nachgingen. Geschichte diente hier als Schule der politischen Moral. Aus den Schriften antiker Historiker bezog man die Vorbilder für politische Tugenden und Regierungsmodelle. George Washington sah sich selbst als neuer Cato Uticenis, der einst die römische Republik verteidigt hatte (Richard 1994, 58); französische Revolutionäre bezogen sich auf Cicero, dessen Redegewandtheit sie sich zum Vorbild nahmen, und riefen zum Sturz der Monarchie auf (Dahlheim 62002, 671-734). Der Glaube, Aussagen antiker Autoren seien ohne Berücksichtigung des zeitlichen Abstands und des gesellschaftlichen Umfelds ihrer Entstehung ungebrochen verstehbar, wurde erst infrage gestellt, als die Beschäftigung mit der Antike verwissenschaftlicht wurde. War die Antike bis ins 18. Jh. Teil universalgeschichtlicher Betrachtungen, so bildeten sich im Laufe des 19. Jhs. unter dem Dach der "Altertumswissenschaft" einzelne Fachdisziplinen wie Klassische Philologie, Archäologie und Alte Geschichte mit jeweils eigenen Methoden und Fragestellungen heraus. Mit ihr ging eine quellenkritische Hinterfragung der Glaubwürdigkeit antiker Autoren einher, die einer Reflexion des historischen Kontextes, in dem antike Werke standen, und damit einer Relativierung der in ihnen fassbaren Wertvorstellungen Vorschub leisteten. Manche antike Ideale entpuppten sich bei näherer Betrachtung als Missverständnisse. So wurde das Ideal einer ästhetisch vorbildhaften, in hellem Marmor schimmernden antiken Kunst, das mit dem Namen Johann Joachim Winckelmann verbunden ist, bereits im 19. Jh. durch archäologische Forschungen von Alexander Conze oder dem Architekten und Kunsttheoretiker Gottfried Semper erschüttert. Diese hatten in ihren Werken auf die Farbigkeit antiker Statuen und Bauwerke verwiesen, was im übrigen auch Winckelmann wusste und was inzwischen durch neue wissenschaftliche Methoden zweifelsfrei bewiesen ist (Brinkmann/Wünsche 2004). Dass die Antike diese prominente Rolle als Bezugsrahmen für Wertvorstellungen spielen konnte, liegt nicht zuletzt an der Vorherrschaft des humanistischen Gymnasiums, das dem Erlernen der alten Sprachen, Latein und Griechisch, in allen europäischen Nationen Vorrang vor modernen Sprachen einräumte. Wer im 19. Jh. die Universität besuchte, kannte seine alten Griechen und Römer. Karl Marx (1818-1883), der Analytiker der Wirkungsweisen des Kapitals, schrieb seine Dissertation über den griechischen Philosophen Epikur. Max Weber (1867-1920), Gründervater der Soziologie, wurde mit einer Arbeit über die römische Agrargeschichte promoviert. Erst mit der Gleichstellung des Realgymnasiums und der Oberrealschule mit dem humanistischen Gymnasium, die in Deutschland um 1900 erfolgte, begann die Antike ihre prägende Kraft zu verlieren (Stroh 2013, 271-289). Dies rief wiederum jene eingangs erwähnte Re-Idealisierung der Antike im Dritten Humanismus hervor. Inzwischen sind die Natur- und Technikwissenschaften zu Leitwissenschaften geworden; die Antike hat ihre normative Bedeutung endgültig verloren. Die einst unumschränkte Rolle der altertumswissenschaftlichen Fächer als Deutungswissenschaften für die Gegenwart gilt nicht mehr. Und eben deshalb stellt sich heute mehr denn je die Frage nach dem gesellschaftlichen Nutzen der Beschäftigung mit der Antike. Zwei konträre Antworten seien dem folgenden Überblick über die antike Welt vorangestellt: Identitätsangebot versus Fremdheitsverstehen. Antike als Epochenbegriff Christophorus Cellarius (1708) unterteilte die Historia universalis in drei Perioden: Historia antiqua, Historia medii aevi, Historia nova. Letztere umfasste das 16. und 17. Jh.; das Mittelalter dauerte von der Herrschaft des römischen Kaisers Konstantin bis zur Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen. Die Historia antiqua, die "Alte Geschichte" bzw. "das Altertum", beginnt bei Cellarius mit dem Assyrerreich und endet mit dem Tod des ersten christlichen Kaisers Konstantin am Ende des 3. Jhs. n. Chr. (Cobet 2011, 878). Seitdem haben sich die Koordinaten der Epocheneinteilungen immer wieder verschoben; nur die Reihenfolge blieb bestehen. Unter Antike verstehen wir heute eine Epoche, die vom 2. Jahrtausend v. Chr. bis in die Zeit um 500 n. Chr. reicht und sich auf die griechischen und römischen Mittelmeerkulturen bezieht. An die Vorstellung von der normativen Geltung der Antike knüpft der 1995 gegründete Verein Alte Geschichte für Europa (AGE) an. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Bedarf an Vorbildern jenseits der nationalstaatlichen Geschichte zu befriedigen, der mit der Gründung der Europäischen Union entstanden ist. In der Gründungserklärung des Vereins werden überzeitliche Werte wie etwa antike Bürgerstaatlichkeit (bzw. Demokratie) oder die Geltung des Römischen Rechts im modernen Recht betont. Nach Auffassung des Vereins könnten antike Traditionen das Fundament eines neuen Europas bilden. Denn viele der heute in der Europäischen Union versammelten Staaten waren einmal Teil des Römischen Reiches und bildeten "in der Antike für mindestens fünfhundert Jahre bei vielerlei regionalen Besonderheiten doch eine riesige politisch-kulturelle Einheit, in welcher eine kaum überschaubare Vielzahl von Nationalitäten friedlich nebeneinander existierte, in einem Gebiet gut viermal so groß wie die heutige EU" (Girardet 1998, 26). Der Saarbrücker Althistoriker Klaus Martin Girardet verneint die ›imperialistische‹ Entstehungsgeschichte des Römischen Reiches nicht. Aber entscheidend ist für ihn dessen Einschätzung als eine "umfassende Kultur-, Rechts- und Wertegemeinschaft", und eben das qualifiziert in seinen Augen das Römische Reich als Vorbild für die heutige Staatengemeinschaft (Girardet 1998, 27 f.). Es gibt auch Gegenstimmen, die eine solche identitätsstiftende Funktion der Antike als eurozentristisch ablehnen und eine globale Perspektive einfordern. 2005 ist eine kleine Studie des Klassischen Archäologen Salvatore Settis erschienen, die der Zukunft des Klassischen. Eine Idee im Wandel der Zeiten nachspürt. Sein Ausgangspunkt ist genau die Frage, wie sie Girardet stellte, ob die Antike als gemeinschaftliche Wurzel der abendländischen Kultur ein identitätsstiftendes Element der Europäischen Union bilden könne (Settis 2005, 9 f.). Settis verneint dies klar, weil er ein europäisches Überlegenheitsdenken ablehnt und sich gegen eine Indienstnahme der Antike für die Begründung einer kulturellen Hegemonie des Abendlandes gegenüber dem Rest der Welt strikt verwahrt (ebd., 19). Dennoch ist er optimistisch, was den Nutzen der Antike angeht, setzt jedoch einen anderen Akzent. Er unterstreicht nicht die Tradition, sondern die Fremdheit der Antike. Settis will die Antike in das vielstimmige Konzert der Völker der Welt ›einfügen‹. Der Weg dahin führt in seinen Augen zum einen über das konsequente Historisieren und Kontextualisieren der Bemühungen um Rückbesinnung auf die Antike. Es gibt für ihn nicht die Antike, sondern nur verschiedene Arten, sich dieser Tradition zu bemächtigen. Sein Buch bietet einen Überblick über verschiedene Rezeptionsphasen und Rezeptionsarten der Antike von der Renaissance bis zum 20. Jh. Komparatistik bzw. das Anwenden der vergleichenden Methode ist für ihn ein weiterer Ansatz, der die Vielfalt und Komplexität der klassischen Kulturen erkennen lässt und die Klassischen Altertumswissenschaften in die Lage versetzt, sich mit den Experten des ›Anderen‹ zu verständigen. Sein Gewährsmann ist der Kunsthistoriker Aby Warburg, der den Kulturvergleich von seinem akademischen Lehrer Hermann Usener übernommen und in die Kunstgeschichte eingeführt hat. Für Warburg sind die Kunsterzeugnisse der klassischen Kulturen vergleichbar mit denen der Hopi-Indianer Nordamerikas. Alterität, nicht Identität macht nach Settis das Studium der Antike lohnend. Die Beschäftigung mit einer differenzierten, nicht auf ein klassisches Podest gestellten Antike dient ihm als "Schlüssel zum Verständnis der kulturellen Vielfalt unserer heutigen Welt und ihrer gegenseitigen Durchdringung" (ebd., 20). Eine Einbeziehung der antiken Kulturepochen anderer Welträume, etwa Asiens oder Mesoamerikas, wie dies neuerdings versucht wird (Schüren u. a. 2015), impliziert dieser Ansatz nicht. Betrachtet man aktuelle Einführungswerke, so orientieren sich diese meistens an der politischen Ereignis- und Institutionengeschichte und folgen einem chronologischen Aufbau, der in der Regel mit dem frühen Griechenland beginnt und bis zum Ende der römischen Kaiserzeit reicht (Gehrke/Schneider 2000/42013; Leppin 2005; Walter 2012). Zugenommen haben Einführungswerke, die nur einen Kulturraum behandeln, das antike Griechenland (Schmidt-Hofner 2016; Hall 2017; Ober 2015) oder das antike Rom (Beard 2016; Blösel 2015; Huttner 2008; Sommer 2013 und 2014). In einigen Einführungswerken haben auch die Geschichte der Antikenrezeption und die Geschichte des Faches einen gebührenden Platz gefunden (Dahlheim 1996/62002, 671-734; Gehrke/Schneider 42013, 1-20). Die Ausrichtung an der politischen Geschichte hat Tradition; das Erzählen der politischen Ereignisse war seit Entstehen der Alten Geschichte als wissenschaftliche Disziplin die vorherrschende Form, sich die Antike zu vergegenwärtigen. In jüngerer Zeit sind systematisch angelegte Einführungswerke hinzugekommen. Das von Eckart Wirbelauer herausgegebene Lehrbuch Antike (2004) enthält neben chronologischen und systematischen Übersichten auch Überblicksartikel über neue konzeptionelle Ansätze wie Geschlechter- oder Umweltgeschichte. Im Wachsen begriffen ist inzwischen die Zahl der Einführungswerke zu Spezialthemen, etwa zur antiken Wirtschaft (Finley 1977; Austin/Vidal-Naquet 1984; Drexhage/Ruffing 2002; Sommer 2013a; von Reden 2015), zur Sklaverei (Schumacher 2001; Herrmann-Otto 2009; 2013), zur Religion (Bruit Zaidman/Schmitt Pantel 1989; Rüpke 2001; Veyne 2008; Scheid 2003) und zur Frauen- und Geschlechtergeschichte (Späth/Wagner-Hasel 2000/22006; Scheer 2012). Eine weitere Variante von Einführungswerken informiert über Methoden der altertumswissenschaftlichen Teildisziplinen, die zur Klassischen Philologie, Archäologie und Alten Geschichte hinzugekommen sind, wie Numismatik, Papyrologie und Epigraphik (Günther 2001; Blum/Wolters 2006), sowie über deren Quellen wie Münzen, Papyri, Inschriften, Statuen und Vasen. Viele Einzeldisziplinen der Altertumswissenschaft wie die Archäologie (Borbein 2000; Hölscher 2002; Renfrew/Bahn 2009), Ägyptologie oder Vorderasiatische Altertumskunde (Nissen 1983; 1999) haben ihre eigenen Einführungswerke. Warum also den vorliegenden Einführungen eine weitere hinzufügen? Mich beschäftigt die Frage, wie eine chronologische Darstellung der antiken Welt, die am politischen Wandel orientiert ist, mit einer systematischen Herangehensweise verknüpft werden kann, die sowohl die Wirtschafts- und Sozialgeschichte als auch die Kultur- und Geschlechtergeschichte einbezieht. Im 19. Jh. wurde das Problem der Verknüpfung von Chronologie und Systematik in der Weise gelöst, dass neben Werken zur politischen Ereignisgeschichte sogenannte "Privataltertümer" verfasst wurden, welche das vermeintlich Beständige in den Blick nahmen, nämlich die Sitten und Gebräuche, die den Alltag prägten: die Wohnhäuser, die Speisegewohnheiten, die Familie mit ihren Heirats- und Bestattungsritualen, das Verhältnis der Geschlechter, die Wirtschaftsweise (Momigliano 1999; Wagner-Hasel 1998; Nippel 2013). Um 1900 wurden auch diese Gegenstände historisiert, d. h. es wurde nach dem Wandel der Wirtschaftsweise oder der Familienformen gefragt. Es entstanden eigene Werke zur Sozial-, Wirtschafts- und Frauengeschichte, die mit einer theoretischen Reflexion der behandelten Gegenstände einhergingen. Ein Beispiel stellt die Entwicklung von Stufenmodellen dar, die dazu dienten, unterschiedliche Wirtschaftsweisen oder Verwandtschaftsordnungen zu systematisieren. Inzwischen haben sich die methodischen und theoretischen Zugriffe vervielfältigt; die Anregungen dazu stammen vielfach aus Nachbardisziplinen wie der Soziologie, Ethnologie und Politologie. Sie haben nicht nur Kategorien- und Begriffsbildung beeinflusst, mit denen antike Befunde erfasst werden, sondern auch zu grundsätzlichen Perspektivenverschiebungen beigetragen. Gerieten mit der sogenannten Neuen Sozialgeschichte der 1970er Jahre neben den politischen Akteuren nun auch andere gesellschaftliche Gruppen wie Sklaven, Arme, Alte, Fremde und Frauen in den Blick, so ist mit der Neuen Kulturgeschichte und Historischen Anthropologie der 1990er Jahre das Individuum mit seinen Erfahrungen in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Nur geht es hier nicht mehr um die sogenannten großen Männer, die ihren angestammten Platz in der politischen Ereignisgeschichte haben, sondern ganz allgemein um Mentalitäten, Verhaltensweisen und soziale Praktiken von ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Ein sowohl chronologischer als auch systematischer Zugriff ist nicht ohne radikale Begrenzung möglich. Deshalb liegt der Fokus weniger auf politischen Ereignissen als vielmehr auf politischen Strukturen. Um den Wandel in den Blick nehmen zu können, habe ich mich in diesem Buch für eine Konzentration auf Krisen- und Umbruchphasen entschieden: auf den Übergang von der minoisch-mykenischen Zeit zur entstehenden Polis; auf den Sturz der Tyrannis und die Entstehung der attischen Demokratie, auf die Gründung und Krise der römischen Republik und auf die Herausbildung des Prinzipats. Als ›Grundgewebe‹ dienen die Ausführungen zum Entstehen der Schrift und zu den Anfängen einer schriftlichen Form der Erinnerung des Vergangenen. Dies ist auch der Grund, warum der Überblick anders als viele Einführungswerke die bronzezeitlichen Kulturen des 2. Jahrtausends einbezieht, da hier die ersten Schriftzeugnisse entstehen. Das eigentliche Gewebemuster aber liefern die systematischen Schwerpunkte, die der Vielfalt der Subdisziplinen mit ihren spezifischen Fragestellungen und Methoden Rechnung tragen: die Rechts-, Kultur- und Religionsgeschichte, die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, die Geschlechtergeschichte. Da es nicht möglich ist, die Breite der neuen Einsichten, die auf diesen Gebieten gewonnen wurden, in einem Band zu präsentieren, wurden in den einzelnen Kapiteln thematische Schwerpunkte gesetzt. Forschungen, die das Fremdheitsverstehen fördern, erhielten Vorrang vor traditionellen Positionen. Zudem werden in jedem Kapitel unterschiedliche Überlieferungsarten bzw. Quellengattungen vorgestellt (Überblick bei Leppin 2005, 18-34), die - um im Bild zu bleiben - den Stoff bilden, aus dem Geschichte gewoben wird. 1. Die minoisch-mykenische "Palastkultur" Im Palast des Minos - so lautet der Titel eines äußerst erfolgreichen Buches über die Ursprünge der europäischen Geschichte, das 1913 erschien. Es beginnt mit dem Satz: "In Knossos gräbt Sir Arthur Evans Märchen aus." Die Autorin, Bertha Eckstein-Diener, eine Wiener Industriellentochter, die der anthroposophischen Bewegung um Rudolf Steiner nahe stand, hatte damals gerade begonnen, sich als Kulturhistorikerin einen Namen zu machen (Mulot-Deri 1987). In den 1920er Jahren sollte die Studie über Mütter und Amazonen folgen, in der sie sich der Idee eines ursprünglichen Matriarchats annahm, die in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. von dem Basler Rechtshistoriker Johann Jakob Bachofen in die Altertumswissenschaft eingebracht worden war. Dass Eckstein-Diener das minoische Kreta zum Sujet ihres ersten Werkes wählte, zeigt die Faszination, die um 1900 von der Archäologie ausging. Diese gab vor, Licht in die Wirkungsstätten der antiken Mythologie zu bringen und zugleich die materiellen Grundlagen für die Bachofen'sche Idee einer urspünglichen Frauenherrschaft zu liefern, die in den neu entstandenen Kultur- und Sozialwissenschaften um 1900 breite Resonanz gefunden hatte (Wagner-Hasel 1992). Kreta war nach Auskunft unserer ältesten literarischen Quelle, den Epen Homers, das Herrschaftsgebiet des Königs Minos, eines Sprösslings des olympischen Göttervaters Zeus, und der Europa, einer phönizischen Königstochter, nach der bereits in der Antike ein ganzer Kontinent benannt wurde (Demandt 1998). Ihren Sohn Minos machte Evans zum Namensgeber der von ihm entdeckten kretischen Kultur des dritten und zweiten Jahrtausends v. Chr. Das minoische Kreta fungiert seitdem in doppelter Weise als Projektionsfläche des Eigenen und des Fremden: In den Augen der Frauenbewegung steht die minoische Kultur für eine friedliche, feminine Gegenwelt zum kriegerischen Patriarchat, wobei als Beleg vor allem Fresken mit Frauendarstellungen dienen, die in der Imagination von Bertha Eckstein-Diener geradezu modern anmuten: "Auf Terrassen, in Gruppen plaudernd, sahen merkwürdig moderne Damen, onduliert, mit Reifröcken und Stöckelschuhen, über Gärten hinweg, Kampf und Sport der Männer zu, die braun und schlank, glattrasiert, mit lockigem Haupthaar, in ihrer Nacktheit seltsam abstanden von den überkleideten Frauen. Nur ein Lendenschurz mit goldenem Gürtel zog die Taille wespengleich ein. Weiße oder helle Wickelgamaschen schützen den Fuß bis zur Wade. Als ein französischer Gelehrter die minoischen Hofdamen, wie aus einem Modeblatt geschnitten, zum erstenmal erblickte, soll er gerufen haben: ›Mais ce sont des Parisiennes!‹ […] Die minoische Frau stand ungefähr auf dem Standpunkt der heutigen Durchschnittsmondäne" (zitiert nach Mulot-Deri 1987, 184 f.). Gegenwart und Vergangenheit gehen in der Vorstellungswelt der Wiener Kulturhistorikerin ineinander über; das minoische Kreta des 2. Jahrtausends wird zum Spiegel ihrer eigenen Zeit. Für die Fachwissenschaft, die dieses Bild durchaus bedient hat, geriet das minoische Kreta aufgrund seiner andersartigen Architektur, die keinerlei Ähnlichkeiten mit den Tempelbauten des klassischen Griechenland aufweist, ebenfalls zum radikal Anderen, zumal auch die in den 1950er Jahren entzifferten Schriftzeugnisse mehr Gemeinsamkeiten mit den Schriften des Vorderen Orients als mit denen des klassischen Griechenlands besitzen. 1.1 Was Steine und Mythen erzählen: Europas Anfänge in Knossos Der Name Knossos war seit der Antike "mit dem Platz sechs Kilometer südlich von Heraklion verbunden geblieben, wo auf den Feldern, in den Olivenhainen und den Weinbergen die Spuren der antiken Vergangenheit offen zutage lagen" (Fitton 2000, 227). Aber gegraben wurde nicht. Bis ins 18. Jh. war die Erforschung der antiken Welt des Mittelmeerraumes "auf antiquarische Weise durch Reisen und Beschreiben betrieben worden"; erst "durch die neue Wissenschaft der Archäologie" wurde die Erforschung des Altertums mit dem Spaten auf eine neue Grundlage gestellt (Fitton 2004, 229). Evans war nicht der erste und einzige, der auf Kreta grub. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jhs. hatten Hobbyarchäologen auf dem flachen Hügel namens Kephala ("Hügel des Herrn") zu graben begonnen. 1878 unternahm der griechische Altertumsforscher Minos Kalokairinos, der als Dolmetscher im britischen Konsulat in Chania arbeitete und sich zudem im Öl- und Seifenhandel betätigte, auf dem Hügel eine Versuchsgrabung und barg zwölf riesige Tonkrüge (gr. píthoi). Er war offensichtlich in den später Westmagazin genannten Teilabschnitt der Anlage geraten. Vier von den Pithoi, die noch Getreidekörner enthielten, bildeten den Grundstock für ein archäologisches Museum in Heraklion, während die anderen Gefäße an die Museen der europäischen Metropolen gingen. Diese Funde lockten viele ausländische Archäologen an, so 1886 auch den deutschen Kaufmann Heinrich Schliemann, der in den 1870er Jahren die Stätten eines anderen Mythos, nämlich die Schauplätze der Ereignisse um den Trojanischen Krieg, ausgegraben hatte: das Mykene des griechischen Helden Agamemnon (1876) und Tiryns (1871) sowie Troja (ab 1868), den Schauplatz des zehnjährigen Krieges zwischen Achaiern und Trojanern um die schöne Helena. 1895 gelang es dann nicht Schliemann, sondern dem Briten Arthur Evans (1851-1941), der den kretischen Hügel erstmals 1894 aufgesucht hatte, das ganze Terrain von Knossos für 122.000 Piaster zu kaufen. Anders als Heinrich Schliemann war Evans ausgebildeter Historiker und hatte in Oxford und Göttingen Geschichte studiert. In Illyrien (Dalmatien) fand er ein erstes Betätigungsfeld, wurde aber 1882 von den österreichischen Behörden ausgewiesen, weil er zu sehr mit der illyrischen Freiheitsbewegung sympathisiert hatte. 1884 erhielt er den Posten des Direktors des Ashmolean Museum in Oxford, den er bis 1908 innehatte. Nach Kreta hatten ihn Funde von Siegeln gelockt, die ein Freund 1893 von einer Kretareise ins Ashmolean Museum mitgebracht hatte. Aber erst nach Ende der Osmanischen Herrschaft konnte er an die Realisierung seines Vorhabens denken. Am 1. März 1900 begannen die Grabungen, die Evans 35 Jahre in Atem halten sollten. In nur drei Kampagnen von jeweils drei Monaten Dauer (1900-1902) legte Evans mit seinem Team rund 20.000 Quadratmeter frei. Die freigelegte Anlage öffnete den Blick auf mehrstöckige Ruinen mit farbigen Wandbemalungen, Pflasterungen, lebensgroße Tongefäße, Fayencen, unzählige Siegel und Tontafeln, Webgewichte und vieles mehr. Seine Ergebnisse, über die Evans in der Zeitschrift der British School of Athens regelmäßig berichtete, fasste Evans später in dem mehrbändigen Werk The Palace of Minos at Knossos zusammen, das zwischen 1921 und 1936 erschien (Fitton 2000, 227-236; Faure 1976, 17-29). Der wissenschaftliche Wert der Grabungen von Evans ist umstritten. Um die ausgegrabenen Ruinen vor dem Zusammenbruch zu bewahren, stützte er sie mit Stahlträgern und Beton ab - eine heute höchst umstrittene Rekonstruktionsweise, die bereits Federico Halbherr und Luigi Pernier, die zeitgleich mit Evans im Süden Kretas, in Phaistos, gruben, ablehnten. Auch die großflächig angelegte Grabung besaß ihre Tücken. Viele eilig geborgene Funde konnten gar nicht ausgewertet werden; ein Großteil verschwand in Magazinen und wurde 60 Jahre lang nicht beachtet. Heute fehlen oft die Etiketten, von vielen Funden lässt sich der genaue Fundumstand nicht mehr rekonstruieren, zumal Evans sich in seinen Publikationen und Grabungstagebüchern mehrfach widersprach und vielleicht selbst den Überblick nicht behalten hatte. Zu Beginn des 19. Jhs. hatte der dänische Vorgeschichtsforscher Christian Jörgensen Thomson (1819) das bis heute gebräuchliche Stufenschema "Steinzeit - Bronzezeit - Eisenzeit" entwickelt. Es handelt sich um ein ausschließlich technologisches Schema, das sich am Fortschritt der Produktionstechniken orientiert und daher ein dem industriellen Zeitalter angemessenes Periodisierungsschema darstellt (Schnapp 32011, 323-327). Gelehrte des 18. Jhs. differenzierten dagegen zwischen Wildheit, Barbarei und Zivilisation und orientierten sich damit an der Verfeinerung der Sitten. Noch aus der Antike stammt die Unterteilung in Wirtschaftsstufen (Jäger - Hirten - Ackerbauern), die im 19. Jh. vor allem von Nationalökonomen weiter entwickelt wurde, um dem wirtschaftlichen Wandel gerecht zu werden, der durch die Industrialisierung ausgelöst worden war. Dazu gehört beispielsweise die Unterscheidung zwischen Haus-, Stadt- und Volkswirtschaft. Auch die Trennung zwischen einer matriarchalen und patriarchalen Phase fügt sich in dieses neue Bemühen um die Entwicklung von Kulturstufenmodellen, an dem nahezu alle Wissenschaften im 19. Jh. beteiligt waren. Während die meisten evolutionstheoretischen Konzepte des 19. Jhs. jedoch kritisiert und relativiert worden sind, ist das technologische Schema der Unterteilung in Stein-, Bronze- und Eisenzeit unangefochten geblieben. Wo Bronze, aber kein Eisen gefunden wird, befinden wir uns im Bronzezeitalter, das für die Mittelmeerwelt für die Zeit zwischen 3000 und 1000 v. Chr. angesetzt wird. Dieses Schema kannte Evans, als er zu graben begann. Er unterteilte dieses technologische Schema in weitere Abschnitte, die an Keramikstilen orientiert sind und die Aufstellung einer relativen Chronologie erlaubten. Eine relative zeitliche Einordnung konnte Evans vornehmen, indem er Geländeschnitte anlegte und in Schichten aufteilte. Die Benennung der einzelnen Schichten erfolgte nach dem sagenhaften König Minos: frühminoisch, mittelminoisch, spätminoisch. Je differenzierter sich in der Folge die Fundsituation herausstellte, desto ausgefeilter wurden die Unterteilungen: frühminoisch I, II, III, frühminoisch I A und B etc. Für die mittelminoische Zeit wird auch zwischen einer frühen (1950-1700) und einer späten Palastzeit (1700-1450) unterschieden. Für die spätminoische Zeit gilt eine weitere Unterteilung in die Zeit der letzten Paläste (1450-1375/50) und in die Nachpalastzeit (1375/50-1200). Auf dem Festland heißen die Phasen nach der antiken Bezeichnung für Griechenland, Hellas, frühhelladisch, mittelhelladisch und späthelladisch. Hier wird die späthelladische Zeit obendrein nach dem Fundort Mykene als mykenische Zeit benannt. Diejenigen, die von einer Eroberung Kretas durch die Mykener ausgehen, bezeichnen auch die letzten Phasen der bronzezeitlichen Kultur auf Kreta als mykenisch (Hölscher 2002, 47-54; Bäbler 22012, 50-55). Diese Schemata, die stets eine Dreiteilung aufweisen, unterstellen alle eine Reife-, Blüte- und Verfallszeit. Absolute Chronologien, d. h. die Umrechnung in für uns gültige Jahreszahlen, sind vereinzelt möglich. So ist eine genaue Datierung der Denkmäler mit Hilfe von Synchronismen erfolgt: Trägt z. B. der Deckel einer Alabastervase aus Knossos den Namen und Titel des Hyksoskönigs Chian, so lässt sich mittels der ägyptischen Geschichte, die Chronographien in Form von Dynastien kennt, die Vase in die Zeit um 1630 v. Chr. datieren. Absolute Datierungen sind aber erst mit Hilfe der Radio-Carbon-Methode und der Kalium-Argon-Methode möglich geworden, über die Evans noch nicht verfügte. Die radiometrische Verfahrensweise ist ein Kind der Atomphysik und fand nach dem Zweiten Weltkrieg Eingang in die Archäologie (Renfrew/Bahn 2009, 96-128). Die Funde, die Evans machte, gehören vorwiegend in die mittelminoische Periode. Die von ihm ausgegrabene Anlage in Knossos unterscheidet sich stark von den bekannten Bauten der Antike, deren Überreste Reisende um 1900 noch in Athen oder Rom sehen konnten und die aus der Zeit zwischen 500 v. und 500 n. Chr. stammen. Um einen großen Innenhof gruppieren sich Räume, die - nach den Kleinfunden und Fresken zu urteilen - verschiedene Funktionen hatten. Im Westteil mit den großen Vorratsgefäßen lagen Wirtschaftsräume, im Ostteil Wohn- und Kulträume. Auch Anlagen in Phaistos in der Mesara-Ebene im Süden Kretas, in Mallia an der Nordküste, in Kato Zakros im Osten und auch der neuerdings entdeckte Palast von Galatas weisen diese Baustruktur auf. Die Anlage ist nicht symmetrisch aufgebaut wie die späteren Bauten des klassischen Griechenland, sondern agglutinierend ("anklebend"). Evans hielt die ausgegrabenen Teile für Ruinen eines Palastes aus dem 2. Jahrtausend v. Chr., in dem seiner Meinung nach ein Priesterkönig herrschte. Grundlage für diese Annahme bildeten einige Freskenabbildungen, die in die späte Palastzeit (1700/1600) zu datieren sind: das sogenannte Tempelfresko, das Olivenhainfresko und das Fresko des "Lilienprinzen". Sie zeigen weibliche und männliche Personen schreitend, tanzend, sitzend. Eben diese Fresken waren es, die die Phantasie der Ausgräber und ihres Publikums beflügelten.
| Erscheinungsdatum | 04.11.2017 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Historische Einführungen ; 18 |
| Verlagsort | Frankfurt |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 134 x 206 mm |
| Gewicht | 411 g |
| Themenwelt | Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► Altertum / Antike |
| Schlagworte | Antike • Antike; Geistes-/Kultur-Geschichte • Athen • Frühgeschichte / Antike • Geschichte • Griechenland • Griechische Antike • Imperium • Italien • Kaiser • Korinth • Kreta • Minoer • Mykene • Odyssee,Ilias • Pompeji • Rom • römische Antike • Römisches Reich • Troja |
| ISBN-10 | 3-593-50792-7 / 3593507927 |
| ISBN-13 | 978-3-593-50792-7 / 9783593507927 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich