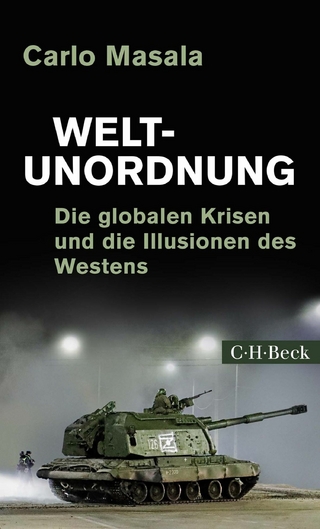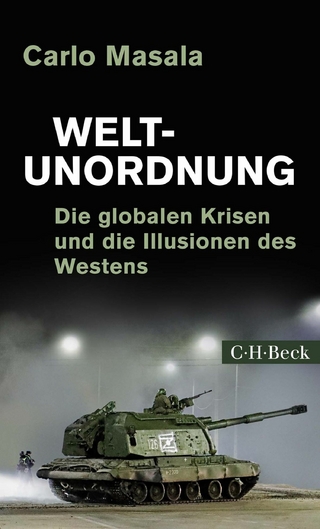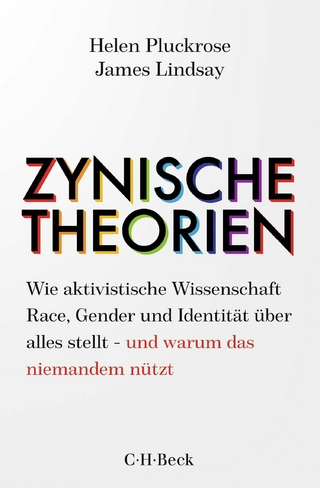Söhne großziehen als Feministin (eBook)
200 Seiten
Carl Hanser Verlag München
978-3-446-28028-1 (ISBN)
Ihren Feminismus hat Shila Behjat durch unzählige Erfahrungen erlernt und sie kämpft für eine Welt, in der Männer nicht länger das Maß aller Dinge sind. Nun ist sie Mutter zweier Söhne - die im Alltag so manches Rollenmuster ins Wanken bringen. Persönlich und ungemein berührend erzählt Behjat anhand ganz alltäglicher Situationen, wie das Leben mit zwei heranwachsenden Jungs ihre feministische Haltung verändert hat - und verortet ihre Erfahrungen und Gedanken in den Debatten unserer Zeit. Auf diese Weise stellt sie sich lange vernachlässigten Fragen der Gleichberechtigung, die nicht nur Eltern, sondern die Gesellschaft als Ganze angehen. Ein konstruktives, selbstkritisches und sehr bewegendes Debüt, das zeigt: Es ist Zeit für ein Streitgespräch - mit uns selbst!
Shila Behjat, 1982 geboren, ist Journalistin und Publizistin mit deutschiranischen Wurzeln. Sie studierte Jura in Hamburg und Paris, war Korrespondentin in London, lebte als freie Journalistin in Indien und berichtete für das Frauenportal Aufeminin.com über Gleichstellung in der EU. Als Kulturredakteurin bei ARTE verantwortet sie nun Dokumentationen und neue Formate. Sie moderiert regelmäßig vor der Kamera und auf Veranstaltungen. Mit ihrer Familie lebt sie in Berlin.
Feminismus — und jetzt?
Feminismus als System
Denn die Forderungen nach Gleichheit für Frauen und nach Gleichheit unter Frauen sind noch immer zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Ja es ist sogar möglich, die Männer dafür zu verurteilen, dass sie Frauen nur eine »weibliche« Sicht auf die Welt zutrauen und keine allgemeingültige — und im selben Atemzug Frauen wie mir absprechen, für den Feminismus als Ganzes sprechen zu können.
»History is a weapon«, überschrieb Audre Lorde 1979 einen Brief, den sie, weil er vier Monate unbeantwortet geblieben war, »der Gemeinschaft der Frauen« öffnete und ihn unter anderem in ihrem Buch Sister Outsider veröffentlichte.7 Adressiert hatte Lorde das Schreiben an die Feministin Mary Daly, eine lesbische katholische Theologin und Philosophin, die die feministische Community gerade mit ihrem Buch Gyn/Ecology begeistert hatte. Sie wolle, so Lorde, mit ihrem Brief Gedanken formulieren, die sie dazu mit sich herumgetragen habe, »in der Hoffnung, die Früchte meiner Einsichten mit dir teilen zu können, so wie du die Früchte deiner mit mir geteilt hast«. In Dalys Ausführungen vermisse sie die Schwarze Perspektive, in der Auflistung weiblicher Gottheiten sei nicht eine afrikanische zu finden. Schwarze Frauen kämen allein vor, wenn es darum gehe, Genitalverstümmelung zu thematisieren. »Unsere schwarzen Urmütter zu verleugnen bedeutet, zu verleugnen, wo europäische Frauen gelernt haben zu lieben. Als eine afrikanisch-amerikanische Frau im weißen Patriarchat bin ich es zwar gewohnt, dass meine archetypische Vergangenheit verfälscht und trivialisiert wird, aber es ist furchtbar schmerzhaft, zu merken, dass es von einer Frau getan wird, deren Wissen so sehr dem meinen ähnelt.« Die Unterdrückung der Frau, so Lorde, kenne keine ethnischen oder »rassischen« Grenzen, das sei richtig, aber heiße im Umkehrschluss nicht, dass die Unterdrückung im Rahmen dieser konstruierten Unterschiede nicht verschieden sei. Dies zu übergehen bedeute, die Gemeinsamkeiten ebenso zu verfälschen wie die Unterschiede. Und das führe dazu, dass »hinter der Schwesternschaft noch immer der Rassismus bleibt«.
Obwohl mich die Entrüstung über die Gewalt gegen, die Gängelung und Unterdrückung von Frauen mit anderen verband, unterschied sich mein Kampf dagegen von vielen, vor allem einer weißen, westlich-christlich angehörigen Mehrheit von Frauen. Eine weibliche Person mit meinem Namen, meiner Herkunft und meiner Religionszugehörigkeit fächerte viel mehr auf, ich bot schlicht viel mehr Angriffsfläche, diskriminiert zu werden. Das war es, was uns trennte, warum als deutsch gelesene Frauen meinen Kampf nie ganz begreifen, meine Wut nie ganz nachvollziehen, meine Anstrengung nicht verstehen konnten, weil es für sie, obwohl sie Frauen waren, etliche Situationen gab, in denen ihre Bestimmung, Verortung und Validierung einfach nicht infrage gestellt wurden. Zum Beispiel bei der einfachen Angelegenheit, beim Namen genannt zu werden. Meiner dagegen galt immer wieder als »zu kompliziert«, in einem beruflichen Videocall wurde ich einmal einfach so vom Leiter einer führenden deutschen Stiftung durchweg »Frau Shila« genannt. Wo da anfangen, frage ich mich. Oder die »Freundin«, die auf dem Schulhof ebenfalls Schwierigkeiten mit meinem Namen hatte, dieses Mal jedoch mit dem Vornamen, und die mich kurzerhand Rebecca nannte, mein zweiter, völlig unbenutzter, mir fremder Vorname. »Shila klingt irgendwie komisch.« Kicher.
In derartigen Episoden meines Lebens zeigte sich mir mit erschütternder Klarheit, wie Unterdrückung aussieht — wie Dominanz ausgespielt wird. Der ur-feministische Anlass für Widerstand also. An meinem Leben könnten viele, um nicht zu sagen, genau sie, die sich diesem Widerstand gegen Unterdrückung verschrieben haben, plakativ sehen und aufzeigen, wie ungerecht das Patriarchat in seinen Unterdrückungsmechanismen ist, indem es alles, was von der weiß-männlichen Form abweicht, als Anlass nimmt, von Macht auszuschließen. Intersektionalität bedeutet für mich, dass sich der feministische Kampf umso mehr aufdrängt. Werde ich jedoch auch rassistisch oder aufgrund meiner Religion angegriffen, höre ich offensichtlich für viele Frauenrechtlerinnen auf, als Frau zu gelten. Der Satz Audre Lordes: »Ich bin nicht frei, solange eine andere Frau unfrei ist«, wird zu oft ohne seinen entscheidenden Zusatz zitiert, der lautet: »selbst wenn ihre Fesseln sehr unterschiedlich von meinen sind.«8
In ihrer Polemik White Feminism beschreibt die Journalistin Rafia Zakaria, wie sie in New York zu einer Gleichstellungskonferenz eingeladen worden war, bei der Ankunft jedoch feststellen musste, dass sie nicht wie die anderen, weißen Vortragenden auf der Bühne stehen, sondern hinter einem Tisch auf ihren Einsatz warten sollte. Dieser Tisch war voller Informationsmaterialien über Frauen in Nepal. Zakaria stammt aus Pakistan. Das liest sich womöglich wie ein extremes Beispiel. Aber genau das ist das Problem — die Erfahrung einer Frau wie Rafia Zakaria gilt nicht als eine generell feministische, eine, die für Grundsätze der Frauenbewegung stehen könnte. Für Deutschland führt die Journalistin Ciani-Sophia Hoeder in ihrem Buch Wut und Böse an, dass allzu eindeutig sei, worum sich hierzulande der feministische Kampf drehe: »Es geht bei Fragen der Arbeit von Frauen zum Beispiel praktisch nie um die prekäre Arbeit von Migrantinnen. Stattdessen spricht man über weiße Managerinnen. […] Es ging im deutschen Feminismus um das Nach-vorne-Bringen von weißen, wohlhabenden Frauen.«9
Für mich brauchte es die Existenz meiner Söhne, um zu erkennen, dass der Feminismus, wie ich ihn kennengelernt und verteidigt habe, nicht nur sehr wenig für sie übrighat, sondern letztlich auch Teile von mir ausgrenzt. Dass es natürlich um das klare Feindbild des weißen Mannes geht, welches auch ich in mir trage, dabei aber die feministische Sache nicht zwingend den Einzug von Gleichstellung per se verfolgt, sondern den Prototypen der ermächtigten, mächtigen weißen Frau.
Es ist kein schönes Gefühl, diese vorhergehenden Zeilen stehen zu lassen, sie bald gedruckt und unumkehrbar zu wissen. Aber, Schwestern, ich stürme mit offenen Armen auf euch zu. Ich möchte, dass wir es besser machen. Dass wir nicht mehr exotisieren. Und auch nicht mehr hierarchisieren und in Machtgefällen denken. Ist das sonst nicht das Patriarchat schlechthin: entlang einer Hackordnung Rechte zu vergeben? In einem System der Begrenzung zu denken, in dem dann um alles gekämpft werden muss, in dem der Kampf überhaupt die Möglichkeit der Existenz ist?
Trans-Aktivist:in Alok Vaid-Menon legt im Podcast »Man Enough« dar, wie es dazu kommen kann, dass Feministinnen die Trans-Bewegung anfeinden: dass der Schmerz, den wir alle empfinden, zwar denselben Ursprung hat, sich aber anders ausdrückt. Hinzu komme jedoch auch noch »unser Denken im Mangel, in der Verknappung. Dass, wenn ich dem Schmerz der anderen Raum gebe, meiner damit unsichtbar wird und nicht existiert.«10 Das größere Leid anderer wird zur Bedrohung, weil wir selbst in der Benachteiligung hierarchisieren. Und andersherum genauso. Einer Runde von Freunden und Freundinnen klagte ich mein Leid über einen älteren Kollegen, der ständig versuchte, mich zu chaperonen, also immer wieder aufs Neue Wege überlegte, wie er mich »unter seine Fittiche« nehmen und die »Dinge für mich regeln« könne, mir dabei aber ständig das Wort abschnitt, stets mit seiner sonoren Stimme, dem Auftritt im Dreiteiler und den ergrauten Schläfen gegenüber gemeinsamen Vorgesetzten als Erster zu sprechen begann, mir zwar die Türen aufhielt, dann aber hinter meinem Rücken bei Raucherpausen und ewigen Telefonaten »unter zweien« die Strippen zu ziehen versuchte. Ich war zwar neuerdings seine Chefin, er aber weigerte sich, mich als solche anzuerkennen, was er mir auch ins Gesicht sagte — »Ich bin ganz bestimmt nicht dein Mitarbeiter«, unser jährliches Mitarbeitergespräch schnitt er mit den Worten ab: »Das habe ich selbst fünfundzwanzig Jahre mit meinem Team gemacht. Ich kann dir ein ...
| Erscheint lt. Verlag | 19.2.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Alte weiße Männer • Antidiskriminierung • Antirassismus • arte • Care Arbeit • Chancengleichheit • Christina Clemm • Diskriminierungsfreie Erziehung • Erziehung • Feminismus • Frauenrechte • Gender • Genderstereotype • Gewalt • Gewaltfreie Erziehung • Gewalt gegen Frauen • Gleichberechtigung • Körperbild • Kübra Gümüsay • Macht • Männerrechte • Männlichkeit • Privilegien • Söhne • Teresa Bücker • toxische männlichkeit • Unterdrückung • Vorbilder • Vorurteile • Weiblichkeit • Woke Erziehung |
| ISBN-10 | 3-446-28028-6 / 3446280286 |
| ISBN-13 | 978-3-446-28028-1 / 9783446280281 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich