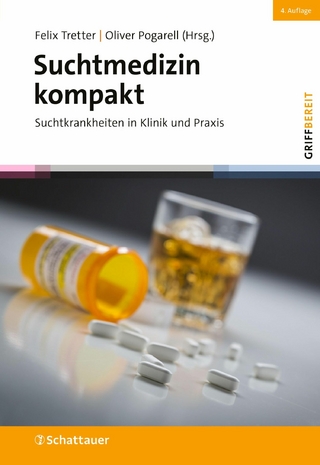Glücksspielstörung (eBook)
180 Seiten
Kohlhammer Verlag
978-3-17-034204-0 (ISBN)
Dr. Kai W. Müller, Dipl.-Psych., ist klinischer und wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dr. Klaus Wölfling, Dipl.-Psych., ist psychologischer Leiter der Ambulanz für Spielsucht der Universitätsmedizin Mainz.
Dr. Kai W. Müller, Dipl.-Psych., ist klinischer und wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dr. Klaus Wölfling, Dipl.-Psych., ist psychologischer Leiter der Ambulanz für Spielsucht der Universitätsmedizin Mainz.
1
Einleitung
Glücksspiele, frei definiert, versteht man darunter zumeist in Gesellschaft anderer Menschen stattfindende Freizeitaktivitäten, bei denen sich die Teilnehmenden miteinander oder mit einer dritten Partei in einem Spiel messen, das einen materiellen Einsatz erfordert und dessen Ausgang zu einem großen Teil vom Zufall bestimmt wird und wiederum die Aussicht auf einen materiellen Gewinn bietet.
Bereits 3.000 Jahre vor Christus waren Glücksspiele der Menschheit bekannt, dies zumindest lässt sich aus den Funden sechsseitiger Würfel in Teilen Chinas und Mesopotamiens schließen. Auch frühe Niederschriften, etwa aus der Indischen Hochkultur weisen bereits auf das Glücksspiel, bzw. dessen negative Seiten, hin, wenn da von Menschen zu lesen ist, die beim Spiel ihr gesamtes Hab und Gut eingebüßt haben. Entsprechend waren schon rund 500 Jahre vor Christus erste Bemühungen dessen, was wir heute als »Responsible Gambling« (verantwortungsbewusstes Spielen) bezeichnen, zu verzeichnen, als Themistokles für ein Spielverbot für Staatsbeamte plädierte. Auch der Römische Kaiser Justinian verbot im Römischen Reich etwa 500 nach Christus jedwede Teilnahme am Glücksspiel und die Folgejahrhunderte waren geprägt durch wechselnde Einstellungen innerhalb verschiedener Gesellschaftsschichten und abhängig vom jeweiligen Kulturkreis, schwankend zwischen moralischen Bedenken, gesellschaftlichem »Must-have«, harmlosem Freizeitvergnügen und gern gesehener staatlicher Einnahmequelle.
Der Überlieferung zu Folge wurde 1762 das Sandwich erfunden, als sich John Montagu, 4. Earl of Sandwich, nicht von einer stundenlangen Partie des Glücksspiels Cribbage lösen konnte, trotzdem Hunger verspürte und sich Fleisch zwischen zwei Brotscheiben servieren ließ, um es bequem während des Spiels verzehren zu können. Im 17. Jahrhundert wurde schließlich das Roulette populär, Lotterien hatte es zuvor schon gegeben und 1866 erschien Fjodor Dostojewskis »Der Spieler«. Zwei Jahre später schloss der Norddeutsche Bund alle Spielbanken, 1933 hoben dies die Nationalsozialisten wieder auf. Im Jahre 2008 trat der Glücksspielstaatsvertrag in Kraft und mit ihm mehr oder weniger klar geregelte oder durchsetzbare Bemühungen, das Spielverhalten der Bevölkerung, das gesamtgesellschaftlich nun irgendwo zwischen Vergnügen, Zwielicht und Glücksrittertum angesiedelt wird, in kontrollierte Bahnen zu lenken.
Als klinisch relevantes Phänomen wurde die Spielsucht übrigens erstmalig im Jahre 1561 in der Abhandlung »Über das Würfelspiel oder die Heilung der Leidenschaft, um Geld zu spielen« des Arztes und Philosophen Paquier Joostens thematisiert. Ein damals schon großer Titel für ein fraglos großes Phänomen, das ebenso fraglos noch größeres Leiden als die Leidenschaft selbst zu verursachen vermag.
Was die Heilung dieses Phänomens angeht, so stehen Medizin und Psychotherapie auch mehr als 400 Jahre später noch immer vor mehr Rätseln als dass sie klare Antworten hätten. Es scheint, als sei die Behandlung des pathologischen Glücksspiels an ihre Grenzen gestoßen, nachdem in den frühen 1980er Jahren, kurz nachdem das pathologische Glücksspiel erstmals als eigenständige Diagnose in das DSM-III aufgenommen worden war, die Forschung hierzu einen kleinen Boom erleben durfte. 40 Jahre später müssen wir festhalten, dass das, was damals beachtenswert und vielversprechend war, heute zwar noch immer gerne und oft therapeutische Anwendung findet, gleichzeitig aber dringend notwendige therapeutische Innnovationen zwar vielerorts schwer vermisst, aber nur selten umgesetzt werden.
In diesem Band möchten wir Interessierten von daher nicht nur einen aktuellen Überblick zu verschiedenen Aspekten jener Störung, die seit Veröffentlichung des DSM-5 den Namen »Glücksspielstörung« trägt, bieten, sondern insbesondere auch Denkanstöße für eine neue therapeutische Herangehensweise bei der Behandlung dieses Störungsbildes geben. Eine Heilung dessen, was Leiden schafft, sei an dieser Stelle nicht versprochen, wohl aber ein Fingerzeig zu einem innovativeren therapeutischen Umgang.
Fallbeispiel 1: Patientin, 32 Jahre, Glücksspielstörung in Bezug auf Geldspielautomaten
In einer Fachberatungsstelle mit einem Schwerpunkt auf Verhaltenssüchte stellt sich eine 32-jährige Angestellte vor. Die Mutter einer siebenjährigen Tochter berichtet, dass sie vor neun Jahren bereits eine stationäre Rehabilitation wegen einer Automatensucht absolviert habe. Damals habe sie mitten in ihrer Ausbildung zur Köchin gesteckt und sei nach der Arbeit mit anderen Auszubildenden des Restaurants in Spielotheken gegangen, um wenigstens nach Feierabend »noch etwas Spaß und Ablenkung« zu haben. Die Gruppe hätte das als harmloses Vergnügen erlebt, sie hätten nur um kleine Beträge gespielt und sich über die Wutausbrüche und die Versunkenheit anderer Gäste, die »stur vor ihren Automaten hockten« amüsiert.
Während einer der ersten Besuche habe die Patientin direkt Glück gehabt und den Betrag von 3.000 Euro erspielt, eine unverhoffte Aufbesserung ihres Auszubildendengehalts. Und nebenbei wären andere Gäste auf ihren Gewinn aufmerksam geworden, hätten anerkennende Kommentare gemacht und ihr ein »Naturtalent« bescheinigt. Sogar eine Cola sei ihr damals spendiert worden. So habe es langsam angefangen, dass die Patienten nicht mehr nur in Begleitung ihrer Gruppe, sondern immer häufiger auch alleine in die Spielothek gegangen sei. Sie habe bemerkt, dass sie immer ungeduldiger wurde, wenn Gewinne ausblieben, dass sie sehr wohl registriert habe, dass sie mehr Geld in den Automaten warf, als vernünftig war. Jeder neuerliche Geldverlust habe sie frustriert, gar in Panik versetzt. Sie habe sich schwindlig gefühlt, »den Kopf verloren« und wenn ihr Bargeld aufgebraucht gewesen sei, habe sie am Geldautomaten nebenan neues Geld abgehoben. Nach solchen Abenden habe sie sich am nächsten Morgen schuldig gefühlt, regelrecht elend und sich geschworen, nie mehr eine Spielothek zu betreten, zumindest nicht alleine. Doch ihre Gedanken seien schon während der Arbeitszeit immer häufiger in Richtung des Automaten abgeschweift, fast automatisch, beinahe ohne ihr Zutun. Sie habe sich an ihre Gewinne erinnert, an das wohlige Gefühl, das sie dann empfand, daran, wie schön es sei, mehr Geld als üblich zu haben, an die Bewunderung der Menschen um sie herum, an das Gefühl, sich wie eine Königin zu fühlen, wenn man mit dem Gewinn die Spielothek verließ. Dass sie schon lange nicht mehr mit einem Gewinn das Etablissement verlassen hatte, wurde ihr erst später bewusst. Wenn sie etwas gewann, erschien ihr dieser Gewinn nie genug, sondern eher als Einstieg, um »noch mehr rauszuholen«.
Nachdem sie sich wenige Monate später verliebt hatte, wurden die Besuche in der Spielothek zunächst seltener. Mit den ersten Konflikten in der noch jungen Partnerschaft bemerkte die Patientin jedoch zusehends, wie ihr das Spiel fehlte, wie gut sie vor dem Automaten »abschalten, allen Stress wegdrücken« konnte. Sie begann wieder, regelmäßig die Spielothek aufzusuchen, heimlich, sie wollte nicht, dass ihr Partner etwas davon erfuhr, sie wollte generell nicht, dass es jemand wusste. Ihr Partner wurde damals irgendwann misstrauisch, unterstellte ihr eine Affäre. Dies gab den Ausschlag. Die Patientin fühlte sich mit dem Rücken zur Wand und erzählte ihrem Partner alles. Als große Erleichterung erinnere sie dies. Da dieser selbst vor Jahren ein Alkoholproblem gehabt hatte, verstand er die Situation und unterstützte die Patientin bei ihrem Weg in die Behandlung. Die stationäre Rehabilitation in einer Fachklinik habe der Patientin damals immens geholfen.
Nach der Entlassung und der sich anschließenden ambulanten Nachsorge sei sie fast acht Jahre lang abstinent geblieben. Sie sei Mutter einer Tochter geworden und habe eine neue Ausbildung abgeschlossen. Vor zwei Jahren sei ihr Partner, mittlerweile ihr Verlobter und Vater der Tochter, rückfällig geworden, habe bereits morgens Alkohol getrunken und sei gewalttätig geworden. Die Patientin habe nicht gewusst, wie sie mit dieser Situation umgehen sollte. Sie sei verzweifelt gewesen, habe sich allein gelassen gefühlt und habe sich daran erinnert, wie gut ihr früher, manchmal zumindest, in belastenden Situationen das Spiel am Automaten getan habe.
Als sie nach Jahren erstmalig wieder eine Spielothek betrat, habe sie sich selbstsicher gefühlt, sicher, nicht wieder in die Sucht abzugleiten. Sie habe sich an einen der kleinen Bistrotische gesetzt und lediglich einen Kaffee getrunken, einzig die Atmosphäre habe sie in sich einsaugen wollen. Als sie beobachtete, wie ein...
| Erscheint lt. Verlag | 7.4.2020 |
|---|---|
| Mitarbeit |
Herausgeber (Serie): Oliver Bilke-Hentsch, Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, Michael Klein |
| Zusatzinfo | 6 Abb., 6 Tab. |
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Psychologie ► Sucht / Drogen |
| Medizin / Pharmazie | |
| Schlagworte | Diagnostik • Neurobiologie • Psychotherapie • Suchtbehandlung • Suchtprävention • Suchtstörung • Verhaltensstörung |
| ISBN-10 | 3-17-034204-5 / 3170342045 |
| ISBN-13 | 978-3-17-034204-0 / 9783170342040 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich