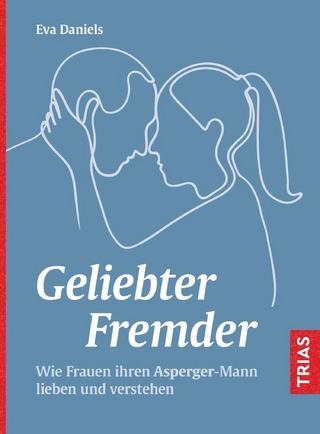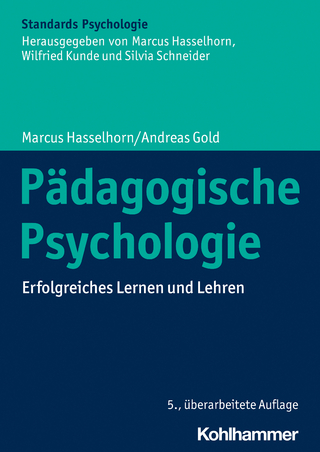Wie Gefühle entstehen (eBook)
672 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-01548-7 (ISBN)
Lisa Feldman Barrett (Jg. 1963), ist Professorin für Psychologie an der Northeastern University und lehrt darüberhinaus an der Harvard Medical School und am Massachusetts General Hospital in den Bereichen Psychiatrie und Radiologie. Gemeinsam mit dem Stanford-Professor und Psychologen James Gross gründete sie die Society for Affective Science, die sich der Förderung der Grundlagen- und angewandten Forschung zum Thema Emotionen und Affekt widmet. Darüberhinaus ist sie Mitbegründerin und Chefredakteurin der Zeitschrift Emotion Review. Lisa Feldman Barrett lebt in Boston.
Lisa Feldman Barrett (Jg. 1963), ist Professorin für Psychologie an der Northeastern University und lehrt darüberhinaus an der Harvard Medical School und am Massachusetts General Hospital in den Bereichen Psychiatrie und Radiologie. Gemeinsam mit dem Stanford-Professor und Psychologen James Gross gründete sie die Society for Affective Science, die sich der Förderung der Grundlagen- und angewandten Forschung zum Thema Emotionen und Affekt widmet. Darüberhinaus ist sie Mitbegründerin und Chefredakteurin der Zeitschrift Emotion Review. Lisa Feldman Barrett lebt in Boston. Elisabeth Liebl übersetzt aus dem Französischen, Englischen und Italienischen. U.a. übertrug sie Malala Yousafzai, Amaryllis Fox, Tiziano Terzani und Bob Woodward ins Deutsche.
Einführung: eine 2000 Jahre alte Hypothese[1]
Am 14. Dezember 2012 fand an der Sandy Hook Elementary School in Newton, Connecticut, der tödlichste Amoklauf an einer US-amerikanischen Schule statt. Ein einzelner Schütze tötete 26 Menschen, 20 von ihnen noch Kinder. Einige Wochen nach diesem schrecklichen Vorfall saß ich vor dem Fernseher, als Dannel Malloy, der Gouverneur von Connecticut, seine Rede zur Lage des Bundesstaates hielt. Während der ersten drei Minuten, als er den Menschen für ihr Engagement dankte, sprach er mit lauter, lebhafter Stimme. Dann brachte er die Rede auf die Tragödie in Newton:
Hinter uns allen liegt ein schwerer, dunkler Moment. Was in Newton geschah, ist nichts, was wir in Connecticuts schönen Städten je für möglich gehalten hätten. Und doch zeigte sich an diesem schwärzesten Tag in unserer Geschichte auch das Beste in uns. Lehrer und eine Schulpsychologin gaben ihr Leben, um die Schüler zu schützen.[2]
Bei diesen letzten Worten konnte man hören, wie die Stimme des Gouverneurs leicht zitterte, was vermutlich allen entging, die nicht aufmerksam zuhörten. Mich aber erschütterte dieses kaum merkliche Beben. Mein Magen zog sich zusammen, die Tränen flossen. Die Kamera schwenkte ins Publikum. Auch dort waren einige Zuschauer in Schluchzen ausgebrochen. Gouverneur Malloy hielt kurz inne und sah zu Boden.
Emotionen, wie ich und der Gouverneur sie zeigten, scheint etwas Urtümliches auszuzeichnen: ein uns angeborenes Verhalten, das sich reflexhaft einstellt und auf andere Menschen übergreift. Wird eine emotionale Reaktion ausgelöst, läuft sie vermutlich bei allen mehr oder weniger auf die gleiche Weise ab. Ich litt ebenso wie der Gouverneur oder die Menschen, die ihm zuhörten.
Auf diese Weise betrachtet die Menschheit Trauer und andere Gefühle seit 2000 Jahren. Andererseits: Wenn die Menschheit in den Jahrhunderten wissenschaftlicher Entdeckungen eines gelernt hat, dann, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen.
Die althergebrachte Geschichte der Emotionen besagt: Wir alle haben Gefühle, die uns vom ersten Atemzug an begleiten. Es handelt sich dabei um klar abgegrenzte innere Phänomene, die unserer Erkenntnis zugänglich sind. Sobald etwas in der Außenwelt passiert, ob nun ein Schuss fällt oder flirtende Blicke ausgetauscht werden, so melden sich auch schon unsere Emotionen schnell und automatisch, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Und unser Gesichtsausdruck spiegelt diese Gefühle mit einem Lächeln, Stirnrunzeln, finsteren Blicken und anderen, klar dekodierbaren Zeichen. Unsere Stimme lässt unsere Gefühlslage erkennen, wenn wir lachen, schreien oder weinen. Unsere Körperhaltung verrät unsere Emotionen mit jeder Geste, jeder hängenden Schulter.
Auch die moderne Wissenschaft erzählt eine Geschichte, die zu dieser Sicht der Dinge passt. Ich nenne sie die klassische Auffassung der Emotionen. Die Geschichte besagt Folgendes: Das leise Zittern in Gouverneur Malloys Stimme löste, beginnend in meinem Gehirn, eine Kettenreaktion aus. Eine Reihe von Neuronen – nennen wir das Ganze der Einfachheit halber den «Trauer-Schaltkreis» – wurde aktiv und bewirkte, dass sich mein Gesicht und mein Körper auf eine bestimmte, spezifische Weise verhielten. Meine Stirn runzelte sich, ich kniff die Brauen zusammen, meine Schultern sackten zusammen, ich fing an zu weinen. Dieser angebliche Schaltkreis löste noch weitere körperliche Reaktionen aus: Meine Herz- und Atemfrequenz beschleunigten sich. Meine Schweißdrüsen traten in Aktion. Meine Blutgefäße zogen sich zusammen.[3] Die Gesamtheit dieser Bewegungen in und an meinem Körper ist, so wird angenommen, ein «Fingerabdruck», der für die Trauer einzigartig ist. So wie Ihr Fingerabdruck etwas Einmaliges ist.
Die klassische Auffassung von den Emotionen geht davon aus, dass wir viele solcher Emotions-Schaltkreise im Gehirn haben. Jeder dieser Schaltkreise soll eine ganz bestimmte Art von Veränderung verursachen, seinen typischen Fingerabdruck. Ein nerviger Kollege also triggert Ihre «Wutneuronen»: Ihr Blutdruck steigt. Sie schauen finster, brüllen, und Ihnen wird heiß. Eine beunruhigende Geschichte in den Nachrichten aktiviert die «Angstneuronen»: Ihr Herz fängt an zu rasen, Sie erstarren, und Panik überkommt Sie. Da wir Wut, Glück, Überraschung und andere Gefühle als eindeutig benennbare Zustände wahrnehmen, scheint es nur vernünftig anzunehmen, dass jeder Emotion ein ebenso klar definiertes Aktivitätsmuster in Gehirn und Körper entspricht.
Die klassische Auffassung betrachtet unsere Emotionen als Artefakte der Evolution, die vor langer Zeit dazu beigetragen haben zu überleben und nun ein festes Element unserer biologischen Natur geworden sind. Insofern sind Emotionen universell: Menschen jeden Alters, jeder Kultur und in jedem Teil der Welt erleben Trauer mehr oder weniger so, wie Sie das tun – und mehr oder weniger so, wie es unsere hominiden Verwandten taten, als sie vor einer Million Jahre die afrikanische Steppe durchwanderten. Ich sage «mehr oder weniger», weil niemand ernsthaft annimmt, dass sich Gesichter, Körper und Gehirne exakt gleich verhalten, wenn ein Mensch traurig ist. Auch Ihre Herz- und Atemfrequenz, Ihr Blutdruck reagieren nicht jedes Mal gleich. Vielleicht runzelt sich Ihre Braue ja mehr oder weniger stark, abhängig von Zufall oder Gewohnheit.[4]
Emotionen sollen also eine Art brachialer Reflex sein, der häufig im Gegensatz zu unseren rationalen Überlegungen steht. Der primitive Teil Ihres Gehirns möchte Ihrem Boss entgegenschleudern, dass er ein Volltrottel ist, aber Ihre überlegte Seite weiß, dass Sie dann vermutlich gefeuert werden, also halten Sie sich zurück. Dieser innere Kampf zwischen Emotion und Vernunft, der angeblich unser Menschsein ausmacht, ist eines der großen Narrative der westlichen Zivilisation. Ohne die Ratio wären Sie nur ein emotionales Tier.
Diese Sicht der Dinge hat sich in verschiedener Form über Jahrtausende gehalten. Platon glaubte eine Version, ebenso wie Hippokrates, Aristoteles, Buddha, René Descartes, Sigmund Freud und Charles Darwin. Auch heute beschreiben berühmte Denker wie Steven Pinker, Paul Ekman und der Dalai Lama Gefühle auf der Grundlage dieser klassischen Sicht. Wir finden sie in nahezu jeder Einführung in die Psychologie wieder, die Studierende an der Uni lesen, sowie in den meisten Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln über Emotionen. In jedem Klassenzimmer an Amerikas Grundschulen hängen Poster, die die universelle emotionale Sprache des Gesichts darstellen: Lächeln, Zornesfalte und Schmollmund. Facebook hat mehrere Emoticons designen lassen, die sich auf Darwins Schriften stützen.[5]
Die klassische Auffassung der Emotionen durchzieht auch unsere gesamte Kultur. Fernsehserien wie Lie to Me und Daredevil beruhen auf der Annahme, dass sich unsere innersten Gefühle auf unsere Herzfrequenz und unseren Gesichtsausdruck niederschlagen. Die Sesamstraße oder der Pixar-Film Alles steht Kopf lehren Kinder, dass Emotionen eindeutig zu identifizierende innere Ereignisse sind, die sich in Gesicht und Körper widerspiegeln. Firmen wie Affective bieten Unternehmen ihre Dienste an, um per «Emotionsanalyse» ihren Kunden emotional auf die Spur zu kommen. In der National Basketball Association (NBA) setzen beispielsweise die Milwaukee Bucks darauf, die «psychische, charakterliche und persönliche Verfassung» eines Spielers sowie die «Teamchemie» offenzulegen, indem man den Gesichtsausdruck der Betreffenden analysiert.[6] Selbst die Ausbildung von FBI-Agenten basiert auf dieser klassischen Sicht der Gefühle.[7]
Diese Auffassung prägt ebenso unsere sozialen Institutionen. Das amerikanische Rechtssystem geht davon aus, dass Gefühle ein Teil unserer animalischen Natur sind, der uns unvernünftige und mitunter gewaltsame Handlungen begehen lässt, wenn wir ihn nicht mit unseren rationalen Gedanken unter Kontrolle halten. Die medizinische Forschung untersucht die gesundheitlichen Auswirkungen von Wut in der Annahme, es gebe ein einziges Reaktionsmuster im Körper, auf das diese Bezeichnung zutrifft. Menschen mit den mentalen Störungen – vor allem Kinder und Erwachsene, bei denen eine Störung des Autismus-Spektrums festgestellt wurde – lernen, anhand der Gesichtskonfiguration Emotionen zu identifizieren. Das soll ihnen helfen, mit anderen Menschen zu kommunizieren und Bindungen zu ihnen aufzubauen.
Und doch … trotz des ehrwürdigen intellektuellen Stammbaums der klassischen Auffassung von Emotionen und trotz ihres gewaltigen Einflusses auf unsere Kultur und Gesellschaft gibt es massenhaft wissenschaftliche Belege dafür, dass diese Sicht der Dinge nicht stimmen kann. Selbst nach gut einem Jahrhundert konnte die Forschung nicht einen einzigen einmaligen Fingerabdruck für auch nur eine Emotion identifizieren. Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihren Probanden Elektroden ins Gesicht kleben, um zu messen, wie Gefühle den Tonus der Gesichtsmuskulatur verändern, dann stoßen sie auf Variation und Vielfalt, nicht auf Einheitlichkeit. Die gleiche Vielfalt – also das Fehlen eines einmaligen Fingerabdrucks – zeigt sich bei der Messung der Zusammenhänge zwischen Gehirn und Körper. Sie können wütend sein, ohne dass Ihr Blutdruck steigt. Sie können Angst haben, ohne dass die Amygdala beteiligt ist, die man historisch als Sitz der Angst im Gehirn betrachtet.
Sicherlich...
| Erscheint lt. Verlag | 13.6.2023 |
|---|---|
| Übersetzer | Elisabeth Liebl |
| Zusatzinfo | Mit Abbildungen |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Psychologie |
| Schlagworte | Affekt • Angst • Basisemotionen • Disziplin • Emotionen • Gefühle • Gehirn • Hirnforschung • Leon Windscheid • Liebe • Menschenverstand • Neuroscience • Neurowissenschaften • Psychologie der Emotionen • Ryan Holiday • Scham • Sozialpsychologie • Verhaltensbiologie • Verhaltensforschung • Verstand • Wut |
| ISBN-10 | 3-644-01548-1 / 3644015481 |
| ISBN-13 | 978-3-644-01548-7 / 9783644015487 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 10,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich