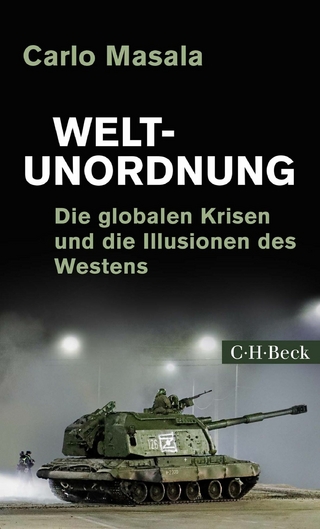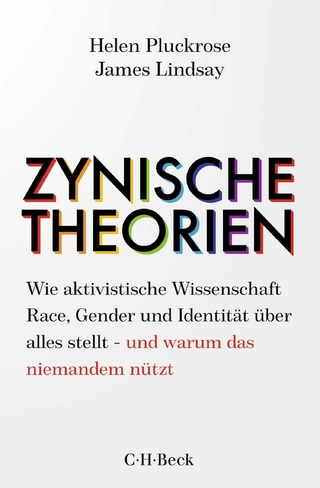Die neue Schule der Demokratie (eBook)
176 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-491932-4 (ISBN)
Marina Weisband, geboren 1987 in der Ukraine, ist Diplom-Psychologin. Von einer unpolitischen Schülerin ist sie zu einer politisch engagierten Studentin geworden. Sie weiß daher, wie wichtig es ist, jungen Menschen politische Partizipation nahezubringen und zu ermöglichen. Sie war politische Geschäftsführerin der Piratenpartei und engagiert sich mittlerweile bei den Grünen in den Bereichen Digitalisierung und Bildung. Seit 2014 leitet sie hauptberuflich das Schülerbeteiligungsprojekt aula. Sie lebt mit ihrer Familie in Münster.
Marina Weisband, geboren 1987 in der Ukraine, ist Diplom-Psychologin. Von einer unpolitischen Schülerin ist sie zu einer politisch engagierten Studentin geworden. Sie weiß daher, wie wichtig es ist, jungen Menschen politische Partizipation nahezubringen und zu ermöglichen. Sie war politische Geschäftsführerin der Piratenpartei und engagiert sich mittlerweile bei den Grünen in den Bereichen Digitalisierung und Bildung. Seit 2014 leitet sie hauptberuflich das Schülerbeteiligungsprojekt aula. Sie lebt mit ihrer Familie in Münster.
Bedenken, die ausgeräumt werden können
Ob die Lehrer, Schüler oder Eltern die Initiatoren sind – wer einer Schule vorschlägt, aula einzuführen, muss mit Gegenwind rechnen. Ich sehe das erst mal positiv, denn offenbar gibt es klare Vorstellungen, was dem Schulzweck dient und was nicht. Allerdings sind die Vorbehalte der Lehrkräfte oft ein wenig reflexhaft und dem Status quo verhaftet. Veränderungen werden schnell für allgemein unmöglich gehalten, »weil es halt so ist«. Gehen wir ins Detail, lassen sich drei Gruppen von Bedenken unterscheiden: die Ressourcenfrage, die Digitalisierungsskepsis und Angst vor Kontrollverlust.
»Noch ein Projekt – wie soll das gehen?!« Ich kann nachvollziehen, dass viele Lehrer keine Lust darauf haben, sich eine weitere Verpflichtung aufzuhalsen. Sie sind überfrachtet mit Aufgaben aller Art und bekommen von allen Seiten Druck, um die Kinder möglichst geradlinig zum erfolgreichen Abschluss einer Klasse oder einer Schullaufbahn zu bringen. Das Konzept aula sieht nach einer zusätzlichen Belastung aus, die nicht in den Plan passt. Viele Lehrer glauben, weder über die zeitliche noch die mentale Kapazität zu verfügen, um sich damit zu beschäftigen. Ich erkenne die Berechtigung dieser Einwände ganz und gar an. Unsere Lehrer haben einfach zu viel zu tun, und zwar auch mit Aufgaben, für die sie nicht ausgebildet sind. Dieser Einwand betrifft nicht nur aula, sondern die Struktur der Schule insgesamt und ist nur politisch zu lösen: Wir brauchen mehr Personal an Schulen und zwar nicht nur Lehrkräfte. Wir brauchen mehr Sozialarbeiter, mehr Psychologen, mehr Menschen, die Ansprechpartner für Kinder sind, die mit ihren Sorgen, mit ihrem Gesprächsbedarf nicht wissen wohin. Nicht einmal die engagiertesten Lehrkräfte können sich um die vielfältigen Anliegen kümmern, mit denen die Kinder zu ihnen kommen. Die Rolle der Schule hat sich verändert, sie muss vieles leisten, was früher in Elternhäusern ganz selbstverständlich vermittelt wurde. Die Schülerschaft ist weniger homogen, in Bezug auf die geographische und sprachliche Herkunft, auf die sozialen Verhältnisse und alles, was damit zusammenhängt. Der Aufmerksamkeitsbedarf jedes Kindes ist hoch. Also ja, die Lehrer haben ein Ressourcenproblem.
Dennoch muss aula keine zusätzliche Belastung sein. Wir haben das Projekt absichtlich äußerst ressourcenschonend angelegt, und es müssen sich auch nicht alle Lehrkräfte einer Schule intensiv damit befassen. Wenn zwei bis drei Lehrer sich engagieren, reicht das schon aus, auch wenn es natürlich schöner wäre, wenn mehr mitmachen würden. Außerdem kann aula arbeitserleichternd für Lehrer wirken. Weil die Klassengemeinschaft stärker wird, weil sie mehr Selbständigkeit in der Regelung ihrer Angelegenheiten entwickelt und weil sich die Stärkung der demokratischen Diskursfähigkeiten positiv auf das gesamte Klassen- und Schulleben auswirkt.
»Sollen die Kinder wirklich noch mehr daddeln, als sie es eh schon tun?« Die zweite Gruppe der Bedenken ist eine tiefsitzende Digitalisierungsskepsis. Auch das kann ich verstehen. Kinder und Jugendliche verbringen unfassbar viel Zeit mit ihren elektronischen Geräten. Aber, und das ist ein ganz großes Aber: Sollen wir sie lieber ungeschützt den rein kommerziellen Interessen der Internetgiganten, der Manipulation und dem Mobbing überlassen? Das Smartphone ist das moderne Schlachtfeld des Kapitalismus. Alles darin buhlt um die Aufmerksamkeit des Jugendlichen, der als Produkt gesehen wird. Seine Aufmerksamkeit ist ein Produkt, das an Werbetreibende verkauft wird. Wollen wir Kinder und Jugendliche wirklich damit allein lassen? Was ist, wenn sie, rein hypothetisch, Eltern haben, die sich auf diesem Gebiet nicht auskennen und ihre Kinder einfach machen lassen? Wollen wir wirklich, dass Jugendliche damit aufwachsen, sich nur durch Timelines zu scrollen, um möglichst schnell das nächste bunte bewegte Objekt anzuschauen? Oder wollen wir, dass Jugendliche das Smartphone als eine der mächtigsten, wenn nicht die mächtigste Erfindung der Menschheit betrachten und als Werkzeug für ihre eigenen Ziele erkennen, sich also gar nicht als Konsument begreifen, sondern als Gestalter ihrer Welt?
Gerade Pädagogen könnten den Kindern und Jugendlichen doch sehr gut beibringen, sinnvoll und konstruktiv mit digitalen Medien umzugehen. Außerdem gehört aula zu den wenigen Projekten, die eine inhaltliche Verbindung zwischen digitaler und analoger Welt herstellen. Das Digitale an aula ist nicht Selbstzweck, sondern ein Mittel für einen anderen Zweck, nämlich den der Beteiligung. aula ist die Demonstration dafür, dass digitale Plattformen gut geeignet sind, um eigene Ziele zu erreichen, um selbst etwas zu erstellen und mit anderen zusammen zu tun. Diese Plattform ist extra dafür gestaltet. Sie gibt einem nichts vor, sie hat auch keinerlei Gamification-Elemente. Natürlich mit Absicht. Denn ich möchte, dass die Lust an der Demokratie aus der Selbstwirksamkeit entsteht. Nicht aufgrund einer externen Belohnung.
»Aber wenn die etwas beschließen, was wir nicht wollen …« Das ist die Angst vor Kontroll- und Autoritätsverlust. Sie ist unbegründet. In meiner gesamten Zeit mit aula habe ich noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass eine Situation entgleist wäre, geschweige denn dauerhaft untragbare Zustände geschaffen hätte.
Ein Beispiel dazu: Eine Schule beschloss über aula, dass die Lehrkräfte ausprobieren sollten, einen Tag lang den Unterricht ausschließlich mit dem Smartphone zu gestalten. Eine Katastrophe? Ganz und gar nicht. Nach dem ersten Schrecken wurden die Lehrer aktiv, erkundigten sich an anderen Schulen nach dortigen Erfahrungen, unterstützten Kollegen und ließen sich von den Schülern helfen, das Smartphone konstruktiv und nicht nur als erweitertes Telefon zu nutzen. Beide Seiten profitierten voneinander. Außer fachlichem Wissen wurden auch Skills für die Quellensuche, für die Erarbeitung neuer Techniken und für das kooperative Lernen vermittelt. Besser geht’s eigentlich nicht. Das fand die Schule auch, deshalb wurde aus der einmaligen Aktion eine regelmäßige Einrichtung. Einmal im Monat ist Smartphone-Tag.
Kinder und Jugendliche sind vernünftiger, als mancher meint, und sie sind im Übrigen auch oft strenger, wenn es um die Einhaltung von Regeln geht. Von Regeln, die sie sich selbst gegeben haben. Außerdem: Wenn wir Schüler auf Berufe vorbereiten sollen, die es heute noch gar nicht gibt, dann besteht Autorität nicht in der Vermittlung von Wissen, sondern in der Vermittlung der Fähigkeiten, mit Nichtwissen umzugehen.
Die Angst der Lehrkräfte vor Kontrollverlust ist schwer zu beheben. Sie sitzt tief und speist sich aus verschiedenen Quellen. Wenn wir an einer Schule aula einführen, drehen sich viele der Vorgespräche genau um diese Angst. Ich spreche mit den Lehrkräften ausdauernd darüber, welchen Begriff von Autorität sie haben, woraus sie sie beziehen und wofür sie glauben, Kontrolle zu benötigen. Es ist eine intensive, sehr persönliche Arbeit. Aber sie muss unbedingt geleistet werden, denn Menschen, die unter dem Druck stehen, Kontrolle über alle Schüler haben zu müssen, können kaum mündige Bürgerinnen und Bürger heranbilden. Das ist ja ein Widerspruch in sich.
Ich verurteile die Lehrkräfte nicht. Ich gehe davon aus, dass es entweder Menschen sind, die sich in hohem Maße dafür verantwortlich fühlen, die Kinder zu diesem oder jenem Abschluss zu bringen. Oder es sind Menschen, die selbst so unsicher sind, dass sie einen Raum fürchten, in dem nicht die von ihnen bestimmten Regeln gelten. Wir haben es bei Lehrern ganz oft mit dieser Unsicherheit zu tun. Auch das verurteile ich nicht. Ich habe ein positives Menschenbild, deshalb glaube ich, dass ihre Unsicherheit nicht einfach in ein Beharren auf Macht mündet, sondern in die Sorge, dass sie ihren Unterricht nicht durchführen können, wenn unerwartetes Chaos entsteht. Vielleicht steht dahinter eine Vorstellung von Schülern als potenziell chaotische Masse, in die Ordnung gebracht werden muss, bevor der Unterricht beginnen kann. Ich möchte in diesen Gesprächen herausfinden, welche psychische Funktion das Beharren auf Kontrolle erfüllt und ob es Alternativen dafür gibt. Das heißt, mit anderen Worten, wie diese Lehrer sonst mit ihrer Unsicherheit umgehen können.
Meiner Erfahrung nach gibt es nur sehr selten Bereiche, in denen die Lehrer darauf vertrauen können, dass diese Unsicherheit durch Gleichgesinnte aufgefangen wird. Lehrer sprechen im Lehrerzimmer eher selten über Persönliches miteinander. Sie haben kaum Zeit, sie rennen rein und hetzen gleich wieder raus. Dass an einer Schule wirklicher menschlicher Austausch passiert, erfahre ich nicht oft. Nichts fängt Lehrer auf. Wenn sie viel Glück haben, haben sie im privaten Umfeld vertraute Menschen, bei denen sie belastende Dinge loswerden können. Aber was, wenn nicht? Dann tragen sie diese Unsicherheiten mit sich herum. Sie haben viele junge, formbare Menschen vor sich, über deren leibliches, seelisches und akademisches Wohl sie irgendwie wachen müssen. Das ist eine große Verantwortung, die manchen mehr belastet, als er gut aushalten kann. Gerade für diese Lehrer wäre es ein Gewinn, wenn sie sich auf aula einließen. Weil sie sähen, was in den Schülern steckt und wie sich Verantwortung auf viele Schultern verteilen lässt.
Der...
| Erscheint lt. Verlag | 24.4.2024 |
|---|---|
| Co-Autor | Doris Mendlewitsch |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Aula • Beteiligungspädagogik • Bildung • Bildungspolitik • Demokratieförderung • demokratie in gefahr • Digitalisierung • Eigenverantwortung • Erlernte Hilflosigkeit • Extremismus • Gymnasium • Partizipation • Populismus • Rollenspiel • Selbstwirksamkeit |
| ISBN-10 | 3-10-491932-1 / 3104919321 |
| ISBN-13 | 978-3-10-491932-4 / 9783104919324 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich