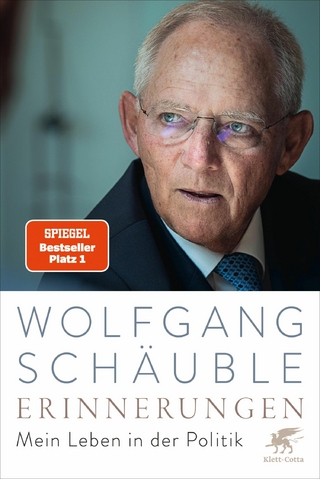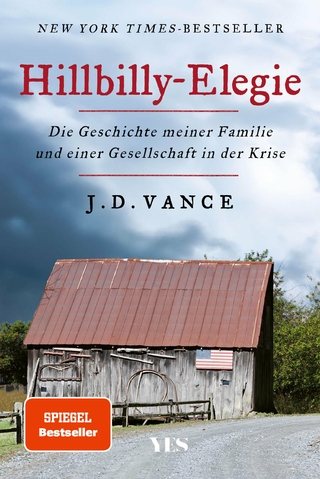Code kaputt (eBook)
320 Seiten
Verlagsgruppe Droemer Knaur
978-3-426-45392-6 (ISBN)
Anna Wiener ist Journalistin und schreibt für den New Yorker, The Atlantic und Wired über das Silicon Valley, Start-Up-Kultur und die digitale Welt. Sie lebt und arbeitet in San Francisco, Code kaputt ist ihr erstes Buch und sorgt seit Erscheinen in den USA und Großbritannien für Furore.
Anna Wiener ist Journalistin und schreibt für den New Yorker, The Atlantic und Wired über das Silicon Valley, Start-Up-Kultur und die digitale Welt. Sie lebt und arbeitet in San Francisco, Code kaputt ist ihr erstes Buch und sorgt seit Erscheinen in den USA und Großbritannien für Furore.
Anreize
Je nachdem, wen man fragte, war es der Höhepunkt, der Wendepunkt oder der Anfang vom Ende der Start-up-Szene im Silicon Valley, die von Zynikern als Blase, von Optimisten als die Zukunft und von meinen zukünftigen Kollegen (atemlos und high von so viel geschichtsträchtigem Potenzial) als »das Ökosystem« bezeichnet wurde. Ein soziales Netzwerk, das angeblich alle hassten, von dem aber trotzdem niemand lassen konnte, ging für hundertnochwas Milliarden Dollar an die Börse; der feixende Gründer läutete per Videochat die Eröffnungsrunde ein – und sprach damit das Todesurteil für bezahlbare Mieten in San Francisco. Zweihundert Millionen Menschen meldeten sich bei einer Microblogging-Plattform an, um virtuell in der Nähe von Promis und anderen wildfremden Menschen zu sein, die sie im echten Leben nicht ausstehen könnten. Künstliche Intelligenz und Virtual Reality kamen wieder in Mode. Selbstfahrende Autos galten als unvermeidbar. Alles wurde mobil, alles ging in die Cloud. Dabei war die Cloud ein unsichtbares Rechenzentrum irgendwo in Texas oder Cork oder Bayern, aber das störte niemanden. Man vertraute ihr trotzdem.
Es war ein Jahr der Aufbruchstimmung, eines neuen Optimismus, der besagte, dass es keine Hürden, keine Grenzen und keine schlechten Ideen gab. Ein Optimismus von Chancen, Macht und Kapital. Wohin das Geld auch floss, geschäftstüchtige Entwickler und MBAs mussten ihm folgen. Das Wort »Disruption« breitete sich aus, und alles war entweder reif dafür oder davon bedroht: Notenblätter und Smoking-Verleihe, Hochzeitsplanung und Kreditlimits, Hausmannskost und Häuserkauf, Bankgeschäfte und Rasur, Textilreinigung und die Kalendermethode zur Empfängnisverhütung. Eine Website, über die man seine ungenutzte Garageneinfahrt vermieten konnte, sammelte von führenden Risikokapitalunternehmen an der Sand Hill Road vier Millionen Dollar ein. Eine Website, die das Marktsegment der Tierbetreuung ins Visier nahm – eine Gassi-geh- und Haustier-Sitting-App mit disruptiven Auswirkungen auf Zwölfjährige in Vorstadtwohngebieten –, kam auf fünfzig Millionen. Mit einer Coupon-App konnten unzählige gelangweilte und neugierige Großstädter nun Dienstleistungen kaufen, von denen sie bisher keine Ahnung gehabt hatten, dass sie sie überhaupt brauchten. Und so jagten sich die Leute eine Zeit lang Antifaltengifte unter die Haut, nahmen Trapez-Unterricht und gingen zum Analbleaching, einfach nur, weil es darauf Rabatt gab.
Es begann die Ära der Einhörner: Start-ups, deren Marktwert von ihren Investoren auf über eine Milliarde Dollar geschätzt wurde. Ein prominenter Risikokapitalgeber stellte im Leitartikel einer internationalen Wirtschaftszeitung die Behauptung auf, Software fräße die Welt – ein Ausspruch, der daraufhin in zahllosen Marketingpräsentationen, Pressemeldungen und Stellenanzeigen aufgegriffen wurde, als würde er irgendetwas beweisen und wäre nicht nur eine unbeholfene, unpoetische Metapher.
Außerhalb des Silicon Valley weigerte man sich im Allgemeinen, die ganze Sache allzu ernst zu nehmen. Es herrschte das Gefühl, auch diese Blase würde, ganz wie ihre Vorgänger, irgendwann wieder vergehen. In der Zwischenzeit wuchs die Branche über eine Gruppe von Futuristen und Hardwaretüftlern hinaus – und hinein in ihre neue Rolle als Grundgerüst unseres Alltags.
Nicht dass ich irgendetwas davon bewusst wahrgenommen, geschweige denn beachtet hätte. Ich hatte nicht mal Apps auf meinem Handy. Gerade fünfundzwanzig geworden, lebte ich mit einem Mitbewohner, den ich kaum kannte, am Rande von Brooklyn, und unsere Wohnung war mit so vielen Secondhand-Möbeln vollgestopft, dass sie fast schon etwas Historisches hatte. Ich führte ein unsicheres, aber angenehmes Leben: mit einer Assistentenstelle bei einer kleinen Literaturagentur in Manhattan, ein paar lieb gewonnenen Freundinnen und Freunden, mit denen ich an meiner Sozialphobie arbeitete – meistens, indem ich ihnen aus dem Weg ging.
Doch langsam zogen dunkle Wolken am Horizont auf, es drohte ungemütlich zu werden. Jeden Tag spielte ich mit dem Gedanken, mich für ein Aufbaustudium zu bewerben. Im Job war ich festgefahren, er bot keinerlei Aufstiegschancen, und nach drei Jahren hatte sich auch der voyeuristische Reiz dessen abgenutzt, für jemand anderen ans Telefon zu gehen. Ich mochte mich nicht mehr mit den Einsendungen vom Schmonzettenstapeln amüsieren oder Autorenverträge und Tantiemenabrechnungen an Orten archivieren, wo sie nicht hingehörten (zum Beispiel in meiner Schreibtischschublade). Mein Nebenjob als freiberufliche Lektorin und Korrektorin für einen Kleinverlag schwand ebenfalls dahin, nachdem ich mich kürzlich von dem Lektor getrennt hatte, der mir die Aufträge zuteilte. Es war eine angespannte und belastende Beziehung gewesen, darin aber zuverlässig: Der einige Jahre ältere Lektor hatte vom Heiraten gesprochen, wollte aber das Fremdgehen nicht lassen. Seine Untreue flog auf, als er sich übers Wochenende meinen Laptop auslieh und ihn zurückgab, ohne sich vorher aus seinen Accounts ausgeloggt zu haben. So bekam ich eine ganze Reihe tiefgründiger romantischer PNs mit einer kurvenreichen Folksängerin zu lesen, ausgetauscht über das soziale Netzwerk, das alle hassten. In diesem Jahr hasste ich es ganz besonders.
Vom Silicon Valley hatte ich keine Ahnung und konnte damit gut leben. Ich war nicht unbedingt eine Ludditin – eine Maus hatte ich bedienen können, bevor ich lesen lernte, aber mit der geschäftlichen Seite des Ganzen war ich nie in Berührung gekommen. Wie jeder Mensch mit einem Schreibtischjob starrte ich den Großteil meiner Zeit auf einen Computerbildschirm und tippte und tabbte mich durch den Tag, der Browser verlief als Strom digitaler Abschweifungen im Hintergrund meiner Arbeit. Meine Freizeit verschwendete ich damit, durch die Fotos und wirren Überlegungen von Menschen zu scrollen, die ich längst hätte vergessen haben sollen, und endlose tiefgründige E-Mails mit Freunden auszutauschen, in denen wir uns gegenseitig dilettantische Ratschläge fürs Berufs- und Privatleben gaben. Ich las die Onlinearchive längst eingestellter Literaturzeitschriften, sah mir in den digitalen Schaufenstern Kleidung an, die ich mir nicht leisten konnte, und ent- und verwarf ambitionierte private Blogs mit Titeln wie A Meaningful Life – in der vergeblichen Hoffnung, meinem eigenen Leben dadurch etwas Sinn und Bedeutung zu verleihen. Aber nie wäre mir in den Sinn gekommen, dass ich eines Tages zu den Menschen hinter den Kulissen des Internets gehören könnte, weil mir nie in den Sinn kam, dass überhaupt Menschen dahinter arbeiteten.
Wie es sich in jener Zeit für Mittzwanziger in North Brooklyn gehörte, wo eine Schokoladenmanufaktur als lokale Sehenswürdigkeit galt und sich die Leute ganz im Ernst über urban homesteading unterhielten, war mein Leben auf eine künstliche Art analog. Ich fotografierte mit einer alten Mittelformatkamera, die meinem Opa gehört hatte, scannte diese Bilder in einen Uralt-Laptop mit laut sirrendem Lüfter und lud sie in meine Blogs hoch. Ich hockte auf kaputten Verstärkern und kalten Heizkörpern in Proberäumen in Bushwick und blätterte in alten Hochglanzmagazinen, während meine jeweiligen Idole an selbst gedrehten Zigaretten sogen, Drumsticks wirbelten oder auf ihren Gitarren slideten, und hörte ihnen aufmerksam zu, um vorbereitet zu sein, wenn ich nach meiner Meinung gefragt wurde – was nie geschah. Ich ging mit Männern aus, die Chapbooks oder Massivholzmöbel mit Baumkante produzierten. Einer stellte sich als experimenteller Bäcker vor. Auf meiner To-do-Liste standen so archaische Aufgaben wie der Kauf einer neuen Nadel für den Plattenspieler, den ich fast nie benutzte, oder einer neuen Batterie für die Uhr, die ich immer aufzuziehen vergaß. Ich weigerte mich standhaft, mir eine Mikrowelle zuzulegen.
Wenn ich der Tech-Branche überhaupt eine Relevanz für mein eigenes Leben zugestand, dann nur hinsichtlich der Ängste, die in meinem beruflichen Umfeld kursierten. Ein Onlinekaufhaus, das in den Neunzigern angefangen hatte, Bücher übers Internet zu verkaufen – nicht etwa aus Liebe zur Literatur, sondern aus Liebe zum Kunden und zum effektiv organisierten Konsum –, hatte sich zu einem digitalen Schnäppchenmarkt ausgewachsen, auf dem Haushaltsgeräte, Elektronik, Lebensmittel, Massenmode, Spielwaren, Essbesteck und allerlei Unnützes made in China verkauft wurde. Nachdem das Onlinekaufhaus den gesamten Einzelhandel erobert hatte, besann es sich wieder auf seine Wurzeln und probierte offenbar verschiedene Wege aus, die Verlagsbranche in den Ruin zu treiben. Das ging so weit, dass das Kaufhaus eigene Verlags-Imprints gründete, was meine Freundinnen im Literaturbetrieb voller Verachtung als billig und unverschämt verhöhnten. Dass wir auch viele Gründe hatten, der Website dankbar zu sein, ignorierten wir – aber der Selfpublisher-Marktplatz dieses Onlinekaufhauses war schließlich der Brutkasten für die Bestsellerromane über Sadomaso-Praktiken und pimpernde Vampire, die die Verlagsbranche am Laufen hielten. Innerhalb weniger Jahre sollte der Gründer, ein schildkrötenähnlicher ehemaliger Hedgefonds-Manager, zum reichsten Mann der Welt werden und ein filmreifes Makeover durchlaufen, damals jedoch verschwendeten wir keinen Gedanken an ihn. Für uns zählte nur, dass die Hälfte aller Buchverkäufe auf das Konto jener Website ging, was wiederum bedeutete, dass sie die Kontrolle über die wichtigsten Hebel an sich gerissen hatte: Preisgestaltung und Vertrieb. Somit hatte sie uns fest im Griff.
Ich wusste nicht, dass das Onlinekaufhaus in der Tech-Branche für seine gnadenlose, datengetriebene...
| Erscheint lt. Verlag | 17.8.2020 |
|---|---|
| Übersetzer | Cornelia Röser |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Computer • Digitale Revolution • Digitalisierung • Edward Snowden • Erfahrungen und wahre Geschichten • Erfahrungsbericht • Facebook • Feminismus • Frauen in der Gesellschaft • Frauenrechte • Generation Y • Gesellschaftskritik • Gesellschaftskritische Bücher • Google • Insider-Bericht • Insider Report • Instagram • KI • Kulturgeschichte • Kulturkritik • Künstliche Intelligenz • Macht • NSA • Risiken der digitalen Revolution • Sachbuch Gesellschaft • San Francisco • Sexismus • Sharing Economy • Silicon Valley • Skandal • Social Media • Software • Soziale Medien • Soziale Netzwerke • Start-up • Tech • Technologie • The Circle • Trump • Twitter • Überwachung • Utopie • Wahre GEschichte • youtube • Zukunft |
| ISBN-10 | 3-426-45392-4 / 3426453924 |
| ISBN-13 | 978-3-426-45392-6 / 9783426453926 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 839 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich