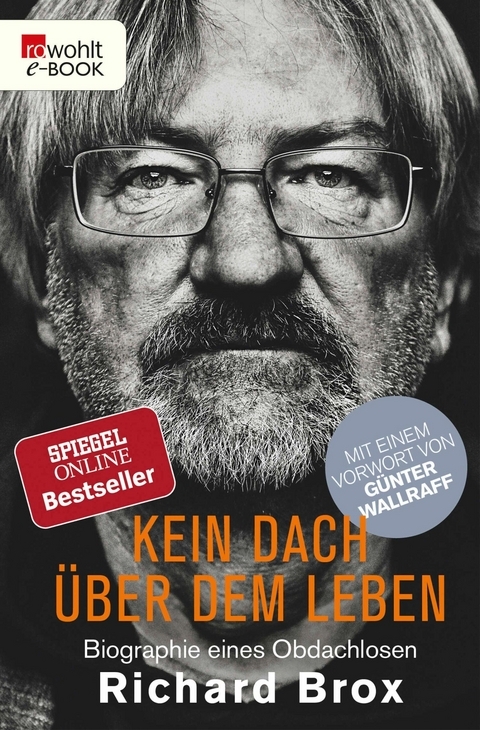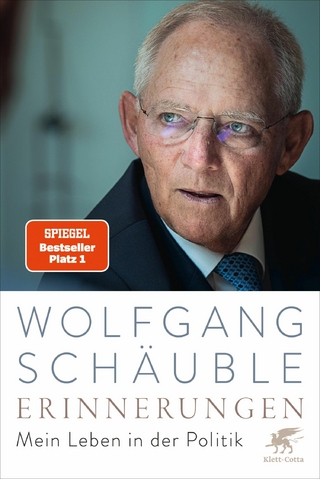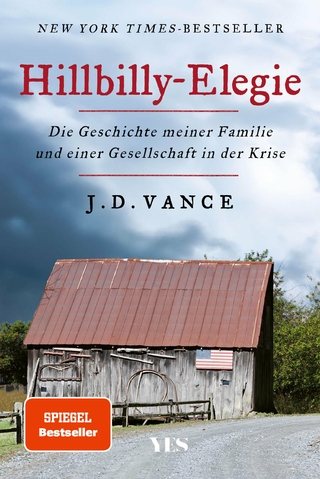Kein Dach über dem Leben (eBook)
272 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-40189-1 (ISBN)
Richard Brox wurde 1964 in Mannheim geboren. Er kam früh, mit fünf, in das erste Heim und durchlief danach eine 'Heimkarriere', flüchtete vor sexuellen Übergriffen, verweigerte die Schule, galt als schwererziehbar. Nach einem Drogenentzug Mitte der 80er Jahre verbrachte er 30 Jahre auf der Straße. Derzeit lebt er in Köln.
Richard Brox wurde 1964 in Mannheim geboren. Er kam früh, mit fünf, in das erste Heim und durchlief danach eine "Heimkarriere", flüchtete vor sexuellen Übergriffen, verweigerte die Schule, galt als schwererziehbar. Nach einem Drogenentzug Mitte der 80er Jahre verbrachte er 30 Jahre auf der Straße. Derzeit lebt er in Köln. Albrecht Kieser ist Journalist und Autor, unter anderem Mitautor von Richard Brox: Kein Dach über dem Leben; Schwerpunkte: Migration, Rassismus, Soziale Fragen. Mitarbeit bei work-watch. de und voelkermord-erinnern.de. Er lebt in Köln.
I
Ausgesetzt
In den Straßen von Mannheim
Ich bekam noch eine Galgenfrist. Eine Viertelstunde wird es gewesen sein, die sie mir gewährten. Dann musste ich endgültig raus. 21 Jahre war ich alt. Vor vier Monaten, im Dezember 1985, war meine Mutter meinem Vater gefolgt, wenn auch erst acht Jahre später. Nun waren beide tot. In diesen vier Monaten hatten die Behörden mir die elterliche Wohnung noch gelassen. Das sei eine «rechtlich nicht bindende» Schonfrist, machten sie mir mehr als einmal klar. Die Wohnung sei nicht angemessen für einen «Alleinstehenden». Zwei und ein halbes Zimmer – so viel stehe mir als Sozialhilfeempfänger nicht zu.
Nicht dass ich diese zweieinhalb Zimmer ständig genutzt hätte. Ich war schon seit dem Tod meines Vaters 1977, 51 Jahre alt war er nur geworden, ein Flüchtender. Ich war damals 13 und trieb mich herum, streunte durch Heime, über Straßen und schlief, wo ich mich zusammenrollen konnte. Dennoch: Das Elternhaus, das nur eine Wohnung in einem Mietshaus war, blieb meine Zuflucht, wenn ich nicht mehr weiterwusste oder wollte. Oder wenn mich die Sehnsucht zu meiner Mutter trieb.
An diesem Morgen im April 1986 kam um sieben Uhr die Polizei. Gemeinsam mit dem Gerichtsvollzieher und einem Räumkommando aus drei Muskelpaketen standen zwei Beamte in Uniform vor meiner Wohnungstür. Sie klingelten Sturm. Irgendwann merkte ich, dass sie mich meinten, kam schlaftrunken auf die Beine und öffnete. Das war nicht meine Zeit. Ich lebte in den Nächten, verquirlte wache und weggeträumte Stunden mit Hilfe von Alkohol und Kokain zu einer dicken Soße. Ich war nicht immer bei Sinnen, auch wenn ich bei Bewusstsein war. Was wollten diese Leute vor mir? Was war das für ein Wisch, den sie mir vor die Nase hielten? Warum drängten sie mich zur Seite? Sahen sich um wie die Habichte, die auf Beute niederstoßen wollten?
Was taten jetzt diese beiden Männer, die sich am Klavier meiner Mutter zu schaffen machten? Das waren Irre! Diebe! Leichenfledderer! Sie packten ihr Klavier an! Meine Mutter war doch gerade erst tot! Ihr Klavier! An dem sie gesessen, gespielt und gesungen hatte! Da hatte ich sie doch gerade noch sitzen sehen. Und ich hatte ihr zugehört. Wie sie spielen konnte! Wie sie singen konnte! Ich lehnte an der Wand des Wohnzimmers, noch immer im Schlafanzug und in einer Art Schockstarre.
Zwei Männer hatten Gurte umgelegt, sie stemmten mit ihnen das Klavier hoch und schlurften schwer atmend mit ihrer Last nach draußen. Ein dritter schnappte sich zwei Stühle, klemmte die Lehnen aneinander und stellte zwei weitere, Lehne an Lehne, daneben. Dann trug er alle vier weg, zwei rechts, zwei links. Alle Stühle, die wir hatten!
Offensichtlich wurde vor meinen Augen die Wohnung meiner Eltern leer geräumt. Das begriff ich allmählich, obwohl ich immer noch reglos an der Wand lehnte. Ich sah es und kroch immer mehr in mich hinein, je mehr hinausgetragen wurde. Da! Die Trompete meines Vaters! Ein heiliger Gegenstand. Sein Akkordeon! Ich registrierte es hinter einem Schleier aus Angst und Schrecken. Das Sofa! Mein Sofa, auf dem ich oft als Kind geschlafen hatte, wenn meine Mutter und mein Vater mich nicht in ihrem Bett haben wollten. Ein eigenes Bett hatte ich keines.
Die Möbel würden in ein Lager gebracht. So viel hatte ich mittlerweile verstanden, der Gerichtsvollzieher hatte es mir wohl mehrfach gesagt. Wo und wie lange sie dort aufbewahrt werden würden, wurde mir nicht mitgeteilt. Vielleicht registrierte ich den Hinweis auch nicht. Genauso wenig, wie ich registriert hatte, dass der Besuch des Gerichtsvollziehers angemeldet war. Am 1. April, an diesem klassischen Scherzkekstag, sollte ich allen Ernstes rausfliegen aus meiner Wohnung.
Ich hatte mich inzwischen angezogen, wie in Trance, vielleicht war mir kalt geworden, ich weiß es nicht mehr. Ich lehnte wieder an der Wand, irgendwer fragte, ob das meine Sachen seien, da in dem Schrank. Es sah nach jugendlichen Klamotten aus, ja, dann mussten es wohl meine Sachen sein. Und im Bad das Zeugs, ob das auch mir gehören würde? Ich solle jetzt mal endlich in die Pötte kommen und einpacken, was ich mitnehmen wollte. «In einer Viertelstunde ist hier Schicht», mahnte der Gerichtsvollzieher, der die ganze Prozedur mit verschränkten Armen beobachtete. Die zwei Polizisten waren schon nicht mehr anwesend; offensichtlich hatten sie wohl befürchtet, ich könnte womöglich ausklinken, gewalttätig werden, mich auf die Möbelpacker stürzen und ihnen den letzten Teppich oder den letzten Kochtopf entreißen. Ich tat tatsächlich nichts dergleichen, ich folgte der Aufforderung und präparierte zwei Plastiktüten. Ja, ich präparierte sie, ich steckte zwei Tüten ineinander. Sie sollten nicht reißen, ich würde sie vollstopfen, um wenigstens das Wenige zu retten, was hineinpasste. Und hineindurfte. Denn der Gerichtsvollzieher beobachtete sehr genau, was ich mitnehmen wollte. Den Schmuck meiner Mutter zum Beispiel konfiszierte er, denn die Räumung war zugleich eine Pfändung. Dass ich die Eheringe meiner toten Eltern mitnehmen durfte, nannte er ein großherziges Entgegenkommen.
Ein paar Schuhe, einmal Klamotten zum Wechseln, Zahnbürste, Rasierzeug und ein Handtuch aus dem Bad: Das füllte eine Tüte. In die andere verfrachtete ich zwei Fotoalben, irgendwelche Dokumente, meine Geburtsurkunde, die in Papier eingewickelten Eheringe, einen Armreif meiner Mutter, eine billige Uhr meines Vaters, die teure wurde einbehalten. Nicht mal meine Schlagzeugstöcke und meinen Walkman ließ der gestrenge Gerichtsvollzieher mir. 20 Mark Handgeld durfte ich behalten, der Rest meines Barvermögens verschwand in der Aktenmappe des Beamten, als Taschenpfändung.
Die Wohnung war mittlerweile leer geräumt. Die Schritte der Männer hallten von den Wänden wider, die Stimmen klangen hohl. Den Boden kehrte niemand. Die Zimmer mussten nicht besenrein übergeben werden. Sie mussten nur leer sein. Ich stand noch drin, als einzig erwähnenswerter Rest. Der Gerichtsvollzieher schob mich sanft hinaus. Draußen ließ das Räumkommando den Lkw-Motor an. Er hustete eine schwarze Wolke. Deine Tüten, sagte der Gerichtsvollzieher. Was? Ah ja, meine Tüten. Ich schnappte sie mir. Die Schlüssel, sagte der Gerichtsvollzieher. Ich gab ihm meinen Wohnungsschlüssel und meinen Haustürschlüssel. Der Amtsgewaltige schloss die Tür zu meinem Elternhaus, zu meiner Elternwohnung, zweimal um und verstaute den Schlüssel in seiner Aktentasche. Tschüss, mach’s gut, sagte er. Wie ein Kumpel sagte er das. Ich konnte ihm nicht folgen. Ich schüttelte den Kopf, er schob mich noch einmal sanft zur Treppe. Unten stieg er in sein Auto.
Ich war ohne Obdach.
Ein Blick zurück auf mein elterliches Haus. Ein graues hässliches Haus in einem hässlichen Stadtteil von Mannheim. Davon hat diese Arbeiterstadt an Rhein und Neckar mehr als genug. Der Lkw und das Auto mit dem Beamten waren weg. Ich war stocknüchtern und fror trotz des milden Frühlingsmorgens. Die Uhr zeigte elf, allzu lange hatte das Leerräumen nicht gedauert. Allmählich geriet ich in Panik, dazu gesellte sich Wut. Der Boden war mir unter den Füßen weggezogen worden. Ich stand draußen, mir wehte eine sehr windige Sorte Freiheit um die Nase, die ich bis dahin, auf meinen vielen Wegen in offenes Gelände, unter freiem Himmel noch nicht geschmeckt hatte. Bitter lag sie mir auf der Zunge.
Der Sachbearbeiter auf dem Sozialamt hatte mir schon seit Anfang des Jahres in den Ohren gelegen, dass ich mir etwas anderes suchen sollte. Eine kleinere Wohnung, noch billiger. Ich wollte nicht. Und so recht konnte ich auch nicht mit meinem viel zu häufig zugedröhnten Kopf. Dass ich es nicht einmal gemusst hätte, erfuhr ich leider viel zu spät. Viele Jahre später, viele Jahre klüger. Es war eine Willkürentscheidung, mit der mich der Sachbearbeiter aus der Wohnung warf. Es hätte in seinen Entscheidungsspielraum gepasst, wenn er mich dort gelassen hätte. Spielraum, was für ein Wort, wo es um ein Dach über dem Kopf geht. Und das Dach über meiner elterlichen Wohnung war mehr, es war bis dahin das Dach über meinem Leben gewesen. «Your last shelter», hätte mein Vater wohl gesagt. Wir sprachen manchmal Englisch miteinander.
Dass ich in dieser Stunde in einen dreißigjährigen Krieg gestoßen wurde, einen ums Überleben auf der Straße, war mir nicht klar. «Dreißigjähriger Krieg» – war das eine Metapher für mein kommendes Leben? Vielleicht nicht in diesem Moment, aber am nächsten Morgen. Da fing er an, dieser Krieg, der vielleicht auch nach 30 Jahren noch nicht zu Ende ist.
Wie betäubt lief ich mit meinen beiden Tüten, in denen nun meine wichtigsten und letzten Habseligkeiten steckten, planlos durch irgendwelche Straßen. Kein Sofa, zu dem ich in der Not zurückkehren konnte, kein Klavier, keine Trompete, kein Zimmer, keine Küche, kein Bad, kein fließendes Wasser, kein Klo. Keine Musikanlage. Keine Musikanlage! Keine CB-Funkgeräte! Und kein einziges Buch. Ich konnte nämlich durchaus lesen, auch wenn ich zusammengenommen wohl nur vier Jahre die Schule besucht hatte. Ja, ich las sogar gerne. Wenn ich klar denken konnte und wenn mir danach war. Ich war ja nicht blöd.
Ich kannte Mannheim wie meine Westentasche, natürlich auch die schachbrettartige, für Fremde verwirrende Straßeneinteilung im Zentrum, wusste aber nicht, wo ich entlanglief. Meine beiden Plastiktüten fest umklammert. Gegessen habe ich nichts, getrunken habe ich auch nichts, nur umhergelaufen bin ich. Irgendwann abends landete ich auf Planquadrat U5, einer Anlaufstelle für Obdachlose. Der Typ war nicht...
| Erscheint lt. Verlag | 15.12.2017 |
|---|---|
| Co-Autor | Dirk Kästel, Albrecht Kieser |
| Vorwort | Günter Wallraff |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Alkohol • Alkoholismus • Auf der Walz • Ausreißer • Drogenentzug • Gewalt • Notunterkünfte • Obdachlos • Platte • Wallraff • Wohnungslos |
| ISBN-10 | 3-644-40189-6 / 3644401896 |
| ISBN-13 | 978-3-644-40189-1 / 9783644401891 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich