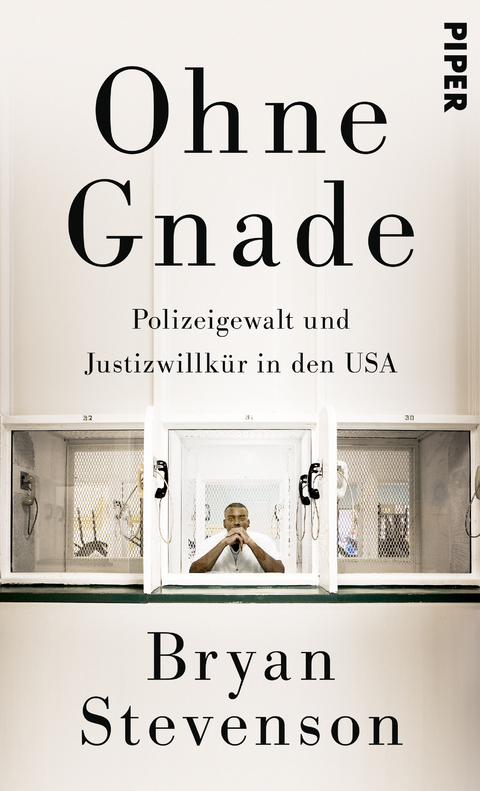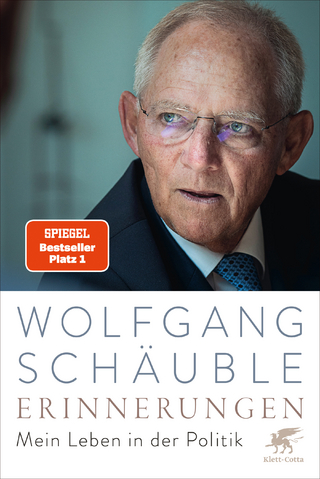Ohne Gnade
- Titel leider nicht mehr lieferbar
- Artikel merken
13-jährige Kinder, die Jahre in Isolationshaft verbringen müssen, willkürliche Verhaftungen und rassistische Vorurteile durch Polizei und Justiz oder Menschen mit psychischen Erkrankungen, die im Gefängnis jahrzehntelang vegetieren: Diese Geschichten sind Alltag in den USA.
Der charismatische Jurist Bryan Stevenson, der den allgegenwärtigen Rassismus auch aus eigenem Erleben gut kennt, gibt diesen erschütternden Fällen aus Amerikas Gerichtssälen und Todeszellen eine Stimme. Er vertritt Menschen, die keinen oder nur pro forma einen Rechtsbeistand erhalten.
Fast wie ein Thriller lesen sich die Fälle, in denen er dafür kämpft, unschuldige Menschen aus der Todeszelle herauszuholen. Ein notwendiges Buch, das den Rassismus einer Gesellschaft und das Versagen eines Strafsystems anprangert – und erschreckende Einblicke in die amerikanische Gesellschaft gibt.
Bryan Stevenson ist Professor an der juristischen Fakultät der New York University sowie Mitgründer und Geschäftsführer der Equal Justice Initiative, einer Organisation, die sich für Menschen einsetzt, die unter die Räder der amerikanischen Justiz kommen. Er hat Dutzende Verfahren gewonnen und viele Unschuldige vor der Vollstreckung der Todesstrafe gerettet.
Jürgen Neubauer, Jahrgang 1967, war Buchhändler in London, Dozent in Pennsylvania und Sachbuchlektor in Frankfurt, ehe er 2004 nach Mexiko auswanderte. Nach einigen Jahren in der Hauptstadt und in einem Bergdorf lebt er heute in der Universitätsstadt Xalapa und übersetzt für deutsche Buchverlage.
"Sein Wissen ist imposant, sein Erzählstil zugänglich wie ein guter Krimi.", literaturkritik.de, 17.03.2016
Prolog Auf die Begegnung mit einem zum Tode Verurteilten war ich nicht vorbereitet. Im Jahr 1983 war ich 23 Jahre alt, studierte Jura an der Harvard University und absolvierte in Georgia ein Praktikum. Ich war lernbegierig, aber unerfahren und fürchtete, dass ich der Situation nicht gewachsen war. Noch nie zuvor hatte ich einen Fuß in ein Hochsicherheitsgefängnis gesetzt, schon gar nicht in einen Todestrakt. Als ich erfuhr, dass ich dem Häftling ganz allein und ohne Begleitung eines Anwalts gegenübertreten würde, versuchte ich, mir meine Panik nicht anmerken zu lassen. Der Todestrakt des Bundesstaates Georgia befindet sich in einem Gefängnis in Jackson, einer Kleinstadt weit draußen auf dem Land. Ich machte mich allein auf den Weg, und während ich auf der Interstate 75 von Atlanta nach Süden fuhr, schlug mir das Herz immer höher im Hals. Ich wusste so gut wie nichts über die Todesstrafe und hatte noch nicht einmal einen Kurs zur Strafprozessordnung belegt. Ich hatte nicht die geringste Ahnung von dem komplizierten Berufungsverfahren, mit dem die Todesstrafe angefochten werden muss und das ich später noch so gut kennenlernen sollte. Bei der Anmeldung zu diesem Praktikum hatte ich mir nicht allzu viel Gedanken darüber gemacht, dass ich einem Todeskandidaten begegnen könnte. Um ehrlich zu sein, wusste ich damals nicht einmal, ob ich überhaupt Rechtsanwalt werden wollte. Je näher ich dem Gefängnis kam, umso mehr war ich davon überzeugt, dass ich diesen Mann bitter enttäuschen würde. Auf dem College hatte ich Philosophie studiert, und erst während des letzten Semesters war mir bewusst geworden, dass ich von der Philosophiererei nicht leben konnte. Auf der Suche nach einem Plan für die Zeit nach dem Bachelor verfiel ich auf den Gedanken, Jura zu studieren. Die meisten anderen Fächer schienen gewisse Grundkenntnisse vorauszusetzen, aber künftige Juristen mussten offenbar kein Vorwissen mitbringen. In Harvard hatte ich die Möglichkeit, Jura zu studieren und nebenher einen Studiengang in Public Policy zu absolvieren. Der Gedanke gefiel mir. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, aber ich wusste, dass es etwas mit dem Alltag der Armen, der Geschichte des Rassismus in den Vereinigten Staaten und dem Kampf um Gleichberechtigung zu tun haben sollte. Es sollte mit den Dingen zu tun haben, denen ich bis dahin begegnet war und die mich beschäftigt hatten, doch daraus ergab sich für mich noch kein klares Berufsbild. Schon bald nachdem ich mein Jurastudium angefangen hatte, begann ich zu zweifeln, ob ich mich für das richtige Fach entschieden hatte. Ich war von einem kleinen College in Pennsylvania gekommen und überglücklich, diesen Studienplatz bekommen zu haben, doch am Ende des ersten Jahres hatte ich viele meiner Illusionen verloren. Die juristische Fakultät von Harvard konnte damals sehr einschüchternd wirken, zumal auf einen 21-Jährigen. Viele der Professoren lehrten nach der sokratischen Methode, das heißt, sie setzten ihre Studenten bohrenden und konfrontativen Verhören aus, was auf unvorbereitete Studenten extrem demütigend wirken kann. Die Seminare schienen mir sehr theoretisch und hatten nur wenig mit den Themen Rasse und Armut zu tun, derentwegen ich mich für das Jurastudium entschieden hatte. Viele Studenten brachten weiterführende Abschlüsse mit oder hatten bereits in renommierten Kanzleien als Anwaltsgehilfen gearbeitet. Ich konnte keinerlei Referenzen vorweisen und fühlte mich meinen Kommilitonen in Sachen Berufs- und Lebenserfahrung weit unterlegen. Als einen Monat nach Semesterbeginn Großkanzleien Vorstellungsgespräche auf dem Campus führten, legten meine Kommilitonen ihre teuren Anzüge an und rangelten um Praktika in New York, Los Angeles, San Francisco oder Washington D. C. Mir war es zu diesem Zeitpunkt noch immer ein Rätsel, worauf wir uns eigentlich vorbereiteten. Vor Beginn meines Jurastudiums hatte ich einen Rechtsanwalt noch nicht einmal von Weitem gesehen. Im Sommer nach meinem zweiten Semester machte ich ein Praktikum bei einem Jugendstrafprojekt in Philadelphia. Abends belegte ich einen Mathematikkurs für das Public-Policy-Studium, das im September beginnen sollte. Aber auch zu diesem Studiengang konnte ich keine rechte Beziehung herstellen. Im Lehrplan waren viele Mathematik- und Statistikkurse vorgesehen, es ging vor allem um Effizienzsteigerung und Kostenreduzierung, und nicht darum, wofür man das Geld denn eigentlich ausgeben wollte. So anregend die Kurse zur Entscheidungstheorie oder Ökonometrie waren, so wenig konnte ich mit ihnen anfangen. Doch dann wurde mit einem Mal alles klarer. Außer der Reihe bot die juristische Fakultät einen einmonatigen Intensivkurs zum Thema Rasse und Armut an. Die Dozentin war Betsy Bartholet, eine ehemalige Anwältin der legendären Bürgerrechtsbewegung NAACP (National Association for the Advancement of Colored People – Nationale Vereinigung für die Förderung farbiger Menschen). Anders als die meisten anderen Seminare führte uns dieser Kurs aus dem Campus heraus und für einen Monat in ein Praktikum bei einer sozialen Einrichtung. Begeistert meldete ich mich an, und so kam es, dass ich Ende Dezember 1983 im Flugzeug nach Atlanta saß, wo ich einige Wochen bei einer Organisation mit dem Namen Southern Prisoners Defense Committee (SPDC – Komitee zum Schutz der Häftlinge in den Südstaaten) hospitieren sollte. Weil ich mir keinen Direktflug nach Atlanta leisten konnte, machte ich in Charlotte in South Carolina Zwischenstation. Dort lernte ich Steve Bright kennen, den Direktor des SPDC, der nach den Weihnachtsfeiertagen zurück nach Atlanta flog. Steve war Mitte dreißig und strahlte eine Leidenschaft und Selbstsicherheit aus, die das Gegenteil meiner eigenen Richtungslosigkeit zu sein schien. Er war auf einem Bauernhof in Kentucky aufgewachsen und nach dem Jurastudium in Washington D. C. gelandet. Danach war er zunächst ein glänzender Pflichtanwalt geworden und hatte erst vor Kurzem die Stelle als Leiter des SPDC angenommen, das sich die Unterstützung von Todeskandidaten in Georgia zur Aufgabe gemacht hatte. Anders als viele meiner Professoren schien er seine Überzeugungen in seiner Arbeit umzusetzen. Bei unserer ersten Begegnung umarmte er mich herzlich und fing sofort ein Gespräch an, das erst endete, als wir in Atlanta landeten. »Todesstrafe ist eine Strafe für die Armen«, erklärte er mir während unseres kurzen Flugs. »Wenn es Leute wie dich nicht gäbe, könnten wir den Todeskandidaten nicht helfen.« Ich war fast ein wenig erschrocken, weil er zu glauben schien, dass ich ihm helfen konnte. Er erklärte mir das Thema Todesstrafe in einfachen, aber überzeugenden Worten, und ich hing an seinen Lippen, völlig gefesselt von seiner Hingabe und Ausstrahlung. »Ich hoffe nur, du erwartest nicht allzu viel«, sagte er. »Keine Angst«, versicherte ich ihm. »Ich bin dankbar für die Chance, für euch arbeiten zu können.« »Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die die Arbeit bei uns als ›Chance‹ bezeichnen würden. Wir leben ziemlich einfach, und das Pensum ist gewaltig.« »Kein Problem.« »Wobei ›einfach‹ das falsche Wort ist. ›Arm‹ wäre wohl treffender. Wir wursteln uns so durch, wir sind auf die Unterstützung von Fremden angewiesen und wissen nie, wie es weitergeht.« Ich sah ihn besorgt an, und er lachte. »Das war nicht ernst gemeint. Nicht so ganz.« Er wechselte das Thema, doch es war klar, dass er sich mit Leib und Seele für die Todeskandidaten und die Verbesserung der Haftbedingungen engagierte. Es war sehr motivierend, jemandem zu begegnen, der so sehr für seine Arbeit lebte. In diesem Winter arbeiteten nur wenige Rechtsanwälte für das SPDC. Die meisten von ihnen waren Strafverteidiger und aus Washington D. C. nach Georgia gekommen, weil hier ein immer größerer Notstand herrschte : Todeskandidaten hatten keine Anwälte. Diese Juristen – Männer wie Frauen, Schwarze wie Weiße – waren sämtlich Mitte dreißig, und ihr kollegialer Umgang verriet, dass sie von ihrer Sache überzeugt waren und gemeinsam die damit verbundenen Anstrengungen auf sich nahmen. Nachdem der Vollzug der Todesstrafe einige Jahre lang ausgesetzt gewesen war, wurde sie im tiefen Süden nun wieder vollstreckt, und die meisten Menschen in den überfüllten Todestrakten hatten keinen Rechtsbeistand. Die Sorge war groß, dass bald Menschen hingerichtet würden, ohne dass ihr Fall noch einmal durch fähige Juristen überprüft worden wäre. Täglich erhielten wir panische Anrufe von Menschen, die keinen Anwalt hatten und deren Hinrichtungsdatum näher rückte. Noch nie zuvor hatte ich derart verzweifelte Stimmen gehört. Während meines Praktikums waren alle ausgesprochen freundlich zu mir. Ich fühlte mich sofort zu Hause. Die Büros des SPDC befanden sich in der Innenstadt von Atlanta im Healey Building, einem sechzehnstöckigen neogotischen Gebäude, das Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet worden war und wegen seines schlechten Zustands kaum noch Mieter hatte. Ich teilte mir einen überfüllten hufeisenförmigen Schreibtisch mit zwei anderen Anwälten und leistete Sekretariatsarbeit, das heißt, ich nahm Anrufe entgegen und recherchierte. Ich hatte mich kaum eingerichtet, als Steve mich bat, einen Todeskandidaten zu besuchen, weil keiner der Anwälte Zeit hatte. Er erklärte mir, dass der Mann seit mehr als zwei Jahren in der Todeszelle sitze und er noch keinen Anwalt für ihn habe. Ich sollte ihm eine einfache Nachricht überbringen : Sie werden dieses Jahr nicht hingerichtet. Auf der Fahrt durch die Felder und Wälder Georgias überlegte ich, was ich dem Mann sagen würde, wenn ich ihm gegenüberstünde. Wieder und wieder studierte ich meine Begrüßung ein. »Hallo, ich heiße Bryan. Ich studiere an . . .« Nein. »Ich bin Jurastudent.« Nein. »Hallo, ich heiße Bryan Stevenson. Ich bin Praktikant des Southern Prisoners Defense Committee, und ich soll Ihnen ausrichten, dass Sie nicht so bald hingerichtet werden.« – »Dass Sie nicht so schnell hingerichtet werden können.« – »Dass Sie nicht Gefahr laufen, bald hingerichtet zu werden.« Nein. Ich war immer noch am Üben, während ich auf den Furcht einflößenden Stacheldrahtzaun und den weißen Wachturm zufuhr. Der offizielle Name der Haftanstalt lautete »Georgia Diagnostic and Classification Center«, aber im Büro nannten wir sie nur »Jackson«. Den wirklichen Namen auf dem Schild zu lesen war ein heilsamer Schock. Ich stellte mein Auto ab, ging zur Pforte und betrat das Hauptgebäude mit seinen dunklen Fluren und vergitterten Durchgängen. Die Einrichtung nahm mir jeden Zweifel, dass es sich um einen schrecklichen Ort handelte. Durch einen Tunnel gelangte ich in den Besucherraum. Jeder Schritt hallte bedrohlich in dem gefliesten Gang wider. Als ich mich dem Wachbeamten als Rechtsanwaltsgehilfe vorstellte und ihm sagte, dass ich einen Todeskandidaten besuchen wolle, sah er mich misstrauisch an. Ich trug meinen einzigen Anzug, und es war unschwer zu erkennen, dass er seine besten Tage hinter sich hatte. Der Vollzugsbeamte schien sich meinen Ausweis besonders lange und gründlich anzusehen, dann beugte er sich zu mir vor. »Sie sind nicht von hier.« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage. »Nein, Sir. Ich arbeite in Atlanta.« Nachdem er in der Verwaltung angerufen hatte, um sich zu versichern, dass der Besuch ordnungsgemäß angemeldet worden war, ließ er mich endlich ein und schickte mich mit barschem Ton in einen kleinen Raum, in dem die Unterredung stattfinden sollte. »Aber verlaufen Sie sich nicht«, warnte er mich noch. »Wir können Ihnen nicht versprechen, dass wir Sie suchen kommen.« Der Besucherraum war sechs auf sechs Meter groß und mit einigen am Boden festgeschraubten Hockern möbliert. Alles im Raum war aus Metall und gesichert. Vor den Hockern verlief eine niedrige Wand, und darüber war ein Eisengitter angebracht, das bis zur vier Meter hohen Decke reichte. Der Raum war nichts anderes als ein leerer Käfig. Bei Familienbesuchen waren Besucher und Häftlinge durch das Gitter getrennt. Anwaltsbesuche waren dagegen »Kontaktbesuche«, das heißt, wir saßen auf derselben Seite des Gitters und hatten mehr Privatsphäre. Dieser halbe Raum war klein und schien immer kleiner zu werden. Wieder sorgte ich mich über meine unzulängliche Vorbereitung. Das Treffen sollte eine Stunde dauern, aber ich fürchtete, dass ich mit dem wenigen, was ich mir zurechtgelegt hatte, nicht einmal eine Viertelstunde füllen konnte. Ich setzte mich auf einen der Hocker und wartete. Nach fünfzehn Minuten wachsender Nervosität hörte ich endlich das Klirren von Ketten auf der anderen Seite der Tür. Der Mann, der hereinkam, schien noch nervöser zu sein als ich. Als er mich ansah, zuckte die Sorge über sein Gesicht, und als ich den Blick erwiderte, wandte er sich schnell ab. Er rührte sich nicht von der Tür weg, als wollte er den Besucherraum nicht betreten. Er war ein junger, mittelgroßer Afroamerikaner in leuchtend weißer Gefängniskleidung, der mit seinem glatt rasierten Gesicht und seinen kurz geschorenen Haaren einen gepflegten Eindruck machte. Er schien mir sofort vertraut, so als wäre ich mit ihm aufgewachsen, wie ein Schulfreund, jemand, mit dem ich Sport getrieben oder Musik gemacht hatte, oder jemand, mit dem ich auf der Straße über das Wetter gesprochen hatte. Der Wachmann nahm ihm langsam die Handschellen und Fußfesseln ab, dann erklärte er mir mit strengem Blick, dass ich eine Stunde Zeit hätte. Er schien unsere Nervosität zu spüren und seinen Spaß daran zu haben, denn er grinste mich an, ehe er sich umdrehte und den Raum verließ. Die Metalltür fiel krachend ins Schloss, sodass der kleine Raum bebte. Der Mann kam nicht näher, und weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, ging ich auf ihn zu und gab ihm die Hand. Er schüttelte sie vorsichtig. Wir setzten uns hin, und er sprach als Erster. »Ich bin Henry«, sagte er. »Es tut mir leid«, war das Erste, was ich hervorstieß. Vergessen waren meine einstudierten Sätze, und ich hörte, wie die Entschuldigungen aus meinem Mund sprudelten. »Es tut mir wirklich leid, äh, okay, ich weiß nicht, äh, ich bin nur Student, ich bin kein Anwalt. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht viel sagen kann, aber ich weiß nicht viel.« Der Mann sah mich besorgt an. »Ist was nicht in Ordnung mit meinem Fall?« »Äh, ja, Sir. Nein, Sir. Die Anwälte vom SPDC haben mich geschickt, um Ihnen zu sagen, dass sie noch keinen Anwalt haben . . . Also, dass wir noch keinen Anwalt für Sie haben. Aber Sie müssen nicht befürchten, nächstes Jahr hingerichtet zu werden . . . Wir arbeiten daran, einen Anwalt für Sie zu finden, einen richtigen Anwalt, und wir hoffen, dass der Sie in ein paar Monaten besuchen kann. Ich bin nur ein Student. Ich helfe Ihnen gern, ich meine, wenn ich Ihnen helfen kann.« Der Mann unterbrach mein Gestammel, indem er meine Hand ergriff. »Das heißt, ich werde nächstes Jahr nicht hingerichtet?« »Nein, Sir. Sie haben mir gesagt, dass mindestens ein Jahr vergeht, bis Sie einen Termin bekommen.« In meinen Ohren klangen diese Worte alles andere als tröstlich. Aber Henry drückte meine Hände immer fester. »Ich bin seit zwei Jahren hier, und Sie sind der erste Mensch, den ich sehe, der kein Todeskandidat und kein Wärter ist. Ich bin so froh, dass Sie hier sind, ich freue mich so über diese Nachricht!« Er atmete tief aus und schien sich zu entspannen. »Ich habe mit meiner Frau telefoniert, aber ich habe nicht gewollt, dass sie mich mit den Kindern besuchen kommt. Ich habe Angst, dass sie herkommen, und ich habe einen Hinrichtungstermin. So will ich sie nicht hier haben. Jetzt kann ich ihnen sagen, dass sie mich besuchen können. Danke!« Erstaunt stellte ich fest, wie glücklich er schien. Das entspannte mich, und allmählich kam ein Gespräch in Gang. Wir waren beide gleich alt. Henry stellte mir Fragen über mich, ich fragte ihn nach seiner Frau. Wir unterhielten uns über alles Mögliche und vergaßen darüber die Zeit. Er erzählte mir von seiner Familie und von seinem Prozess. Er fragte mich nach der Universität und meiner Familie. Wir sprachen über Musik, wir sprachen über das Gefängnis, und wir sprachen darüber, worauf es im Leben ankam und worauf nicht. Manchmal lachten wir, und manchmal waren wir bewegt und traurig. Wir redeten und redeten, und erst, als es laut an die Tür hämmerte, bemerkte ich, dass ich meine Zeit weit überzogen hatte. Ich sah auf die Uhr. Wir hatten uns drei Stunden lang unterhalten. Der Wärter kam herein. Ärgerlich schnauzte er mich an : »Ihre Zeit ist schon lange um. Sie müssen jetzt gehen.« Er legte Henry die Handschellen an, zog ihm die Hände auf den Rücken und zurrte sie zusammen. Ruppig legte er ihm die Fußfesseln an und zog in seinem Zorn zu fest zu. Ich sah, wie Henry vor Schmerzen das Gesicht verzog. »Diese Fußfesseln sind zu fest«, sagte ich. »Könnten Sie sie bitte lockern?« »Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie müssen jetzt gehen. Sie brauchen mir nicht zu sagen, wie ich meinen Job zu machen habe.« Henry lächelte mich an und sagte : »Es ist okay, Bryan. Mach dir keine Sorgen. Komm einfach wieder und besuch mich, okay?« Ich sah, wie er zusammenzuckte, als ihm die Ketten um den Leib gefesselt wurden. Ich muss ihn entsetzt angesehen haben, denn Henry wiederholte : »Mach dir keine Sorgen, Bryan. Komm wieder, okay?« Als ihn der Wärter in Richtung Tür stieß, drehte sich Henry noch einmal um. Ich murmelte : »Es tut mir leid, Henry, es tut mir . . .« »Keine Sorge, Bryan«, unterbrach er mich. »Komm einfach wieder.« Ich sah ihn an und suchte nach den passenden Worten, ich wollte ihm gern etwas Aufmunterndes zurufen und meine Dankbarkeit für seine Geduld ausdrücken. Aber ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Henry sah mich an und lächelte. Der Wärter stieß ihn grob vorwärts. Die grobe Behandlung missfiel mir, aber Henry lächelte ununterbrochen. Doch kurz bevor ihn der Wärter vollends aus dem Raum geschoben hatte, blieb er mit einem Mal stehen und widersetzte sich dem Stoß. Er wirkte ganz ruhig. Dann geschah etwas Unerwartetes. Ich sah, wie er die Augen schloss und den Kopf zurücklegte. Ich war verwirrt, doch als Henry den Mund öffnete, verstand ich. Er begann zu singen. Er hatte einen vollen Bariton, seine Stimme war kräftig und klar. Der Wärter war genauso überrascht wie ich und stieß ihn nicht weiter. I’m pressing on, the upward way, New heights I’m gaining every day, Still praying as I’m onward bound, Lord, plant my feet on Higher Ground. Es war ein altes Kirchenlied, das ich in meiner Kindheit im Gottesdienst gesungen hatte. Seit Jahren hatte ich es nicht mehr gehört. Henry sang langsam und inbrünstig. Der Wärter brauchte einen Moment, um sich von der Überraschung zu erholen, dann schob er ihn weiter zur Tür hinaus. Mit seinen gefesselten Füßen wäre Henry beinahe gestrauchelt. Er watschelte, um sein Gleichgewicht zu halten, doch er sang immer weiter. Ich hörte ihn, während er den Gang hinunterging. Lord, lift me up and let me stand, By faith on Heaven’s table land, A higher plane than I have found, Lord, plant my feet on Higher Ground. Erschüttert setzte ich mich. Henrys Stimme war voller Sehnsucht. Das Lied war wie ein Geschenk für mich. Ich war nervös gewesen und hatte mir Sorgen gemacht, ob er mich in meiner Unzulänglichkeit akzeptieren würde. Ich hatte nicht erwartet, dass er mir mit diesem Mitgefühl und dieser Großzügigkeit begegnen würde. Ich hatte kein Recht, von einem Todeskandidaten etwas zu erwarten. Er gab mir einen erstaunlichen Beweis seiner Menschlichkeit, und mit einem Mal verstand ich, was menschliches Potenzial, Erlösung und Hoffnung bedeuten. Am Ende meines Praktikums verspürte ich das tiefe Bedürfnis, den Todeskandidaten zu helfen, die ich in diesem Monat kennengelernt hatte. Die persönliche Begegnung mit den Häftlingen und den zum Tode Verurteilten machte die Frage nach ihrer und meiner Menschlichkeit dringlicher und bedeutsamer. Ich kehrte mit dem tiefen Bedürfnis an die Universität zurück, die Gesetze und Lehrmeinungen zu verstehen, mit denen die Todesstrafe und andere extreme Formen der Bestrafung begründet werden. Ich belegte Kurse zu Verfassungsrecht, Strafrecht, Strafprozessordnung, Berufungsverfahren und Bundesgerichten. Ich belegte zusätzliche Kurse, um die Rolle der Verfassungstheorie in Strafverfahren zu verstehen. Ich beschäftigte mich mit den juristischen und soziologischen Aspekten von Rasse, Armut und Macht. Zuvor war mir das Jurastudium abstrakt und realitätsfern erschienen, doch nach meiner Begegnung mit verzweifelten Häftlingen wurde es umso relevanter und wichtiger. Selbst mein Public-Policy-Studium schien mir plötzlich sinnvoll. Ich wollte unbedingt die Fähigkeiten erwerben, die nötig waren, um die Diskriminierung und Ungleichbehandlung, die ich gesehen hatte, zu verstehen und zu bekämpfen. Während meiner kurzen Begegnung mit Todeskandidaten hatte ich erkannt, dass unsere Justiz im Umgang mit Menschen viele Mängel hat. Je länger ich über meine Erfahrungen nachdachte, umso klarer wurde mir, dass mich diese Frage, warum manche Menschen ungerecht behandelt wurden, mein Leben lang beschäftigt hatte. Ich bin in einem armen schwarzen Dorf in Delaware aufgewachsen, am Ostufer der Halbinsel Delmarva, einer Gegend, auf der damals noch der Schatten der rassistischen Geschichte unseres Landes lastete. Die Küstenregion zwischen Virginia und Delaware hing unverhohlen dem Traum der alten Südstaaten nach, und viele Menschen hielten an der alten rassistischen Ordnung mit all ihren Symbolen, Ritualen und Gepflogenheiten fest, wohl auch wegen der Nähe der Gegend zu den einstigen Nordstaaten. Überall wehte die Flagge der alten Südstaaten, das blaue Sternenkreuz auf rotem Grund, als unübersehbares und trotziges Symbol der kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Abgrenzung. In Kleinstädten lebten Afroamerikaner in Gettos jenseits der Eisenbahnschienen oder auf dem Land in eigenen »schwarzen Siedlungen«. In meinem Dorf wohnten die Menschen in Hütten, viele hatten kein fließendes Wasser und benutzten Plumpsklos. Wir Kinder spielten im Hof zwischen den Hühnern und Schweinen. Die Schwarzen in unserem Dorf waren starke und beharrliche Menschen, doch sie lebten ausgeschlossen am Rande der Gesellschaft. Jeden Morgen brachte ein Bus die Erwachsenen zu einer Geflügelfabrik, wo sie täglich Tausende Hühnchen rupften, zerlegten und verarbeiteten. Mein Vater hatte das Dorf als Jugendlicher verlassen, weil es für schwarze Kinder nur eine einfache Grundschule gab. Später war er mit meiner Mutter zurückgekommen und hatte Arbeit in einer Fabrik gefunden. An den Wochenenden arbeitete er als Gärtner und Hausmeister in den Strandhäusern der Weißen. Meine Mutter bekam eine Stelle in einem Stützpunkt der Air Force. Es war, als würden wir in das verhasste Gewand der Rassenunterschiede gezwängt, das uns überall behinderte und einschränkte. Obwohl meine Verwandten hart arbeiteten, schienen sie es nie zu etwas zu bringen. Mein Großvater wurde ermordet, als ich noch ein Junge war, aber außer unserer Familie schien das niemanden zu interessieren. Die Eltern meiner Großmutter waren im Osten Virginias Sklaven gewesen. Meine Großmutter war in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts zur Welt gekommen, ihre Eltern in den Vierzigern. Ihr Vater hatte ihr immer vom Leben in der Sklaverei erzählt und ihr geschildert, wie er sich heimlich selbst das Lesen beigebracht hatte. Er durfte nicht zeigen, was er gelernt hatte – bis zur Befreiung. Das Erbe der Sklaverei prägte meine Großmutter und die Art, wie sie ihre neun Kinder erzog. Ich spürte es auch noch in unseren Gesprächen und ihren Warnungen, mich immer in ihrer Nähe aufzuhalten. Wenn ich sie besuchte, schloss sie mich zur Begrüßung so fest in ihre Arme, dass ich kaum atmen konnte. Wenn sie mich wenig später wiedersah, fragte sie mich : »Bryan, spürst du meine Umarmung noch?« Wenn ich Ja sagte, dann ließ sie mich gehen, und wenn ich Nein sagte, dann nahm sie mich noch einmal fest in die Arme. Ich sagte oft Nein, denn es gefiel mir, von ihren starken Armen umschlungen zu werden. Sie wurde nie müde, mich zu umarmen. »Die wichtigsten Dinge kann man nicht aus der Distanz verstehen, Bryan«, erklärte sie mir oft. »Das geht nur aus der Nähe.« In der Distanz, die ich in den ersten beiden Semestern meines Jurastudiums erlebte, fühlte ich mich verloren. Erst die Nähe zu den Todeskandidaten und den zu Unrecht Verurteilten vermittelte mir ein Gefühl der Vertrautheit. Dieses Buch ist der Versuch, sich dem Phänomen der Masseninhaftierung und der Todesstrafe in den Vereinigten Staaten zu nähern. Es geht der Frage nach, mit welcher Leichtfertigkeit wir in diesem Land Menschen verurteilen und welches Unrecht wir begehen, wenn wir den Schwächsten unserer Gesellschaft mit Angst, Zorn und Distanz begegnen. Außerdem handelt es von einer dramatischen Phase unserer jüngsten Geschichte, die das Leben von Millionen von Amerikanern unabhängig von Hautfarbe, Alter und Geschlecht unauslöschlich geprägt und tiefe Spuren in der amerikanischen Psyche hinterlassen hat. Als ich im Dezember 1983 zum ersten Mal einen Todestrakt betrat, hatte in den Vereinigten Staaten gerade ein radikaler Umbruch begonnen. In den nächsten Jahrzehnten sollte das Land zu einer harschen und strafenden Nation werden und eine Inhaftierungswelle erleben, die in der Geschichte ihresgleichen sucht. In den Vereinigten Staaten lebt ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung hinter Gittern als in irgendeinem anderen Land der Welt. Seit Anfang der Siebzigerjahre stieg die Zahl der Häftlinge von 300 000 auf heute 2,3 Millionen an. Fast sechs Millionen Menschen sind nur zur Bewährung auf freiem Fuß. Schätzungen gehen davon aus, dass von den 2001 Geborenen jeder Fünfzehnte ins Gefängnis kommen wird.1 Von den in diesem Jahrhundert geborenen schwarzen Männern wird es sogar jeder Dritte sein.2 Wir haben Hunderte Menschen erschossen, erhängt, vergast, vergiftet oder auf dem elektrischen Stuhl getötet, um die von unserem Rechtsstaat gebilligte Todesstrafe zu vollstrecken. Tausende warten in Todeszellen auf ihre Hinrichtung. Einige Bundesstaaten haben kein Jugendstrafrecht und machen vor Gericht keinen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen; wir haben eine Viertelmillion Kinder, einige davon unter zwölf Jahren, in Erwachsenengefängnisse gesperrt, wo sie lange Haftstrafen verbüßen.3 Lange Zeit waren die Vereinigten Staaten das einzige Land der Welt, in dem Kinder zu lebenslangen Freiheitsstrafen ohne Aussicht auf vorzeitige Haftentlassung verurteilt wurden, und rund 3000 Jugendliche wurden dazu verdammt, im Gefängnis zu sterben. Hunderttausende kommen wegen minderschwerer Vergehen für Jahrzehnte hinter Gitter. Wir haben neue Gesetze verabschiedet, die das Ausstellen eines ungedeckten Schecks, einen kleinen Diebstahl oder unbedeutende Eigentumsdelikte mit lebenslangem Freiheitsentzug bestrafen. Wir führen einen kostspieligen Krieg gegen Menschen mit Drogenproblemen. Heute sitzt mehr als eine halbe Million Menschen wegen Drogendelikten in Gefängnissen, während es 1980 gerade einmal 41 000 waren.4 In vielen Bundesstaaten haben wir vorzeitige Haftentlassungen abgeschafft. In anderen demonstrieren wir unsere Erbarmungslosigkeit mit Slogans wie »Drei Verfehlungen – und du bist raus«. Wir haben Wiedereingliederungsmaßnahmen, Bildungsprojekte und andere Unterstützungsleistungen für Häftlinge abgeschafft, weil wir diesen Menschen gegenüber weder Güte noch Mitgefühl zeigen wollen. Wir haben Verordnungen erlassen, die Menschen auf ihre schlimmsten Taten reduzieren und sie zeitlebens als »Krimineller«, »Mörder«, »Vergewaltiger«, »Dieb«, »Drogenhändler«, »Sexualstraftäter« oder »Gewaltverbrecher« brandmarken – Etiketten, die sie nie wieder loswerden, ganz unabhängig von den Umständen, unter denen sie ihre Straftaten begingen, und ganz unabhängig davon, ob sie sich später zum Besseren wandeln. Die Masseninhaftierung hat jedoch noch weitere, mindestens ebenso gravierende Konsequenzen. Wegen Drogenvergehen verurteilten Frauen, und damit auch ihren Kindern, nehmen wir das Recht auf Lebensmittelbeihilfen und Sozialwohnungen.5 Wir haben ein Kastenwesen geschaffen, das viele Menschen in die Beschäftigungs- und Obdachlosigkeit zwingt und ihnen das Zusammenleben mit ihren Familien und Gemeinschaften verbietet. Einige Bundesstaaten entziehen verurteilten Straftätern das Wahlrecht6, weshalb in einigen südlichen Bundesstaaten die politische Entmündigung der männlichen schwarzen Bevölkerung heute wieder ein Niveau erreicht, das an die Zeiten vor ihrer Gleichstellung im Jahr 1965 erinnert.7 Daneben begehen wir schwere Fehler. Dutzende Menschen wurden zum Tode verurteilt und warteten schon auf ihre Hinrichtung, ehe ihre Unschuld bewiesen wurde.8 Hunderte weitere wurden aus lebenslangen Haftstrafen entlassen, weil ihre Unschuld durch Gentests nachgewiesen wurde. 9 Armut, Rassismus, Schuldvermutung und eine ganze Reihe anderer gesellschaftlicher, struktureller und politischer Dynamiken haben ein Justizsystem entstehen lassen, das durch Irrtümer gekennzeichnet ist und Tausende Unschuldiger hinter Gitter gebracht hat.10 Schließlich kostet uns die Masseninhaftierung gewaltige Summen. Pro Jahr geben wir heute fast 80 Milliarden Dollar für Haftanstalten aus – 1980 waren es noch 6,9 Milliarden.11 Private Gefängnisbetreiber spenden Millionen, damit Politiker in Washington und den Bundesstaaten neue Verbrechen erfinden, längere Haftstrafen verhängen und mehr Menschen einsperren, weil sie so höhere Profite erzielen. Diese privaten Gewinne bieten keinen Anreiz für eine Verbesserung der inneren Sicherheit, eine Reduzierung der Gefängniskosten und Wiedereingliederungsmaßnahmen für Häftlinge. Um ihre Haftanstalten bezahlen zu können, sparen die Bundesstaaten bei den staatlichen Dienstleistungen, der Bildung, der Gesundheit und der Sozialhilfe, was wiederum beispiellose wirtschaftliche Probleme zur Folge hat. Die Privatisierung der Krankenversicherungen für Häftlinge, der private Warenverkauf in Gefängnissen und eine Reihe anderer Dienstleistungen haben die Masseninhaftierung zu einem lukrativen Geschäft für einige wenige gemacht. Für den Rest der Gesellschaft ist sie ein teurer Albtraum. Nachdem ich mein Jurastudium abgeschlossen hatte, ging ich zurück in den Süden, um als Rechtsanwalt für die Armen, die Häftlinge und die Todeskandidaten zu arbeiten. In den vergangenen dreißig Jahren bin ich Menschen begegnet, die Opfer von Justizirrtümern wurden und in der Todeszelle auf ihre Hinrichtung warteten. Einer davon war Walter McMillian, den Sie in diesem Buch kennenlernen werden. Walters Geschichte hat mir drastisch vor Augen geführt, mit welch bestürzender Gleichgültigkeit unser Justizsystem Fehlurteile hinnimmt, wie fest rassistische Vorurteile verankert sind und wie leichtfertig wir über ungerechte Gerichtsverfahren und Verurteilungen hinweggehen. Walters Erfahrung hat mir auch gezeigt, wie Menschen durch verantwortungslose Prozesse und Urteile traumatisiert und stigmatisiert werden – und zwar nicht nur die Verurteilten selbst, sondern auch ihre Angehörigen, ihre Gemeinschaften und selbst die Opfer des Verbrechens. Aber Walters Fall hat mich auch noch etwas anderes gelehrt : Es gibt Hoffnung. Walters Geschichte ist eine von vielen, die ich in diesem Buch erzähle. Vor Gericht habe ich auch misshandelte und vernachlässigte Kinder vertreten, die nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt und in Erwachsenengefängnissen weiter misshandelt und vernachlässigt wurden. Ich habe Frauen vertreten und miterlebt, wie wir in unserer Feindseligkeit gegenüber den Armen und in unserer Drogenhysterie sozial schwache Frauen kriminalisieren und verfolgen, wenn eine Schwangerschaft fehlschlägt. Ich habe Menschen mit geistigen Behinderungen vertreten, die aufgrund ihrer Krankheit oft über Jahrzehnte hinweg in Haftanstalten eingesperrt werden. Aber ich habe auch die Opfer von Gewaltverbrechen und ihre Familien kennengelernt, und ich habe beobachtet, dass selbst viele der Gefängnismitarbeiter leiden und gewalttätiger, zorniger, ungerechter und unbarmherziger geworden sind. Ich habe auch Menschen vertreten, die schreckliche Verbrechen begangen haben und nun versuchen, ein neues Leben zu führen. In den Herzen vieler Inhaftierter und Todeskandidaten habe ich Spuren der Hoffnung und Menschlichkeit gefunden – die Saat einer Erneuerung, die auf erstaunliche Weise aufblüht, wenn sie nur ein wenig genährt wird. Durch die Nähe habe ich einige einfache Wahrheiten gelernt, die demütig machen, darunter diese entscheidende Lektion : Jeder von uns ist mehr als seine schlimmste Tat. Meine Arbeit mit den Armen und Inhaftierten hat mich gelehrt, dass das Gegenteil von Armut nicht Reichtum ist : Das Gegenteil von Armut ist Gerechtigkeit. Und schließlich bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass sich unser Bekenntnis zu Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung nicht daran messen lässt, wie wir die Reichen und Mächtigen behandeln. Unser Charakter lässt sich nur daran messen, wie wir mit den Armen, Benachteiligten, Angeklagten, Eingesperrten und Verurteilten umgehen. Wir machen uns alle schuldig, wenn wir zulassen, dass Menschen misshandelt werden. Mangelndes Mitgefühl kann eine ganze Gesellschaft und ein ganzes Land zersetzen. Angst und Zorn machen uns rachsüchtig und niederträchtig, ungerecht und unfair, bis wir alle unter dem Mangel an Mitgefühl leiden und uns selbst genauso verurteilen wie unsere Opfer. Je näher wir den Inhaftierten und Todeskandidaten kommen, umso mehr werden wir erkennen, dass wir alle Mitgefühl und Gerechtigkeit nötig haben – und vielleicht auch ein bisschen unverdiente Gnade.
| Erscheint lt. Verlag | 14.9.2015 |
|---|---|
| Übersetzer | Jürgen Neubauer |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Just Mercy |
| Maße | 128 x 210 mm |
| Gewicht | 517 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Schlagworte | Dayton Literary Peace Prize • Fehlurteile • Justiz • Justizirrtum • Polizei • Polizei; Berichte/Erinnerungen • Rassismus • Strafrecht • Todesstrafe • USA • USA; Berichte/Erinnerungen • USA; Politik/Zeitgesch. • USA; Politik/Zeitgeschichte |
| ISBN-10 | 3-492-05722-5 / 3492057225 |
| ISBN-13 | 978-3-492-05722-6 / 9783492057226 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich