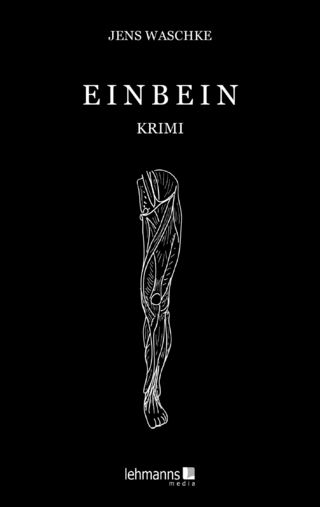Ein rätselhafter Patient zieht den jungen Psychiater Parker H. in seinen Bann. Seit dem sechsten Lebensjahr wird der mittlerweile 30-jährige Mann, den alle nur 'Joe' nennen, in der düsteren Nervenheilanstalt in Neuengland verwahrt. Er gilt als nicht therapierbar. Jeder, der mit ihm spricht, verliert den Verstand oder begeht Selbstmord. Allen Warnungen zum Trotz beschließt der ehrgeizige Parker, 'Joe' in seiner Zelle zu besuchen. Dabei setzt er eine Kette von albtraumhaften Ereignissen in Gang, die seine schlimmsten Befürchtungen weit übertreffen...
Jasper DeWitt ist das Pseudonym eines Journalisten. »Der Angstsammler« ist sein erster Roman. Der Autor lebt in L.A.
13. März 2008
Ich schreibe dies, weil ich inzwischen nicht mehr weiß, ob ich in ein schreckliches Geheimnis eingeweiht wurde oder selbst wahnsinnig bin. Letzteres wäre für mich als praktizierender Psychiater zweifellos in ethischer wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht schlecht. Weil ich jedoch nicht glauben kann, dass ich verrückt bin, poste ich diese Geschichte, denn wahrscheinlich seid ihr die einzigen Menschen, die sich überhaupt vorstellen können, dass sie möglicherweise wahr ist. Für mich ist es eine Frage der Verantwortung gegenüber der Menschheit.
Bevor ich anfange, möchte ich betonen, dass ich hinsichtlich der Namen und Orte, die hier erwähnt werden, gerne präziser gewesen wäre, doch ich muss meinem Job nachgehen und kann es mir nicht leisten, als jemand, der die Geheimnisse seiner Patienten verrät, wie außergewöhnlich der Fall auch sein mag, auf irgendeiner schwarzen Liste im Medizin- oder Psychotherapiebereich zu landen. Dementsprechend sind die Ereignisse, die ich in diesem Bericht beschreibe, allesamt wahr, auch wenn Namen und Orte verändert werden mussten, damit weder meine Karriere noch meine Leser Schaden nehmen.
Folgende Angaben kann ich jedoch gewähren: Meine Geschichte ereignete sich zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts in einer staatlichen psychiatrischen Klinik in den USA. Meine Verlobte Jocelyn, eine überaus gewissenhafte Frau von koboldhafter Intelligenz und strahlender Schönheit, die dank eines Treuhandvermögens im Rücken im Begriff war, sich eine Karriere als Shakespeare-Expertin aufzubauen, steckte damals noch mitten in ihrer Doktorarbeit über die Frauenfiguren in König Lear. Diese Doktorarbeit war – neben meinem Wunsch, ihr so nah wie möglich zu sein – der Grund dafür, warum ich mich entschlossen hatte, meine Bewerbungen ausschließlich an Kliniken in Connecticut zu schicken.
Nachdem ich an einigen der angesehensten Universitäten Neuenglands Medizin studiert und im selben Teil des Landes eine gleichermaßen gründliche wie erfolgreiche praktische Ausbildung in meinem Fach absolviert hatte, waren meine Mentoren besonders darauf bedacht, zu erfahren, wie mein nächster beruflicher Schritt aussehen würde. Eine Anstellung in einer kleinen, mit bescheidenen Mitteln ausgestatteten Klinik war etwas für gewöhnliche Sterbliche von irgendeiner Provinzuniversität, aber nichts für Ärzte mit Lux et Veritas auf ihren Prüfungsbögen und schon gar nichts für Ärzte, die ihr Studium und ihre klinische Ausbildung mit so guten Bewertungen abgeschlossen hatten.
Für mich selbst jedoch spielte dieser Versuch, anderen stets um eine Nasenlänge voraus zu sein, keine große Rolle. Weil ich schon als Kind die hässliche Seite des Medizinsystems kennengelernt hatte, nachdem meine Mutter wegen paranoider Schizophrenie in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden war, galt mein Interesse heute weit eher dem Versuch, die auseinandergebrochenen Teile der Medizin wieder zusammenzufügen, als es mir auf einem jener angenehmen Plätze bequem zu machen, die für die höheren Ränge in meinem Fach vorgesehen sind.
Doch selbst für eine Anstellung im allerschlechtesten Krankenhaus musste ich Referenzen vorweisen können, was bedeutete, dass die Vorurteile meiner Ausbilder eine gewisse Rolle bei meiner Wahl spielen würden. Ein besonders griesgrämiger Arzt, an den ich mich wandte, kannte zufällig noch aus der Zeit seines Studiums die medizinische Direktorin der nahe gelegenen staatlichen Klinik. Unter jemandem mit solcher Herkunft und Erfahrung zu arbeiten, würde, so meinte er, wenigstens verhindern, dass ich einige schlechte Gewohnheiten annahm, und vielleicht wären wir ja aufgrund unserer »übertrieben altruistischen Einstellung« imstande, gut miteinander auszukommen. Ich stimmte gerne zu, zum Teil, um die Referenz zu bekommen, zum anderen Teil, weil die Klinik, die mein Professor empfohlen hatte – eine trostlose Einrichtung, die ich hier Connecticut State Asylum (CSA) nennen möchte, um einen Prozess zu vermeiden –, perfekt zu dem passte, was mir vorschwebte: Es war eine der am schlimmsten unterfinanzierten und glücklosesten Institutionen im Gesundheitssystem Connecticuts.
Wenn ich nicht voller Überzeugung die unter Wissenschaftlern gängige Weigerung teilen würde, natürliche Phänomene zu anthropomorphisieren, hätte ich fast den Eindruck haben können, dass bereits die atmosphärischen Bedingungen den Versuch unternahmen, mich auf meiner ersten Fahrt zu meinem Vorstellungsgespräch in der Klinik zu warnen. Jeder, der im Frühling schon einmal eine gewisse Zeit in Neuengland verbracht hat, weiß, dass das Wetter dort ohne jede Vorwarnung drastisch umschlagen kann, denn – Entschuldigung, Forrest Gump – das Klima in Neuengland ist nicht wie eine Schachtel Pralinen, sondern wie eine Schachtel Scheiße. Was immer man auch bekommt, es stinkt.
Aber sogar nach Neuengland-Maßstäben war der Tag schlimm. Der Wind kreischte in den Bäumen und drang mit der Wucht eines angreifenden Stiers zunächst auf mich und dann auf mein Auto ein. Der Regen schlug gegen meine Windschutzscheibe. Die Straße, die trotz meiner Scheibenwischer nur halb sichtbar war, wirkte weniger wie eine Straße als vielmehr wie ein ins Fegefeuer führender Weg aus Holzkohle, an den Seiten begrenzt von stumpfem Gelb und den scheinbar leeren Hüllen anderer Autos, welche von Reisenden gesteuert wurden, die in der nassen, grauen Weite eher Gespenstern als tatsächlich lebenden Menschen glichen. Der Nebel durchtränkte die Luft mit bedrohlich stummen, rankengleichen Schwaden, die sich über die Straße zogen und eine Herausforderung für jeden darstellten, der sich auf diese einsame Landstraße wagte.
Sobald das Schild für meine Abzweigung auftauchte, verließ ich die Hauptstraße und folgte der ersten Nebenstraße, die einem Labyrinth ähnlich verlassener und vom Nebel verschlungener Sträßchen anzugehören schien. Hätte ich mir nicht zuvor eine Reihe vertrauenswürdiger Angaben meines Routenplaners ausgedruckt, hätte ich mich wahrscheinlich stundenlang verirrt bei meinem Versuch, den richtigen Weg unter etlichen sich träge räkelnden Serpentinen zu finden, die den Navigator meines Routenplaners immer wieder zu provozieren und zu verspotten schienen und mich die Hügel hinauf zum Connecticut State Asylum führten.
Doch obwohl bereits die Fahrt unter einem schlechten Stern zu stehen schien, wurde dieser düstere Eindruck noch deutlich durch das übertroffen, was ich empfand, als ich auf den Parkplatz rollte und das weitläufige Gelände des Connecticut State Asylum zum ersten Mal vor mir sah. Wenn ich sagen würde, dass der Ort einen nachhaltigen und unangenehmen Eindruck auf mich machte, so wäre dies die diplomatischste Formulierung, die ich finden kann. Der Gebäudekomplex war gewaltig, was mich angesichts der Unterfinanzierung dieser Einrichtung einigermaßen überraschte, und er strahlte eine unverwechselbare Atmosphäre des Verfalls aus, wie sie nur einer ehemals stolzen Institution eigen ist, die durch Jahre der Vernachlässigung schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Während ich an einer aufgegebenen und mit Brettern vernagelten Ruine nach der anderen vorbeifuhr, in denen sich einst die verschiedenen Stationen befunden haben mussten – einige bestanden aus fahlem, bröckelndem Backstein, andere aus flechtenbedecktem, von Efeu überwuchertem Sandstein –, konnte ich mir kaum vorstellen, wie jemand einst hier gearbeitet oder gar gelebt haben mochte.
In der Mitte des Klinikgeländes und so mächtig, dass es seine aufgegebenen Brüder geradezu winzig erscheinen ließ, befand sich jenes eine Haus, das trotz der Budgetkürzungen noch in Betrieb war: das Hauptgebäude der Klinik. Trotz seiner vergleichsweise funktionalen Form wirkte dieser monströse Klotz aus rotem Backstein, als hätte man mit seiner Errichtung alle möglichen Ziele verfolgt, nur jenes eine nicht, das darin bestand, die Schatten zu vertreiben, die Denken und Empfinden der Patienten heimsuchten. Seine hoch aufragende Gestalt, die von strengen rechten Winkeln beherrscht wurde und deren Fenster nichts weiter als vergitterte rechtwinklige Löcher waren, schien die Verzweiflung nur noch zu vergrößern und alles in einen zusätzlichen Schatten tauchen zu wollen. Sogar die massive weiße Freitreppe, die zu den Eingangstüren führte – die einzige Verzierung, die man dem Gebäude zugestanden hatte – sah eher aus wie etwas, das man weniger bemalt, sondern vielmehr mit Bleichmitteln behandelt hatte. Als ich die Treppe anstarrte, hatte ich ungewollt den Eindruck, als triebe mir ein letzter Hauch von Desinfektionsmitteln in die Nase. Nie zuvor hatte ich ein Gebäude gesehen, das so sehr die unerbittlichen und wenig einladenden Konturen willkürlich erzwungener geistiger Gesundheit zu verkörpern schien.
Paradoxerweise war das Innere des Gebäudes bemerkenswert sauber und gepflegt, wenn auch farblos und karg. Eine gelangweilt aussehende Frau am Empfang beschrieb mir den Weg zum Büro der medizinischen Direktorin im obersten Stock. Wie zu erwarten, summte der Aufzug ein paar Augenblicke leise, bevor er plötzlich und unerwartet mit einem Ruck im zweiten Obergeschoss anhielt. Ich wappnete mich gegenüber einem zweiten Fahrgast, während sich die Aufzugtür langsam öffnete. Doch davor wartete nicht nur eine einzige Person. Vielmehr waren es drei Krankenschwestern, die um eine Rolltrage standen, auf der ein Mann lag. Doch obwohl er auf der Trage fixiert war, begriff ich sofort, dass es sich nicht um einen Patienten handelte. Er trug die Uniform eines Pflegers. Und er schrie.
»Lasst – mich – los!«,...
| Erscheint lt. Verlag | 11.10.2021 |
|---|---|
| Übersetzer | Martin Ruf |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | The Patient |
| Themenwelt | Literatur ► Krimi / Thriller / Horror ► Krimi / Thriller |
| Schlagworte | Alex Michaelides • eBooks • Gothic • Horror • Irrenanstalt • Kindheitstrauma • Neuengland • Online Portal • Patient • Psychiatrie • Sebastian Fitzek • Spannung • Stephen King • Tagebuch |
| ISBN-10 | 3-641-26753-6 / 3641267536 |
| ISBN-13 | 978-3-641-26753-7 / 9783641267537 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich