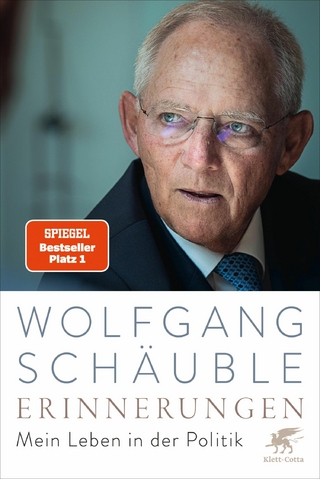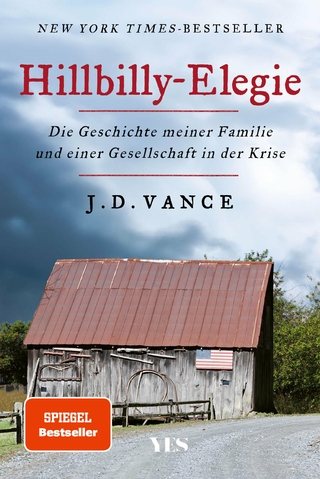Das Jahr magischen Denkens (eBook)
256 Seiten
Ullstein (Verlag)
978-3-8437-1009-1 (ISBN)
Joan Didion, geboren 1934 in Sacramento, Kalifornien, arbeitete als Journalistin für verschiedene amerikanische Zeitungen und war Mitherausgeberin der Vogue. Sie gilt als eine der wichtigsten Stimmen der amerikanischen Literatur, die mit ihren fünf Romanen und zahlreichen Essaybänden das intellektuelle Leben der USA im 20. Jahrhundert entscheidend prägte. Joan Didion starb im Dezember 2021 in New York.
Joan Didion, geboren 1934 in Sacramento, Kalifornien, arbeitete als Journalistin für verschiedene amerikanische Zeitungen und war u. a. Redakteurin der Vogue. Sie hat fünf Romane und zahlreiche Sachbücher veröffentlicht, darunter Das Jahr magischen Denkens. Joan Didion lebt in New York City.
2
30. Dezember 2003, ein Dienstag.
Wir hatten Quintana auf der Intensivstation im sechsten Stock des Beth Israel Nord besucht.
Wir waren nach Hause gekommen.
Wir hatten überlegt, ob wir ausgehen oder zu Hause essen sollten.
Ich sagte, ich würde ein Feuer machen, wir könnten zu Hause essen.
Ich machte Feuer, ich bereitete das Essen, ich fragte John, ob er was trinken wolle.
Ich goß ihm einen Scotch ein und brachte ihm das Glas ins Wohnzimmer, wo er lesend im Sessel neben dem Feuer saß, wie gewöhnlich.
Das Buch, das er las, war von David Fromkin, ein gebundener Fahnenabzug von Europas letzter Sommer. Die scheinbar friedlichen Wochen vor dem Ersten Weltkrieg.
Ich machte das Essen fertig, ich deckte den Tisch im Wohnzimmer, wo wir, wenn wir allein zu Hause waren, mit Blick auf das Feuer essen konnten. Ich hebe dieses Feuer so hervor, weil Feuer für uns wichtig waren. Ich wuchs in Kalifornien auf, John und ich lebten gemeinsam vierundzwanzig Jahre dort, in Kalifornien heizten wir unsere Häuser, indem wir Feuer machten. Wir machten sogar an Sommerabenden Feuer, weil der Nebel hereinkam. Das Feuer sagte uns, wir waren zu Hause, der Kreis schloß sich, wir waren sicher für die Nacht. Ich zündete die Kerzen an. John bat um ein zweites Glas Scotch, bevor er sich hinsetzte. Ich gab es ihm. Wir setzten uns. Meine Aufmerksamkeit galt dem Mischen des Salats.
John redete, dann redete er nicht.
An einem Punkt innerhalb der Sekunden oder der Minute, bevor er zu sprechen aufhörte, hatte er mich gefragt, ob ich beim zweiten Glas Single Malt Scotch verwendet hätte. Ich sagte nein, ich hätte denselben Scotch verwendet wie beim ersten Glas. »Gut«, hatte er gesagt. »Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, man sollte sie nicht vermischen.« An einem anderen Punkt innerhalb dieser Sekunden oder dieser Minute hatte er darüber geredet, warum der Erste Weltkrieg der entscheidende Augenblick war, dem der gesamte Rest des zwanzigsten Jahrhunderts entströmte.
Ich habe keine Ahnung, bei welchem Thema wir gerade waren, beim Scotch oder beim Ersten Weltkrieg, als er plötzlich aufhörte zu reden.
Ich erinnere mich nur, daß ich aufsah. Seine linke Hand war erhoben, und er war zusammengesackt, reglos. Zuerst dachte ich, er mache einen mißglückten Scherz, einen Versuch, die Schwierigkeit des Tages erträglicher aussehen zu lassen.
Ich erinnere mich, daß ich sagte: Hör auf damit.
Als er nicht reagierte, war mein erster Gedanke, daß er schon angefangen hatte zu essen und sich dabei verschluckt hatte. Ich erinnere mich, wie ich versuchte, ihn soweit wie möglich von der Lehne wegzurücken, um ihm auf den Rücken klopfen zu können. Ich erinnere mich, wie sich sein Gewicht anfühlte, als er nach vorn fiel, zuerst gegen den Tisch, dann auf den Fußboden. In der Küche hatte ich eine Karte mit den Nummern für den Rettungswagen vom New York Presbyterian Krankenhaus neben das Telefon geklebt. Ich hatte die Nummern dort nicht hingeklebt, weil ich einen Moment wie diesen voraussah. Ich hatte die Nummern neben das Telefon geklebt für den Fall, daß jemand aus dem Haus einen Notarzt brauchte.
Jemand anderes.
Ich rief eine der Nummern an. Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes fragte, ob er atmete. Ich sagte: Kommen Sie her. Als die Notärzte kamen, versuchte ich, ihnen zu sagen, was passiert war, aber bevor ich damit fertig war, hatten sie den Teil des Wohnzimmers, in dem John lag, in eine Notaufnahme verwandelt. Einer von ihnen (es waren drei, vielleicht vier, selbst eine Stunde später hätte ich das nicht sagen können) sprach mit dem Krankenhaus über das EKG, das sie offenbar bereits übermittelten. Ein anderer machte die erste oder zweite von den vielen Injektionen fertig, die noch folgen würden. (Epinephrin? Lidocain? Procainamid? Im Kopf tauchten die Namen auf, aber ich hatte keine Ahnung, woher.) Ich erinnere mich, daß ich sagte, er hätte sich möglicherweise verschluckt. Das war mit einem Finger-schlag abgetan: Die Luftröhre war frei. Sie schienen jetzt zu defibrillieren, der Versuch, einen normalen Herzrhythmus wiederherzustellen. Es stellte sich etwas ein, was ein normaler Herzschlag hätte sein können (das dachte ich jedenfalls, wir waren alle still gewesen, dann gab es ein heftiges Aufbäumen), aber der Rhythmus sprang wieder um, und sie fingen nochmal an.
»Herzflimmern«, hörte ich den einen am Telefon sagen.
»Kammerflimmern«, sagte Johns Herzspezialist am nächsten Morgen, als er aus Nantucket anrief. »Sie hätten Kammerflimmern gesagt.«
Vielleicht sagten sie »Kammerflimmern«, vielleicht auch nicht. Nicht jedes Flimmern verursachte sofort oder notwendigerweise Herzstillstand. Kammerflimmern schon. Vielleicht war es hier Kammerflimmern gewesen.
Ich erinnere mich, wie ich mir darüber klar zu werden versuchte, was als nächstes kam. Da sich ein Notfallteam im Wohnzimmer befand, bestünde der nächste logische Schritt darin, ins Krankenhaus zu fahren. Mir wurde klar, daß die Notärzte sich sehr plötzlich entschließen könnten, ins Krankenhaus zu fahren, und ich wäre nicht fertig. Ich hätte nichts zur Hand, was ich mitnehmen mußte. Ich würde Zeit verlieren, zurückbleiben. Ich fand meine Handtasche und die Schlüssel und eine Zusammenfassung von Johns Krankengeschichte, die sein Arzt gemacht hatte. Als ich ins Wohnzimmer zurückkam, beobachteten die Notärzte den Computerbildschirm, den sie auf dem Fußboden aufgestellt hatten. Ich konnte den Bildschirm nicht sehen, also beobachtete ich ihre Gesichter. Ich erinnere mich, daß der eine den anderen einen kurzen Blick zuwarf. Als die Entscheidung zu fahren gefallen war, ging alles sehr schnell. Ich folgte ihnen zum Fahrstuhl und fragte, ob ich mitkommen könne. Sie sagten, sie würden zuerst die Trage runterbringen, ich könne dann mit dem zweiten Rettungswagen mitfahren. Einer von ihnen wartete mit mir, bis der Fahrstuhl wieder oben war. Als er und ich in den zweiten Rettungswagen stiegen, fuhr der Wagen mit der Trage bereits vom Hauseingang weg. Die Entfernung von unserem Hauseingang zu jenem Teil des New York Presbyterian, das einmal das New York Krankenhaus war, beträgt sechs Querstraßen. Ich habe keine Erinnerung an Sirenen. Ich habe keine Erinnerung daran, wie der Verkehr war. Als wir an der Notaufnahme ankamen, verschwand die Trage bereits im Gebäude. Ein Mann wartete in der Auffahrt. Alle anderen, die zu sehen waren, trugen Kittel. Er nicht. »Ist das die Ehefrau«, sagte er zu dem Fahrer, dann wandte er sich zu mir. »Ich bin Ihr Sozialarbeiter«, sagte er, und ich glaube, da muß ich es gewußt haben.
Ich mach die Tür auf und seh den Mann in Grün, und ich wußte es. Ich wußte es sofort.
Das hatte die Mutter eines Neunzehnjährigen, der von einer Bombe in Kirkuk getötet worden war, in einer Fernsehdokumentation gesagt, und Bob Herbert zitierte es in der Morgenausgabe der New York Times vom 12. November 2004. »Aber ich dachte, solange ich ihn nicht reinlasse, kann er es mir nicht sagen. Und dann wäre es – nichts davon wäre passiert. Also sagt er immer wieder: ›Hören Sie, Sie müssen mich reinlassen.‹ Und ich sag immer wieder: ›Entschuldigen Sie, aber ich kann Sie nicht reinlassen.‹«
Als ich das beim Frühstück las, fast elf Monate nach der Nacht mit dem Rettungswagen und dem Sozialarbeiter, erkannte ich darin mein eigenes Denken.
In der Notaufnahme sah ich, wie die Trage in eine Kabine geschoben wurde, von weiteren Leuten in Kitteln. Jemand bat mich, in der Anmeldung zu warten. Was ich tat. Vor dem Schalter für die Aufnahme hatte sich eine Schlange gebildet. In der Schlange zu warten schien das Sinnvollste zu sein, was ich tun konnte. In der Schlange zu warten bedeutete, daß immer noch genug Zeit war, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, ich hatte Kopien der Versicherungskarten in meiner Handtasche, es war keines der Krankenhäuser, die ich jemals in Betracht gezogen hatte – das ehemalige New York Krankenhaus war jetzt der Cornell-Teil des New York Presbyterian; was ich kannte, war der Columbia-Teil, Columbia Presbyterian an der Ecke 168. Straße und Broadway, bestenfalls zwanzig Minuten entfernt, zu weit für einen Notfall wie diesen – aber ich konnte mit dem ungewohnten Krankenhaus fertig werden, ich konnte mich nützlich machen, ich konnte mich um die Verlegung ins Columbia Presbyterian kümmern, sobald er stabilisiert war. Ich war mit den Details dieser Verlegung ins Columbia beschäftigt (er würde ein Bett mit Monitorüberwachung brauchen, vielleicht konnte ich auch Quintana ins Columbia verlegen lassen, in der Nacht, als sie im Beth Israel Nord aufgenommen worden war, hatte ich mir die Pieper-Nummern von verschiedenen Ärzten des Columbia auf eine Karte geschrieben, der eine oder andere von ihnen würde das alles ermöglichen), als der Sozialarbeiter zurückkam und mich aus der Schlange in ein leeres Zimmer neben der Anmeldung führte.
»Sie können hier warten«, sagte er. Ich wartete. Im Zimmer war es kalt, oder mir war kalt. Ich fragte mich, wieviel Zeit vergangen war zwischen dem Moment, als ich den Rettungswagen gerufen hatte, und der Ankunft der Notärzte. Es hatte ausgesehen, als sei überhaupt keine Zeit vergangen (ein Blinzeln im Auge Gottes war die Formulierung, die mir im Zimmer neben der Anmeldung einfiel), aber es müssen wenigstens mehrere Minuten gewesen sein.
Am Schwarzen Brett in meinem Arbeitszimmer hatte ich aus Gründen, die mit einem Plot Point in einem Film zusammenhingen, immer eine rosa Karteikarte hängen. Darauf hatte ich einen Satz aus dem Merck Jahresbericht getippt, der davon handelte, wie lange ein Gehirn ohne Sauerstoffzufuhr auskam. In diesem Zimmer...
| Erscheint lt. Verlag | 16.6.2014 |
|---|---|
| Übersetzer | Antje Ravic Strubel |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | Annabelle Dunne • Biografie • Céline • Dokumentation • Familie • Geschenkformat • Griffin Dunne • Leben • Liebe • Literatur • mini • Mini Geschenkbuch • Mini Geschenkformat • Mini Hardcover • Netflix • Roman • Schmerz • Silvia Bovenschen • Taschenbibliothek • The Center Will Not Hold • Tod • Trauer • Trauerarbeit • USA • USA-Tod • Vanessa Redgrave • Verlust |
| ISBN-10 | 3-8437-1009-0 / 3843710090 |
| ISBN-13 | 978-3-8437-1009-1 / 9783843710091 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich