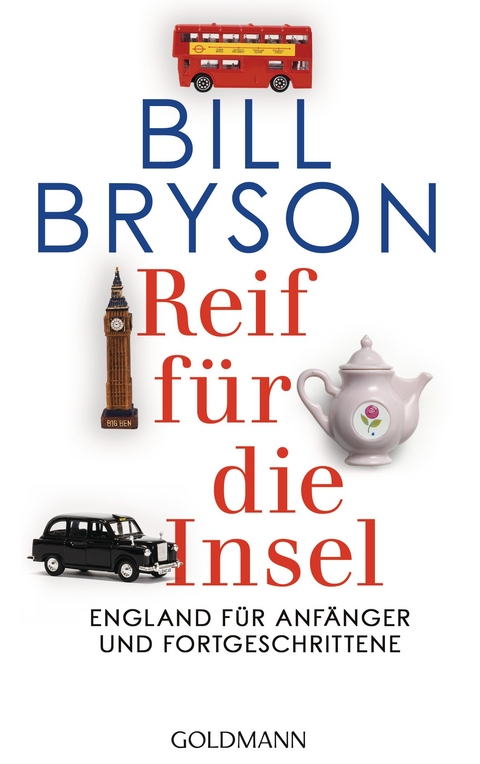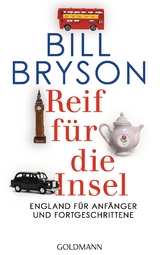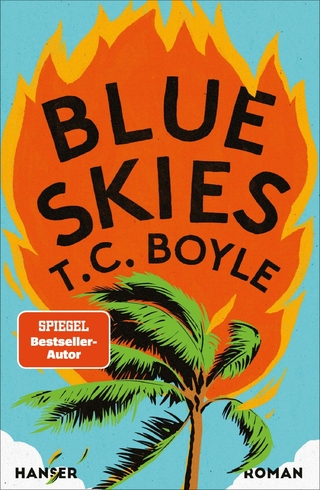Reif für die Insel (eBook)
416 Seiten
Goldmann (Verlag)
978-3-641-09057-9 (ISBN)
Was ist das für ein Land, in dem so unaussprechliche Namen wie Llywyngwril auf den Ortsschildern stehen? Wo Kekse gereicht werden, die jedes Gebiss bedrohen? Von den Kalkfelsen Dovers bis ins raue schottische Thurso erkundet Bryson die eigentümliche Weit jenseits des Ärmelkanals und kommt zu dem Schluss: England muss man einfach lieben - ganz gleich, wie wunderlich es einem zuweilen erscheinen mag.
Bill Bryson wurde 1951 in Des Moines, Iowa, geboren. 1977 zog er nach Großbritannien und schrieb dort mehrere Jahre u. a. für die Times und den Independent. Mit seinem Englandbuch »Reif für die Insel« gelang Bryson der Durchbruch. Heute ist er in England der erfolgreichste Sachbuchautor der Gegenwart. Seine Bücher werden in viele Sprachen übersetzt und stürmen stets die internationalen Bestsellerlisten. 1996 kehrte Bill Bryson mit seiner Familie in die USA zurück, wo es ihn jedoch nicht lange hielt. Er war erneut »Reif für die Insel«, wo er heute wieder lebt.
Prolog
Zum erstenmal erblickte ich England in einer nebligen Märznacht des Jahres 1973. Ich kam mit der Mitternachtsfähre aus Calais. Zwanzig Minuten lang herrschte im Ankunftsbereich hektisches Treiben, Autos und Lastwagen strömten heraus, die Zöllner versahen ihren Dienst, und alle Leute drängten zur Straße nach London. Dann trat urplötzlich Stille ein, und ich wanderte durch schlafende, schlechtbeleuchtete Straßen, durch die der Nebel waberte wie in einem Bulldog-Drummond-Film. Herrlich, ich hatte eine englische Stadt ganz für mich allein!
Ein wenig verstörend war nur, daß offenbar schon alle Hotels und Gästehäuser für die Nacht geschlossen hatten. Ich ging zum Bahnhof, weil ich noch einen Zug nach London erwischen wollte, aber dort war ebenfalls alles dunkel und verrammelt. Während ich dastand und überlegte, was ich tun sollte, bemerkte ich das graue Licht eines Fernsehers im oberen Fenster einer Pension. Hurra, dachte ich, da ist noch jemand wach, und eilte hinüber. Für den Besitzer legte ich mir eine demütige Entschuldigung wegen meiner späten Ankunft zurecht und malte mir schon unseren heiteren Dialog aus. Unter anderem folgende Zeile: »Nein, ich kann doch nicht von Ihnen verlangen, daß Sie mir um diese Zeit noch etwas zu essen machen. Nein, ehrlich – na gut, wenn Sie meinen, also, wenn es Ihnen wirklich keine Mühe bereitet, dann nehme ich vielleicht ein Roastbeef-Sandwich und ein wenig Kartoffelsalat mit einer großen Gewürzgurke. Und eine Flasche Bier.« Der Eingangsweg war pechschwarz, und in meinem Eifer und meiner mangelnden Vertrautheit mit britischen Türeingängen stolperte ich über eine Stufe, krachte gegen die Tür und schickte ein halbes Dutzend leerer Milchflaschen klirrend zu Boden. Prompt öffnete sich das obere Fenster.
»Wer ist da?« ertönte eine strenge Stimme.
Ich trat zurück, rieb mir die Nase und starrte auf eine Schattengestalt mit Lockenwicklern. »Guten Abend, ich suche ein Zimmer«, sagte ich.
»Wir haben geschlossen.«
»Oh.« Und mein Abendessen?
»Versuchen Sie es mal beim Churchill. Da vorne.«
»Wo vorne?« fragte ich, aber schon knallte das Fenster wieder zu.
Das prächtige, hellerleuchtete Churchill war auf nächtliche Gäste eingestellt. Durchs Fenster erspähte ich ein paar Männer in Anzügen, die weltmännisch elegant an der Bar standen. Da fühlte ich mich gleich wie der letzte Penner und blieb unschlüssig im Dunkeln stehen. Klamottenmäßig paßte ich nicht in ein solches Ambiente, und es lag auch außerhalb meiner bescheidenen finanziellen Möglichkeiten. Erst am Vortag hatte ich in der Picardie einem Hotelier mit verschmitzten Äuglein ein außergewöhnlich pralles Bündel farbenprächtiger Francs ausgehändigt, als Obolus für eine Nacht in einem durchgelegenen Bett und eine Portion blanquette de chasseur, ein mysteriöses Ragout, das aus den Knochen diverser kleiner Tiere bestand, von denen ich ein Gutteil heimlich in einer großen Serviette verschwinden ließ, um nicht unhöflich zu erscheinen. Ich hatte beschlossen, hinfort vorsichtiger mit meinen Ausgaben zu sein. Widerstrebend kehrte ich also der einladenden Wärme des Churchill den Rücken und trottete ab in die Dunkelheit.
Weiter hinten an der Marine Parade stand ein überdachtes, ansonsten aber den Elementen preisgegebenes Buswartehäuschen, und ich schloß messerscharf, daß ich etwas Besseres nicht mehr kriegen würde. Ich legte mich hin, benutzte meinen Rucksack als Kopfkissen und zog meine Jacke eng um mich zusammen. Die Bank war aus harten Latten und mit großen runden Schrauben bestückt, was – zweifellos mit Absicht – eine bequeme Ruhelage unmöglich machte. Ich lag lange wach, lauschte, wie das Meer unter mir an den Kieselstrand schlug, und schlief schließlich ein. Es wurde eine lange, kalte Nacht, in der mich unruhige Träume plagten. Ich wurde über arktische Treibeisschollen von einem Franzosen verfolgt, der verschmitzte Äuglein, eine Schleuder, einen Beutel Schrauben und eine unheimliche Zielsicherheit besaß und mir wiederholt Hiebe auf Hinterteil und Beine versetzte, weil ich eine Leinenserviette gestohlen und sie voll durchsuppendem Essen in der hintersten Ecke einer Kommodenschublade in meinem Hotelzimmer versteckt hatte. Gegen drei Uhr erwachte ich nach Atem ringend, von Kopf bis Fuß steif und bebend vor Kälte. Der Nebel war weg, die Luft still und klar, am Himmel funkelten Sterne. Ein Lichtstrahl vom Leuchtturm am anderen Ende der Wellenbrecher ergoß sich endlos über das Meer. Es war alles wunderschön, aber mir war viel zu kalt, um es angemessen würdigen zu können. Zitternd stöberte ich in meinem Rucksack und angelte jeden potentiell wärmenden Gegenstand heraus, dessen ich habhaft werden konnte – ein Flanellhemd, zwei Pullover, eine weitere Jeans. Ich zog mir Wollsocken über die Hände und in meiner Verzweiflung eine Boxershorts als Kopfwärmer aufs Haupt, sank dann schwer zurück auf die Bank und wartete geduldig auf den süßen Kuß des Todes. Doch ich schlief wieder ein.
Dann erwachte ich abrupt vom Heulen eines Nebelhorns, das mich beinahe von meiner engen Bettstatt fegte, und setzte mich hin. Mir war hundeelend, aber ein Spur weniger kalt. Die Welt war in dieses milchige Licht vor der ersten Morgendämmerung getaucht, das aus dem Nichts zu kommen scheint. Möwen kreisten kreischend über dem Wasser. Hinter ihnen, jenseits der steinernen Wellenbrecher, glitt eine riesige, helleuchtende Fähre majestätisch aufs Meer hinaus. Eine Weile blieb ich sitzen, ein junger Mann mit mehr auf dem Kopf als darin. Erneut dröhnte und klagte das Nebelhorn des Schiffs übers Wasser und machte die dämlichen Möwen wieder ganz nervös. Ich zog meine Sockenhandschuhe aus und schaute auf die Uhr. Es war fünf Uhr fünfundfünfzig. Ich sah der sich entfernenden Fähre nach und fragte mich, wo wohl um diese Zeit Menschen hinwollten. Wo wollte ich um diese Zeit eigentlich hin? Ich nahm meinen Rucksack und schlurfte über die Promenade, um meinen Kreislauf in Gang zu bringen.
Beim Churchill, das nun seinerseits friedlich schlief, traf ich einen alten Knaben, der seinen Hund ausführte. Hektisch versuchte die Töle, auf jede erreichbare senkrechte Fläche zu pieseln, und wurde folglich weniger Gassi geführt als auf drei Beinen Gassi gezerrt.
Als ich zu den beiden aufschloß, nickte mir der Mann einen Guten-Morgen-Gruß zu. »Vielleicht wird’s schön«, verkündete er und starrte hoffnungsfroh zum Firmament, das aussah wie ein Stapel nasser Handtücher. Ich fragte ihn, ob eventuell irgendwo ein Restaurant geöffnet habe. Er kannte eins nicht weit weg und beschrieb mir den Weg dorthin. »Die beste Fernfahrerkneipe in Kent«, sagte er.
»Fernfahrerkneipe?« wiederholte ich unsicher, während ich ein paar Schritte zurückwich, weil mir auffiel, daß der Hund verzweifelt an der Leine zog, um mir die Hosenbeine anzufeuchten.
»Sehr beliebt bei LKW-Fahrern. Die kennen sowieso immer die besten Kneipen, was?« Er lächelte liebenswürdig, senkte dann die Stimme ein ganz kleines bißchen und beugte sich zu mir vor, als wolle er mit etwas streng Vertrauliches mitteilen. »Vielleicht sollten Sie die Unterhose besser abnehmen, bevor Sie dorthingehen.«
Ich griff mir an den Kopf – oh! – und zog mir errötend die Boxershorts ab. Während ich noch versuchte, mir eine kurze, treffende Erklärung auszudenken, schaute der Mann schon wieder prüfend gen Himmel.
Mit den Worten »Es klart definitiv auf« schleifte er den Hund auf der Suche nach neuen Senkrechten mit sich fort. Ich sah ihnen nach, drehte mich um und ging die Promenade entlang. Da begann es in Strömen zu gießen.
Die Kneipe war wunderbar – voller Leben und wohlig warm. Ich gönnte mir ein Frühstück mit Eiern, Bohnen, fetttriefendem Röstbrot, Speck und Würstchen, Brot, Margarine und zwei Tassen Tee. Alles für 22 Pence. Mit einem Zahnstocher und einem Rülpsen kam ich als neuer Mensch heraus, schlenderte glücklich durch die Straßen und beobachtete, wie Dover zum Leben erwachte. Leider sah die Stadt im Tageslicht nicht sehr viel besser aus, aber sie gefiel mir. Vor allem, daß sie so klein und gemütlich war und alle einander »Guten Morgen« sagten und »Hallo« und »schreckliches Wetter – aber vielleicht klart es auf«, und daß ein weiterer Tag in einer sehr langen Reihe rundherum heiterer, angenehm ereignisloser Tage vor mir lag. In ganz Dover würde niemand einen besonderen Grund haben, sich an den 21. März 1973 zu erinnern – außer mir und einer Handvoll Kindern, die an dem Tag geboren wurden, und vielleicht einem alten Knaben, der seinen Hund spazierengeführt und einen jungen Burschen mit Unterhosen auf dem Kopf getroffen hatte.
Weil ich nicht wußte, wie früh man in England nach einem Zimmer fragen konnte, beschloß ich, es noch aufzuschieben beziehungsweise die Zeit zu nutzen, mir eine Pension zu suchen, die sauber und ruhig, aber auch freundlich und nicht zu teuer ausah. Schlag zehn Uhr stand ich auf der Schwelle derjenigen, auf die meine Wahl gefallen war. Ich sah mich vor, keine Milchflaschen über den Haufen zu rennen. Es war ein kleines Hotel. Besser gesagt, eine Familienpension.
Ich kann mich an den Namen nicht erinnern, aber an die Besitzerin sehr wohl! Mrs. Smegma war eine mächtige Gestalt Ende Vierzig. Sie zeigte mir ein Zimmer, nahm mich mit auf einen Rundgang durch das Etablissement und erläuterte mir die vielen komplizierten Regeln des Hauses – wann das Frühstück serviert wurde, wie man den Badeofen anstellte, zu welchen Tageszeiten man die Räumlichkeiten verlassen mußte und während...
| Erscheint lt. Verlag | 31.5.2012 |
|---|---|
| Übersetzer | Sigrid Ruschmeier |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Notes from a Small Island |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Bräuche • eBooks • England • England / Großbritannien • Großbritannien • Humor • Klischees • Kultur • lustig • lustige • Reisebericht • Reisen • Sachbuch • Sitten • typisch • Unterhaltung • Wissenswertes |
| ISBN-10 | 3-641-09057-1 / 3641090571 |
| ISBN-13 | 978-3-641-09057-9 / 9783641090579 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich