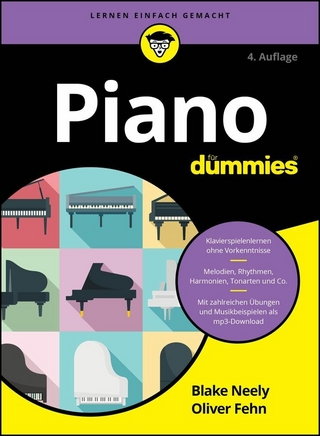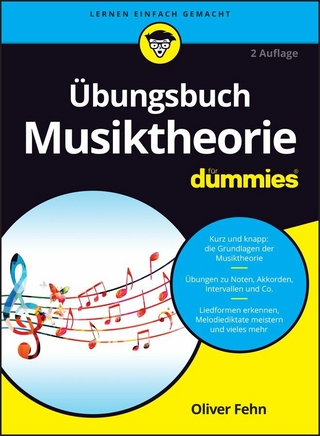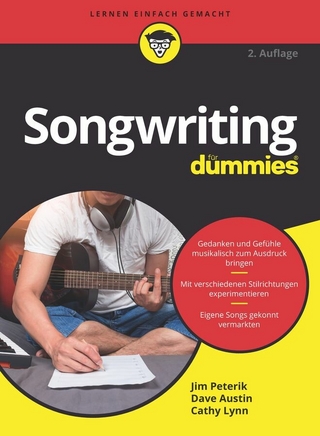Sprechen wir über Musik (eBook)
176 Seiten
Siedler (Verlag)
978-3-641-09015-9 (ISBN)
Joachim Kaiser, der bekannteste und renommierteste Musikkritiker unserer Zeit, antwortet auf naheliegende, außergewöhnliche und auch unvermutete Fragen zur Klassik. Er schöpft dabei aus seinem enormen Wissen und würzt seine Texte mit zahlreichen Anekdoten aus dem Leben großer Musiker. Immer getragen von seiner bedingungslosen Liebe zur Musik.
Joachim Kaiser wurde 1928 in Ostpreußen geboren. Er studierte Musikwissenschaft, Germanistik, Philosophie und Soziologie (unter anderem bei Adorno) und wurde in Tübingen promoviert. Seine journalistische Laufbahn als Theater,- Literatur- und Musikkritiker begann er bei den Frankfurter Heften und beim Hessischen Rundfunk, früh wurde er Mitglied der 'Gruppe 47'. 1959 begann er bei der Süddeutschen Zeitung und wurde bald leitender Redakteur des Feuilletons. Von 1977 bis 1996 war er zudem Professor an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart . Er publizierte auch zahlreiche Radiosendungen und Bücher. In Zusammenarbeit mit seiner Tochter Henriette Kaiser erschienen 2008 seine Erinnerungen 'Ich bin der letzte Mohikaner'. Joachim Kaiser starb 2017.
KAPITEL II
Auf der Bühne, hinter der Bühne
Was macht einen Heldentenor aus?
Ist falsch spielen eine Sünde? Und müssen
Pianisten auswendig spielen?
Früh übt sich
Führt ein Königsweg zur klassischen Musik?
Häufig ist es doch so: Will man jungen Leuten etwas Gutes tun, schenkt man ihnen zum Geburtstag, zur Firmung, zu Weihnachten eine Kassette mit allen Bruckner-Symphonien, mit allen Beethoven-Sonaten, mit dem gesamten Orchesterwerk von Brahms und denkt sich: Was für ein tolles Geschenk! Falsch gedacht. Diese allerschönsten Kassetten werden nämlich unberührt, unerhört, unerlöst verstauben. Gleiches gilt natürlich für verschenkte Schiller- oder Goethe-Gesamtausgaben.
Und warum? Weil man des Guten zu viel tut, weil man überschenkt, überfordert. Meine Erfahrung – das war auch bei meinen eigenen Kindern so – ist die: Man muss sich die Mühe machen, sich selber zu engagieren. Man muss den Jüngeren dazu verhelfen, dass sie von einem bestimmten Werk begeistert sein können. Dabei darf man nicht pädagogisch heucheln, sondern muss im Gespräch verdeutlichen, warum einen etwas besonders ergreift, warum man etwas fragwürdig findet oder warum eine Interpretation, die zwar korrekt ist, langweilig erscheint und eine andere, nicht ganz so korrekte hingegen faszinierend wirkt.
Man muss also glaubhaft die Wichtigkeit einer Komposition vermitteln. Je früher, umso besser. Dann weckt man Interesse. Ist das gelungen, hat man schon gewonnen. CDs verschenken ist nur eine Vorbedingung, wenn auch eine wichtige. Musik verschenken heißt aber eigentlich: Zeit für Hinwendung und ansteckende Leidenschaft. Das ist der wahre Königsweg.
Gute Sänger, schlechte Sänger
Wie wichtig ist die Schauspielkunst in der Oper?
Es mag ein Fortschritt sein, dass bei heutigen Opernaufführungen verstärkt auf die Schauspielfähigkeiten der Sänger geachtet wird. Sie wallen oder schreiten nicht mehr primadonnenhaft über die Bühne, seit Sprechtheaterregisseure wie Patrice Chereau, Herbert Wernicke oder Martin Kusej die Opernhäuser erobert haben, sondern versuchen, ihre Rolle lebendig zu gestalten. Im Idealfall ergibt sich dadurch ein neuer Blick auf die dargestellte Figur und somit auch auf das Werk.
Dass aber ein Sänger durch darstellerische Begabung eine nur mittlere Stimmkraft ausgleichen kann, bezweifle ich. Im Gesang kommen viel mehr Affekte zum Ausdruck, als es jeder noch so hingebungsvollen Opernregiearbeit möglich ist. Auch textlich kann man zum Beispiel aus Belcanto-Opern nicht allzu viel herausholen. Bellinis Norma, Donizettis Lucia di Lammermoor, Rossinis Barbier von Sevilla oder Verdis Traviata verfügen über verhältnismäßig harmlose, manchmal fast albern verwirrende Libretti.
Es ist kein Zufall, dass man bei Wagner- oder Strauss-Opern den Versuch unternommen hat, die Dialoge nur zu sprechen. Dabei entpuppten sich etwa die Texte der Meistersinger oder des Rosenkavaliers als anspruchsvoll und hochinteressant. Dennoch reichen Worte nie an die Musik heran: Sie transportiert das Seelische gleich in mehreren Dimensionen.
Gutes, ausdrucksstarkes Singen ist in der Oper also eine Conditio sine qua non, eine unverzichtbare Bedingung. Man kann das Singen auch nicht nur auf eine Komponente in einem Gesamtkunstwerk reduzieren wie etwa im Musical, wo die Darsteller auch noch gut aussehen und gut tanzen können müssen.
Gleichwohl würde ich sofort einräumen, dass der moderne Opernbetrieb uns Opernliebhabern manchmal gar schreckliche Aufführungen zumutet. Man denke nur an all die älteren, fülligen Kammersänger, die in der Rolle des jugendlichen Liebhabers eine komische Figur abgeben. Da heißt es dann: Augen zu und durch.
Der Preis ist heiß
Warum werden von Orchestern und
Plattenfirmen meist nur Pianisten engagiert,
die bereits international bedeutende Aus-
zeichnungen gewonnen haben?
Die Inflation internationaler Musikwettbewerbe hat dazu geführt, dass auch blasse Pianisten inzwischen mit lauter Preisen aufwarten können. Sie sind unverbindlich, fast beliebig geworden. Gleichwohl schadet es der Karriere eines Künstlers, wenn er keine medienwirksamen Auszeichnungen vorweisen kann. Eine Jury, die einen ersten Preis zu vergeben hat oder darüber befindet, wer in den erlauchten Kreis einer Akademie aufgenommen werden soll, einigt sich gerne auf einen Kompromisskandidaten, auf jemanden ohne Ecken und Kanten. Stehen eine bedeutende, betörende Pianistin und ein wilder, exzentrischer Geiger zur Wahl, dann wird die Jury sich eher für den fabelhaften, fehlerfreien, wenn auch farblosen Perfektionisten entscheiden, also für den Mittelweg.
Hat nicht Arnold Schönberg einmal festgestellt, der Mittelweg sei der einzige, der nicht nach Rom führt? Er hielt den Mittelweg für gefährlich, und er tat dies, ganz deutscher Expressionist, aus gutem Grund. Jedenfalls besteht bei so einem Selektionsverfahren tatsächlich zunehmend die Gefahr, dass nur noch jene Musiker von einem Orchester oder einer Plattenfirma engagiert werden, die dem Standard der Branche genügen, und dass individuelle Spielart und Virtuosität auf der Strecke bleiben.
Das Leben als Juror ist eine heikle Mission, und außerdem anstrengend. Ich spreche aus Erfahrung. Als Mitglied einer Jury muss man stunden-, manchmal auch tagelang intensiv zuhören, es geht schließlich um Leben und Tod. Man darf nicht eine Minute unkonzentriert sein, das wäre gegenüber den Kandidaten sehr ungerecht. Ich traf einmal den Flötisten Aurele Nicolet, eigentlich ein lustiger Kerl. Er machte einen verstörten Eindruck, ich fragte, was ihm fehle. Er komme gerade aus einer Jury, sagte er, vor der alle 140 Kandidaten das Flötenkonzert von Jacques Ibert vorspielen mussten. Er habe sich also 140 Mal das gleiche Stück anhören müssen. Das erfordere, meinte Nicolet, übermenschliche Kräfte. Spätestens nach dem hundertsten Mal habe er nicht mehr gewusst, ob er noch etwas konkret gehört hat oder ob wirre Höreindrücke aus den hundert vorangegangenen Ibert-Konzerten in seinem Kopf herumgespukt hätten.
Ja, Wettbewerbe können grausam sein. Da hat jemand jahrelang geübt, und dann erfährt er in 20 oder 40 Minuten, dass er leider nicht gut genug sei und durchfallen muss. Ein junger Musiker kann aber auch, und das ist die andere Seite solcher Klassik-Contests, in kurzer Zeit weltberühmt werden. Genies wie Friedrich Gulda oder Anne-Sophie Mutter haben sich bereits blutjung bei Wettbewerben durchgesetzt.
Mein Fazit nach unzähligen Jurysitzungen lautet: Wer in die Runde der sechs Besten gelangt, an dessen Qualität braucht man kaum mehr zu zweifeln. Dass generell das Ansehen der Preisverleihungen schwindet, hängt mit ihren Abnutzungserscheinungen zusammen. Überall werden Preise ausgeschrieben. Damit machen sich vor allem die Veranstalter wichtig. Sie setzen einen Preis aus, oft kümmerlich dotiert, um in die Schlagzeilen zu kommen. Das finde ich ärgerlich. Mein Vorschlag zur Güte: Wer einen öffentlichen Preis auslobt, sollte mindestens 50000 Euro an den Gewinner auszahlen müssen. Eine hohe Dotierung würde – man denke nur an den Nobelpreis – die Qualität enorm steigern. Und die Anzahl der Preise reduzieren.
Die Pointe in Takt 138
Wieso spielte Vladimir Horowitz immer
wieder dieselbe Chopin-Ballade, wo es doch
so wunderbare Alternativen gegeben hätte?
Es war Frederic Chopin, der im 19. Jahrhundert die Klavierballade erfunden und der Welt geschenkt hat. Diese Form gab es vor ihm nicht, obwohl die Ballade selbst schon seit dem späten Mittelalter existierte, in der Literatur und in Volkstänzen.
Seine erste Ballade, op. 23 in g-Moll, schrieb der polnische Komponist im Jahre 1835, die vierte und letzte Ballade in f-Moll verfasste er sieben Jahre später, also 1842. Dazwischen die F-Dur- und die As-Dur-Ballade. Das Thema der ersten Ballade scheint mir, was die Einfälle betrifft, seine stärkste und vitalste Balladenkomposition zu sein. Eigentlich sind es zwei Themen, die sich aneinander abarbeiten, aber nicht wie in einer Sonate quasi akademisch gegeneinandergesetzt; sondern Chopin geleitet diese Musik gewissermaßen durch die Zeit und steigert wunderbar einfallsreich. Seine Freunde nannten die Ballade damals Die Polnische. Robert Schumann mochte sie von allen Chopin-Werken am liebsten. Chopin selbst übrigens auch. In dem oscarprämierten Film Der Pianist von Roman Polanski spielt der jüdisch-polnische Pianist Wladyslaw Szpilman einem deutschen Offizier minutenlang in Todesangst genau dieses...
| Erscheint lt. Verlag | 19.11.2012 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Kunst / Musik / Theater ► Musik |
| Schlagworte | eBooks • Klassik • Komponisten • Konzert • Kritiker • Kunst • Mozart • Musik • Musikführer • Oper • Publikum • Sänger • Wagner |
| ISBN-10 | 3-641-09015-6 / 3641090156 |
| ISBN-13 | 978-3-641-09015-9 / 9783641090159 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 963 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich